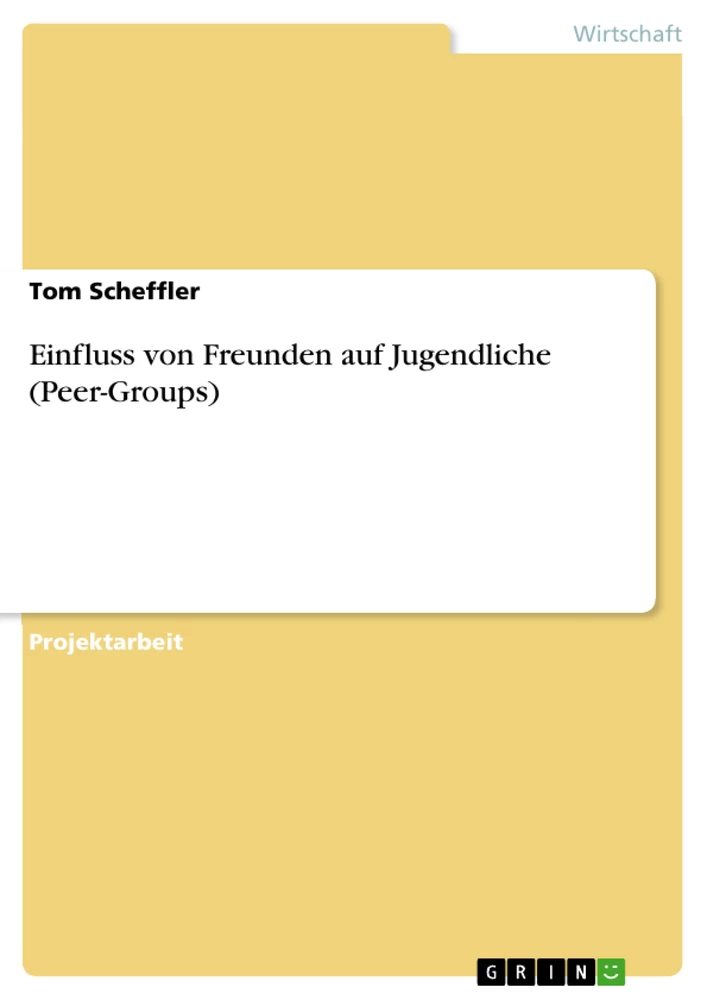Beim Übergang vom Teenager zum Erwachsenen brauchen Jugendliche anscheinend nicht nur den Einfluss von Eltern, Lehrern oder Erziehern, sondern auch den Einfluss von Freunden bzw. Gleichaltrigen als Interaktionspartner, die keinen Erfahrungs- und Kompetenzvorsprung haben (Krappmann, 2010, S. 187). Die Gruppe der Gleichaltrigen (Peer-Group) stellt heute „eine zentrale Bezugsgruppe für Jugendliche dar“ (Nörber, 2003, S. 10), deren mächtiger Einfluss noch immer unterschätzt wird (Opp, 2008, S. 19). Die Peer – Groups können als eine entscheidende Sozialisationsinstanz für die Entwicklung des Sozialverhaltens der Jugendlichen angesehen werden (Beer, 2007, S. 67). Der Prozess der Sozialisation beinhaltet in dem Kontext alle Erfahrungen und damit verbundenen Prozesse, die eine Person benötigt, um sich zu einer sozialen Persönlichkeit zu entwickeln (Schnabel, 2001, S. 36). In der Jugendphase, welche den Lebensabschnitt zwischen dem Übergang von der unselbstständigen Kindheit zur selbstständigen Erwachsenenrolle darstellt (Hurrelmann, 2007, S. 31), ist festzustellen, dass die Teenager einen erheblichen Teil ihrer Zuneigung und Bewunderung von den Eltern abziehen und den Gleichaltrigen widmen (Bopp, 1983, S. 143). In diesem Zusammenhang beschäftigt sich diese Projektarbeit mit dem „Einfluss von Freunden auf Jugendliche (Peer - Groups).“ Das Ziel der Projektarbeit ist es, zu verstehen, warum die Jugendlichen vermehrt den Kontakt zu Gleichaltrigen bzw. Freunden suchen, warum Freundschaften gerade in der Jugendphase so wichtig sind, in welchen Einflussbereichen die Freunde die Eltern ablösen und in welchen Einflussbereichen die Eltern, trotz der zunehmenden Bedeutung der Freunde, die erste Bezugsperson bleiben. Hierzu werden zunächst in Kapitel 2 die Peer - Groups näher beschrieben. Die Projektarbeit beleuchtet zunächst, was unter einer Peer - Group zu verstehen ist, welche Formen eine Peer - Group haben kann, welche Bedeutung und Funktionen von ihr ausgehen und wo der Unterschied zwischen Peer - Beziehungen und Eltern – Kind-Beziehungen ist. Kapitel 3 beschreibt anschließend zwei mögliche Einflussbereiche von Freunden auf Jugendliche. An den Beispielen der Berufswahl und des Alkoholkonsums wird versucht herauszustellen wie groß der Einfluss der Freunde wirklich sein kann.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Peer - Groups als Begleiter durch die Jugendzeit
2.1 Definition Peer - Group
2.2 Formen von Peer - Groups
2.3 Bedeutung und Funktionen von Peer - Groups
2.4 Vergleich von Peer-Beziehungen und Eltern-Kind Beziehungen
3 Mögliche Einflussbereiche von Freunden auf Jugendliche
3.1 Alkoholkonsum
3.2 Berufswahl
4 Fazit
Literaturverzeichnis
Was ist eine Peer-Group?
Eine Peer-Group ist eine Gruppe von Gleichaltrigen, die als zentrale Bezugsgruppe für Jugendliche dient und eine wichtige Sozialisationsinstanz darstellt.
Warum suchen Jugendliche vermehrt Kontakt zu Gleichaltrigen?
In der Jugendphase lösen sich Teenager von den Eltern ab. Peers bieten Interaktion auf Augenhöhe ohne den Erfahrungs- und Kompetenzvorsprung Erwachsener.
Wie beeinflussen Freunde den Alkoholkonsum?
Die Peer-Group kann sowohl präventiv wirken als auch durch Gruppenzwang oder als Vorbild den Einstieg in den Alkoholkonsum fördern.
Welchen Einfluss haben Freunde auf die Berufswahl?
Freunde dienen als Orientierungshilfe und Austauschpartner, wobei deren Meinungen und Pläne oft das eigene Interesse an bestimmten Berufsfeldern prägen.
Ersetzen Freunde die Eltern als Bezugspersonen vollständig?
Nein, die Arbeit zeigt, dass Eltern in vielen grundlegenden Bereichen trotz der wachsenden Bedeutung der Peer-Group die erste Bezugsperson bleiben.