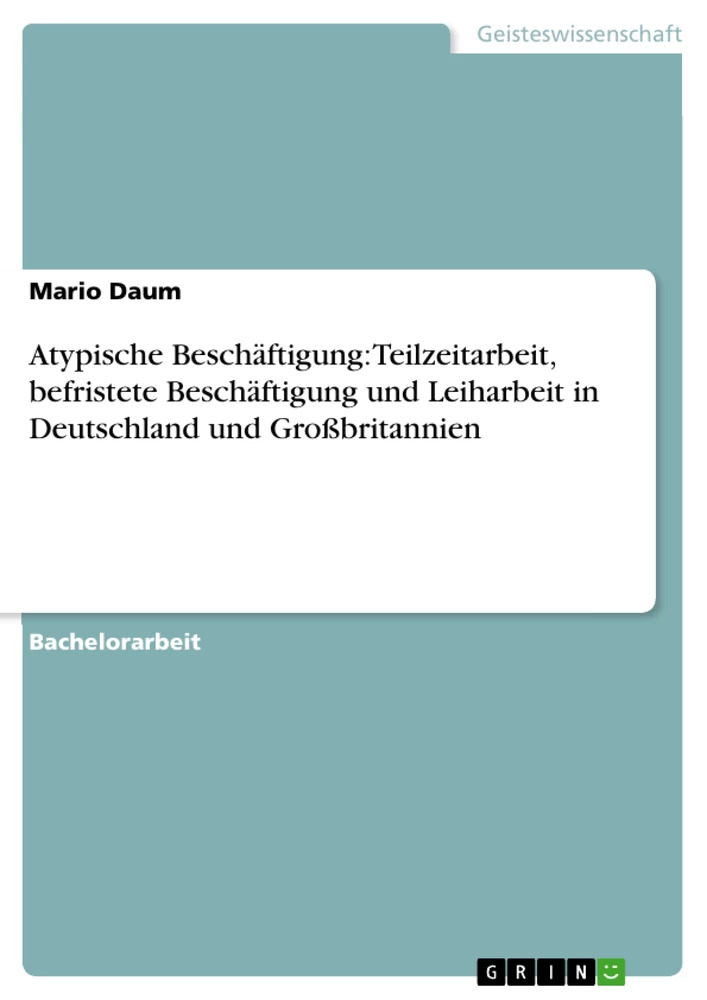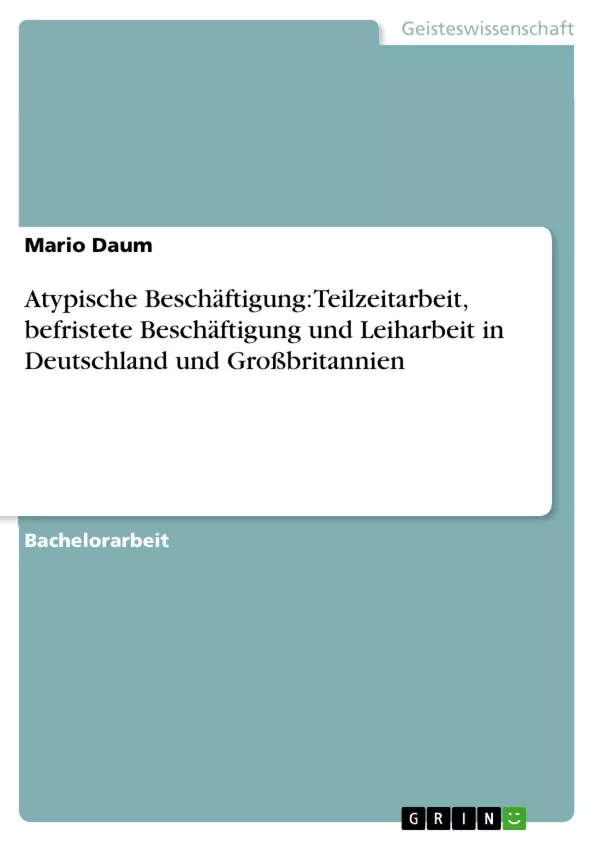Diese Bachelorarbeit untersucht die Entwicklungen der atypischen Beschäftigungsformen, Teilzeitbeschäftigung, befristete Beschäftigung und Leiharbeit, vor dem Hintergrund des Varieties of Capitalism-Ansatzes. Untersuchungsgegenstand sind mit Deutschland und Großbritannien zwei unterschiedliche Typen der Marktwirtschaft.
Es wird die Konvergenz- und Divergenz-, sowie die Dualismus-Hypothese im Bereich der Arbeitsmarktreformen der vergangenen 30 Jahre untersucht. Hiermit kann aufgezeigt werden, dass sich die Unterschiede zwischen Deutschland und Großbritannien aufgrund des steigenden Wettbewerbsdrucks, steigender Deregulierungsmaßnahmen sowie des politischen Drucks internationaler Institutionen verringern. Die deutsche und britische Arbeitsmarktpolitik nähern sich im Bereich der Teilzeitbeschäftigung, befristeten Beschäftigung und Leiharbeit einander an.
Die Untersuchung der Daten für die drei atypischen Beschäftigungsformen relativieren hingegen die Befunde aus der Analyse der Arbeitsmarktpolitik. Lediglich die Teilzeitbeschäftigung weist Konvergenz auf. Aufgrund institutioneller Begebenheiten ist die befristete Beschäftigung von Divergenz gekennzeichnet. Hinsichtlich der Leiharbeit ist eine leichte Konvergenz ersichtlich, deren Entwicklung in den künftigen Jahren neu zu untersuchen ist.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretischer Hintergrund
2.1 Konvergenz
2.2 Divergenz
2.3 Dualismus - Konvergenz und Divergenz
2.4 Operationalisierung
2.5 Hypothesen
3 Produktionssysteme nach dem Varieties of Capitalism-Ansatz
3.1 Koordinierte Marktwirtschaft - Deutschland
3.2 Liberale Marktwirtschaft - Großbritannien
4 Atypische Beschäftigung
4.1 Definition und Formen
5 Analyse der Arbeitsmarktreformen
5.1 Deutschland
5.2 Großbritannien
5.3 Ergebnisse
6 Analyse der quantitativen Dimension
7 Zusammenfassung und Diskussion
A Anhang
Literatur
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter atypischer Beschäftigung?
Dazu zählen Arbeitsverhältnisse, die vom Standardmodell (Vollzeit, unbefristet) abweichen, wie Teilzeitarbeit, befristete Beschäftigung und Leiharbeit.
Wie unterscheiden sich Deutschland und Großbritannien im Arbeitsmarkt?
Deutschland gilt als koordinierte Marktwirtschaft, während Großbritannien eine liberale Marktwirtschaft ist. Beide haben unterschiedliche Ansätze bei der Regulierung atypischer Arbeit.
Gibt es eine Annäherung (Konvergenz) der Arbeitsmarktpolitik?
Ja, aufgrund von Wettbewerbsdruck und Deregulierung nähern sich die Politiken beider Länder im Bereich der Teilzeit und Leiharbeit an.
Warum gibt es bei befristeter Beschäftigung weiterhin Unterschiede (Divergenz)?
Institutionelle Begebenheiten und nationale Gesetzgebungen sorgen dafür, dass die Entwicklung befristeter Verträge in beiden Ländern weiterhin unterschiedliche Wege geht.
Was besagt die Dualismus-Hypothese?
Sie untersucht das gleichzeitige Bestehen von Kernbelegschaften (Standardarbeit) und Randbelegschaften (atypische Arbeit) und wie Reformen dieses Verhältnis beeinflussen.
- Quote paper
- Mario Daum (Author), 2012, Atypische Beschäftigung: Teilzeitarbeit, befristete Beschäftigung und Leiharbeit in Deutschland und Großbritannien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199480