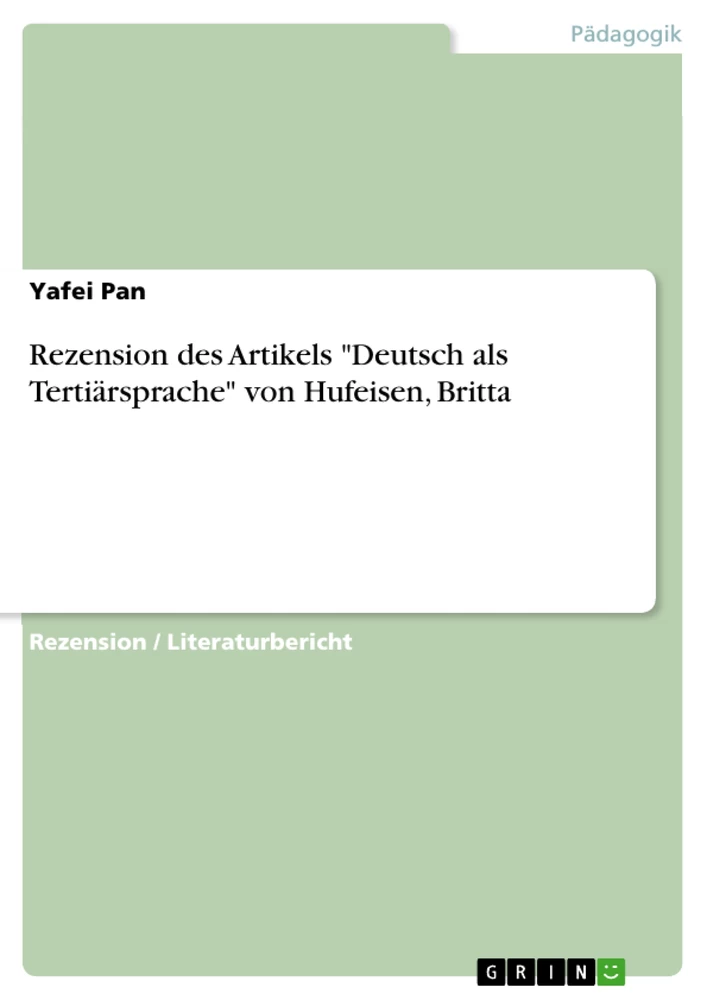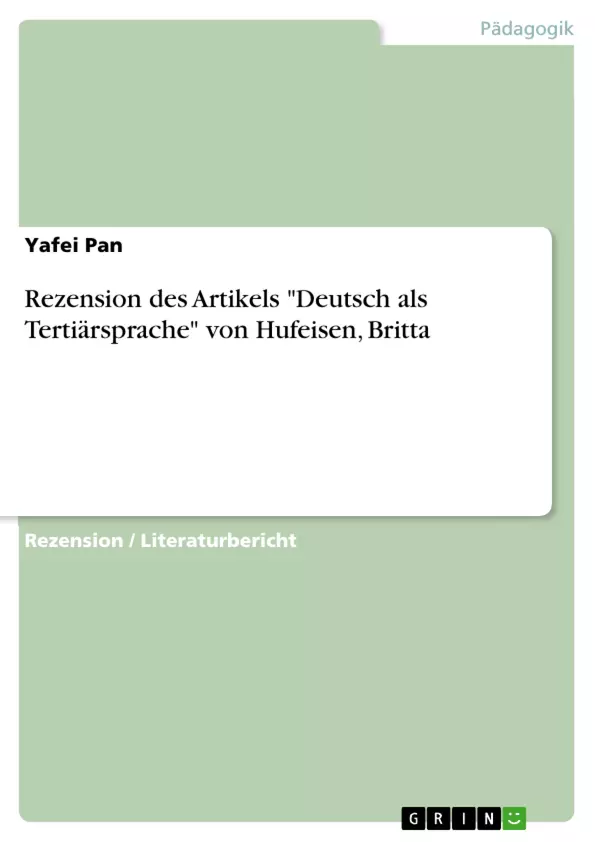Der Artikel „Deutsch als Tertiärsprache” wurde im Jahr 2001 in „Deutsch als Fremdsprache: ein internationales Handbuch” (S. 648 - 652) aufgenommen. Prof. Dr. Britta Hufeisen ist die Leiterin des Sprachzentrums der Technischen Universität Darmstadt. Ihr Schwerpunkt ist Mehrsprachigkeitsforschung und Deutsch als Fremdsprache (vgl. http://www.goethe.de/lhr/prj/mac/spw/de2370512.htm).
Die Konstellation der Sprachenfolge „Englisch als erste Fremdsprache und Deutsch als zweite Fremdsprache“ ist im schulischen Fremdsprachenangebot in vielen Ländern weit verbreitet. Laut Hufeisen werde Deutsch in den USA als zweite Fremdsprache nach Spanisch gewählt oder als zweite Fremdsprache nach Französisch im englischsprachigen Kanada und in Großbritannien (vgl. Hufeisen 2001: 648). Vor dem Lernen der L3 haben Menschen schon gewisse Sprachkenntnisse ‚im Kopf”. Deswegen sei es ganz sinnvoll, eine Unterscheidung zwischen DaF und DaT zu ma-chen, dadurch könne man besser dazu forschen.
In dem vorliegenden Artikel stellt Hufeisen zuerst die Definition von Deutsch als Tertiärsprache vor, wie der Forschungsgegenstand begründet wurde und wie er sich entwicklt hat. Anschließlich werden forschungsmethodische, didaktische und methodische Fragen erörtert. Zuletzt gibt die Autorin einen Ausblick auf die zukünftigen Entwicklungen in dem Bereich Deutsch als Tertiärsprache. [...]
Rezension des Artikels
Deutsch als Tertiärsprache von Hufeisen, Britta
Textgrundlage:
Der Artikel „Deutsch als Tertiärsprache” wurde im Jahr 2001 in „Deutsch als Fremdsprache: ein internationales Handbuch” (S. 648 - 652) aufgenommen. Prof. Dr.Britta Hufeisenist die Leiterin des Sprachzentrums der Technischen Universität Darmstadt. Ihr Schwerpunkt ist Mehrsprachigkeitsforschung und Deutsch als Fremdsprache (vgl. http://www.goethe.de/lhr/prj/mac/spw/de2370512.htm).
Einleitung
Die Konstellation der Sprachenfolge „Englisch als erste Fremdsprache und Deutsch als zweite Fremdsprache“ ist im schulischen Fremdsprachenangebot in vielen Ländern weit verbreitet.Laut Hufeisen werde Deutsch in den USA als zweite Fremdsprache nach Spanisch gewählt oder als zweite Fremdsprache nach Französisch im englischsprachigen Kanada und in Großbritannien (vgl. Hufeisen 2001: 648). Vor dem Lernen der L3 haben Menschen schon gewisse Sprachkenntnisse ‚im Kopf”. Deswegensei es ganz sinnvoll, eine Unterscheidung zwischen DaF und DaT zu machen, dadurch könne man besser dazuforschen.
In dem vorliegenden Artikel stellt Hufeisen zuerst die Definition von Deutsch als Tertiärsprache vor, wie der Forschungsgegenstand begründet wurde und wie er sich entwicklt hat. Anschließlich werden forschungsmethodische, didaktische und methodische Fragen erörtert. Zuletzt gibt die Autorin einen Ausblick auf die zukünftigen Entwicklungen in dem Bereich Deutsch als Tertiärsprache.
1. Definition und Begründung des Forschungsgegenstandes
In diesem Kapitel definiert Hufeisen den Begriff Deutsch als Tertiärsprache wie folgt: „Deutsch ist bereits die dritte oder weitere Sprache, die jemand spricht; jemand hat Deutsch strukturiert gelernt und nicht wie eine Muttersprache oder Zweitsprache erworben“ (Hufeisen 2001: 648). Dann unterscheidet sie die Aneignungstypen „lernen“ und „erwerben“. Sie meint, dass die L3 (zweite Fremdsprache) oft nur gelernt und nicht erworben werden könne. D.h., die meisten Schüler können sich die L3 nicht im Zielsprachenland durch eigene Erfahrungen aneignen. Stattdessen „lernen“ sie die Sprache durch eine begrenzte Anzahl von Unterrichtstunden mit Lehrwerk und Grammatikregeln. Deutsch für Ausländer ist eine typische Tertiärsprache, da Englisch häufiger als L2 (zweite Sprache; erste Fremdsprache) gelernt wird.
Vor dem Deutschlernen verfügt der Lerner normalerweise nicht nur schon über eine bestimmte Lernmethode, einen eigenen Lernstil, sondern auch über mehr Lebenserfahrungen und Intellektualität, die für das weitere Sprachlernen sehr hilfreich sind. Vor dem Beginn macht der Lerner schon eine Prognose über die Schwierigkeiten im Lernprozess, z.B. in welchem Aspekt bin ich besonders schwach: hören, lesen oder schreiben? Welche Sprachphänomene behindern meinen Aneignungsprozess: Ambiguitäten, Funktionsverben oder andere? Das erleichtert das Lernen. Aus folgender Abbildung kann man deutlich ersehen, was die Unterschiede zwischen L2-und L3-Lernen sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Lernen einer L2 Lernen einer L3 (649)
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptinhalt des Artikels "Deutsch als Tertiärsprache" von Britta Hufeisen?
Der Artikel von Britta Hufeisen aus dem Jahr 2001 behandelt Deutsch als Tertiärsprache (DaT). Er definiert den Begriff, begründet den Forschungsgegenstand, erörtert forschungsmethodische, didaktische und methodische Fragen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich. Der Artikel untersucht, wie sich das Lernen von Deutsch als dritter oder weiterer Sprache von Deutsch als Zweitsprache (DaZ) unterscheidet, wobei besonderes Augenmerk auf die Vorkenntnisse und Lernerfahrungen der Lernenden gelegt wird.
Wie definiert Hufeisen Deutsch als Tertiärsprache?
Hufeisen definiert Deutsch als Tertiärsprache als die dritte oder weitere Sprache, die jemand spricht, nachdem Deutsch strukturiert gelernt wurde und nicht wie eine Muttersprache oder Zweitsprache erworben wurde. Sie betont den Unterschied zwischen "lernen" und "erwerben" und stellt fest, dass L3 oft gelernt und nicht erworben wird.
Welche Unterschiede werden zwischen dem Lernen einer L2 und einer L3 hervorgehoben?
Der Artikel stellt fest, dass Lernende beim Erlernen einer L3 bereits über Sprachkenntnisse, Lernmethoden, Lernstile, Lebenserfahrungen und Intellektualität verfügen. Sie können Schwierigkeiten im Lernprozess besser einschätzen und Sprachphänomene, die den Aneignungsprozess behindern, leichter identifizieren. Die Erfahrungen aus dem L2-Lernen bilden das Fundament für das Lernen der L3.
In welchen Regionen wird die Forschung zu Deutsch als Tertiärsprache betrieben?
Laut Hufeisen wird diese Forschung hauptsächlich in Europa, Nordafrika und einigen asiatischen Ländern betrieben, deutlich weniger in Nordamerika oder Australien.
Warum ist das Beherrschen von mehr als nur einer Fremdsprache in Europa zunehmend wichtiger?
Hufeisen vermutet, dass die guten nachbarlichen Beziehungen und das starke Bedürfnis nach Verständigung untereinander Gründe dafür sind, dass die Beherrschung von mehr als nur einer Fremdsprache in Europa zunehmend wichtiger wird.
- Citar trabajo
- Yafei Pan (Autor), 2009, Rezension des Artikels "Deutsch als Tertiärsprache" von Hufeisen, Britta, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199482