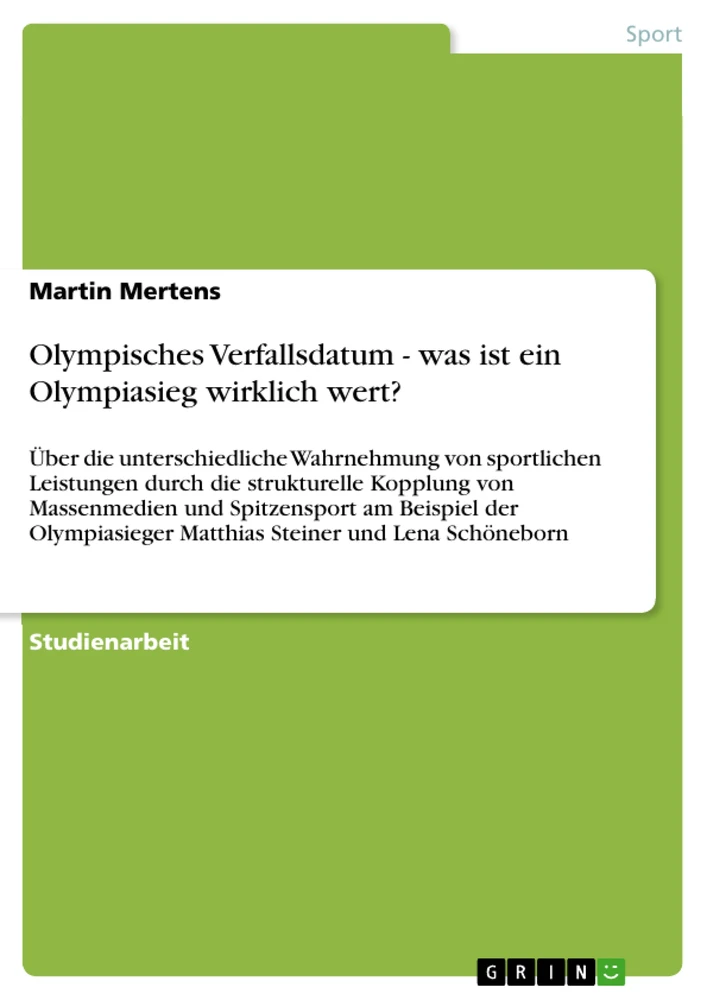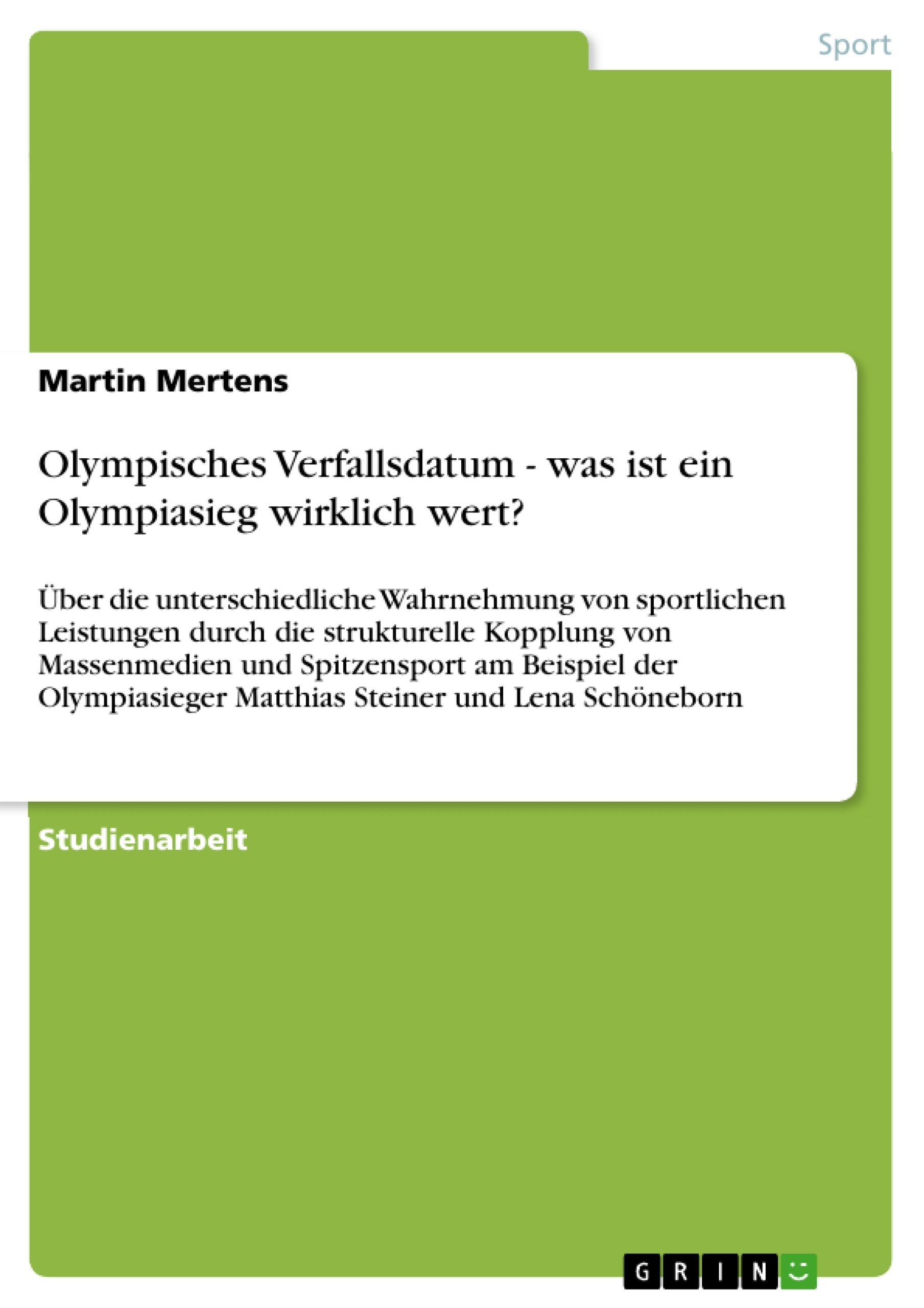Sport ist Leidenschaft, Sport ist Emotion und am Ende überleben die Legenden der Sieger. Aber ist das wirklich alles? Ist Sport nur das reine Ergebnis? Ist Sport nur die Erbringung einer sportlichen Leistung mit dem Ziel, der oder die Beste zu sein? Gibt es beim Spitzen- bzw. Leistungssport nichts außer Sieg und Niederlage? Auf dem ersten Blick ja, doch bei genauerer Betrachtung ist dies beim Spitzen- bzw. Leistungssport nicht unbedingt der Fall. Zwar steht am Anfang immer die Erbringung und der Vollzug einer sportlichen Leistung, doch danach folgt ein erbitterter Wettkampf um Sponsorenverträge, mediale Anschlussfähigkeit, Steigerung des Marktwertes und Bekanntheit sowie Vermarktung der eigenen Person und Leistung und das Streben über eine möglichst lange Zeitspanne im Fokus der Öffentlichkeit zu bleiben.
Somit zeigen der Spitzen- bzw. Leistungssport, insbesondere die Wahrnehmung sportlicher Leistung, ein immens großes Repertoire an verschiedenen Facetten, Perspektiven und Betrachtungsweisen auf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Theoretisches Modell
- Der Spitzensport und dessen Codierung Sieg/Niederlage
- System-Umwelt-Beziehungen des Spitzensports
- Die Ressource Publikum
- Die Ressource Massenmedien
- Die Ressource Wirtschaftssystem
- Die Ressource Politiksystem
- Sporthelden und Spitzensport als Sportheldentum
- Spitzensport als Heldensystem
- Heldentypologie und die verschiedenen Ausprägungen des Heldentums im Spitzensport
- Theorie der identitätsorientierten Markenführung nach Meffert und Burmann
- Potenzielle Aspekte bei der Vermarktung von Sportlern
- Fallstudie
- Theoretisches Modell
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Wahrnehmung von sportlichen Leistungen im Spitzensport am Beispiel der Olympiasieger Matthias Steiner und Lena Schöneborn. Sie untersucht, welche Faktoren neben der sportlichen Leistung selbst die Wahrnehmung und Vermarktung von Athleten beeinflussen.
- Die Rolle der Massenmedien im Spitzensport
- Die Bedeutung von System-Umwelt-Beziehungen im Spitzensport
- Die Konstruktion von Sporthelden und die verschiedenen Ausprägungen des Heldentums im Spitzensport
- Die Theorie der identitätsorientierten Markenführung im Kontext des Spitzensport
- Die Vermarktung von Sportlern als Marke
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und beleuchtet die unterschiedliche Wahrnehmung von sportlichen Leistungen nach Olympiasiegen am Beispiel von Matthias Steiner und Lena Schöneborn. Sie stellt die Relevanz der Themenfelder Medien, Wirtschaft, Politik und Publikum für die Vermarktung von Athleten heraus.
- Theoretisches Modell: Dieses Kapitel entwickelt ein theoretisches Modell, das die relevanten Faktoren für die Analyse der Fragestellung beleuchtet. Es behandelt die Codierung von Sieg und Niederlage im Spitzensport, die System-Umwelt-Beziehungen des Spitzensports, die Rolle von Sporthelden und Sportheldentum sowie die Theorie der identitätsorientierten Markenführung.
- Fallstudie: Die Fallstudie vertieft die Analyse anhand der konkreten Beispiele von Matthias Steiner und Lena Schöneborn. Sie beleuchtet ihre unterschiedlichen Karrierewege nach ihren Olympiasiegen in Peking 2008 und untersucht die Rolle der genannten Faktoren in ihren jeweiligen Fällen.
Schlüsselwörter
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des Spitzensport, der Wahrnehmung sportlicher Leistungen, der Vermarktung von Sportlern, den System-Umwelt-Beziehungen, den Massenmedien, dem Sportheldentum, der identitätsorientierten Markenführung und der Soziologie sozialer Prominenz.
Häufig gestellte Fragen
Ist ein Olympiasieg heute mehr als nur sportliche Leistung?
Ja, ein Olympiasieg ist heute untrennbar mit Sponsorenverträgen, medialer Vermarktung und der Steigerung des Marktwertes der eigenen Person verbunden.
Welche Rolle spielen die Massenmedien für Sporthelden?
Die Massenmedien sind eine zentrale Ressource, die darüber entscheidet, wie lange ein Athlet im Fokus der Öffentlichkeit bleibt und wie sein "Heldentum" konstruiert wird.
Was besagt die identitätsorientierte Markenführung im Sport?
Diese Theorie nach Meffert und Burmann besagt, dass Sportler als Marken aufgebaut werden müssen, um langfristig wirtschaftlich erfolgreich und für Sponsoren attraktiv zu sein.
Warum werden Matthias Steiner und Lena Schöneborn als Beispiele gewählt?
Die Arbeit vergleicht ihre unterschiedlichen Karrierewege und medialen Wahrnehmungen nach ihren jeweiligen Olympiasiegen in Peking 2008.
Welche System-Umwelt-Beziehungen sind für den Spitzensport relevant?
Der Spitzensport interagiert maßgeblich mit den Systemen Publikum, Massenmedien, Wirtschaft und Politik.
- Arbeit zitieren
- B.A. Martin Mertens (Autor:in), 2009, Olympisches Verfallsdatum - was ist ein Olympiasieg wirklich wert?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199505