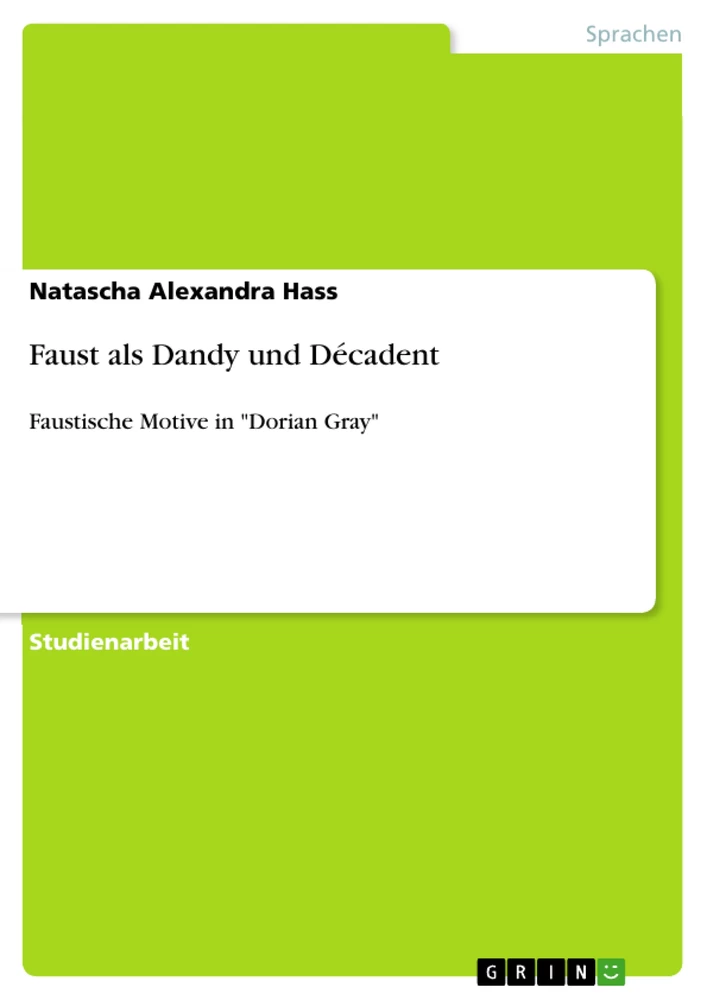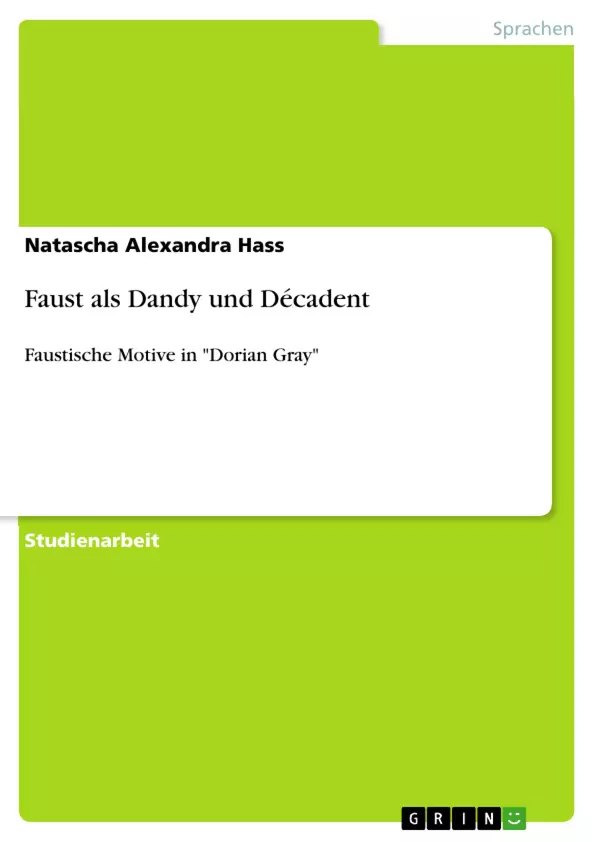Die Arbeit soll klären, inwiefern Dorian Gray „faustisch“ ist und in welchem Ausmaß man Goethes Faust als Dekadent bezeichnen könnte. Des Weiteren werden auch andere Figuren der Werke verglichen und mögliche Parallelen gezogen. Beispielweise wird untersucht in wie weit Lord Henry Wotton und Mephistopheles einen vergleichbaren Einfluss auf die Protagonisten ausüben oder ob Basil Hallward und Goethes Darstellung von Gott Gemeinsamkeiten in den Stücken aufweisen. Die Analyse der Berührungspunkte führt zu den Unterschieden. Es soll aufgezeigt werden, was die beiden Werke verbindet und was sie voneinander trennt, und inwiefern sich die Handlung, der Aufbau und die Figuren entsprechen oder unterscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Fauststoff
- Merkmale der Faust-Figur
- Englischsprachige Faustdichtungen
- Faustische Motive in „The Picture Of Dorian Gray“
- Dorian Gray und Faust
- Lord Henry Wotton/Mephisto und Basil Hallward/Gott
- Dorian/Sibyl und Faust/Gretchen
- Unterschiede zum Fauststoff
- Genussstreben statt Erkenntnissuche
- Der Pakt mit dem Teufel für die ewige Jugend
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Parallelen zwischen Oscar Wildes „The Picture of Dorian Gray“ und Goethes „Faust“, um zu erforschen, inwiefern Dorian Gray „faustisch“ ist und in welchem Ausmaß Goethes Faust als Dekadent bezeichnet werden kann.
- Die Charakterisierung der Faust-Figur und ihre Eigenschaften
- Die Rezeption von Goethes Faust in der englischsprachigen Literatur
- Die Analyse von faustischen Motiven in „The Picture of Dorian Gray“
- Die Unterschiede zwischen den beiden Werken
- Die Verbindung von Handlung, Aufbau und Figuren in beiden Texten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor und erläutert, dass die beiden Werke „Faust“ und „The Picture of Dorian Gray“ miteinander verglichen werden sollen, um die „faustischen“ Aspekte in Dorian Grays Charakter und Goethes Faust als Dekadent zu untersuchen.
Der Fauststoff
Dieses Kapitel erläutert den Begriff des „Faustischen“ und beschreibt die Eigenschaften der Faust-Figur in Goethes Tragödie. Es wird herausgestellt, dass Fausts unendlicher Wissensdurst und Erkenntnisverlangen ihn zu einem Grenzgänger machen, der bereit ist, einen Pakt mit dem Teufel zu schließen.
Faustische Motive in „The Picture of Dorian Gray“
Dieses Kapitel analysiert die faustischen Motive in Oscar Wildes „The Picture of Dorian Gray“ und stellt Parallelen zwischen Dorian Gray und Faust sowie Lord Henry Wotton und Mephistopheles sowie Basil Hallward und Goethes Darstellung von Gott heraus.
Unterschiede zum Fauststoff
Dieses Kapitel zeigt die Unterschiede zwischen Goethes „Faust“ und Oscar Wildes „The Picture of Dorian Gray“ auf. Während Fausts Streben nach Erkenntnis im Vordergrund steht, ist Dorian Grays Wunsch nach ewiger Jugend und sinnlichen Genüssen der treibende Faktor.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind „Faust“, „Faustisch“, „Dekadenz“, „Dorian Gray“, „Mephistopheles“, „Pakt mit dem Teufel“, „Wissensdurst“, „Erkenntnisverlangen“, „Genussstreben“, „ewige Jugend“ und „Parallelen“.
Häufig gestellte Fragen
Inwiefern ist Dorian Gray eine "faustische" Figur?
Dorian Gray zeigt Parallelen zu Faust durch seinen Wunsch nach ewiger Jugend und den symbolischen Pakt, der sein Porträt altern lässt, während er selbst jung bleibt.
Welche Rolle spielt Lord Henry Wotton im Vergleich zu Mephisto?
Lord Henry fungiert als Verführer und Mentor für Dorian Gray, ähnlich wie Mephistopheles Faust zu Grenzüberschreitungen verleitet.
Was unterscheidet Fausts Streben von dem Dorian Grays?
Faust strebt primär nach Erkenntnis und Wissen ("was die Welt im Innersten zusammenhält"), während Dorian Gray nach Genuss und ästhetischer Perfektion sucht.
Welche Parallele gibt es zwischen Basil Hallward und Goethes Gott?
Die Arbeit untersucht, ob Basil Hallward als Schöpfer des Bildes eine ähnliche Position wie die göttliche Instanz bei Goethe einnimmt.
Was wird unter "Dekadenz" im Zusammenhang mit Faust verstanden?
Es wird analysiert, inwieweit Fausts Handeln und sein Überdruss an der Wissenschaft Züge der literarischen Décadence aufweisen.
- Quote paper
- Natascha Alexandra Hass (Author), 2010, Faust als Dandy und Décadent, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199534