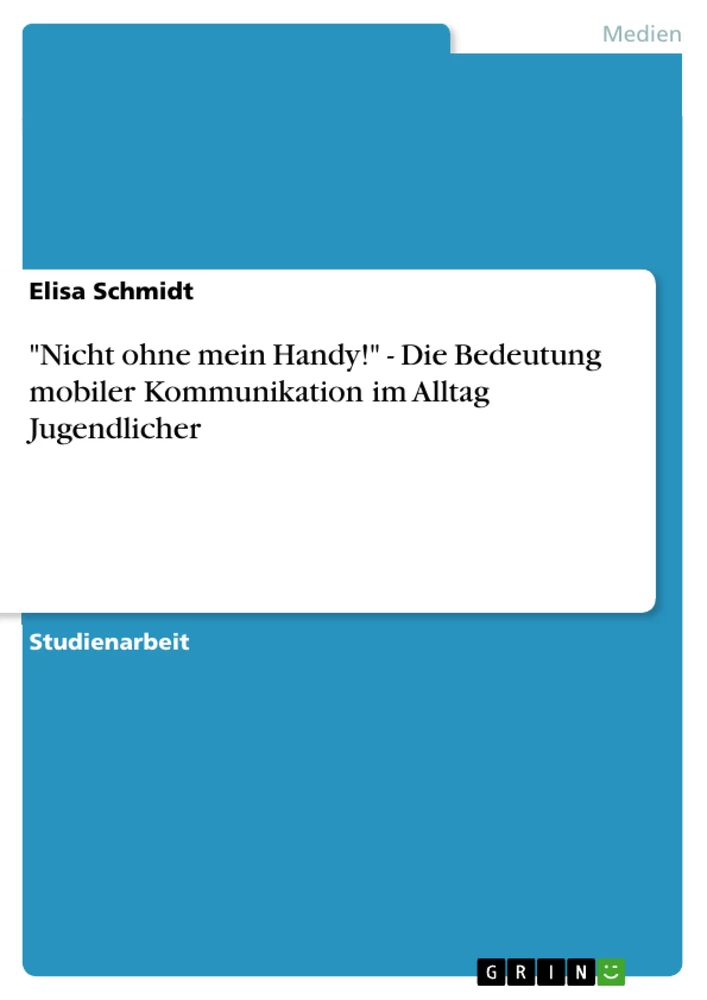„>Ohne Handy ist man unerreichbar und abgesehen vom Internet von der Zivilisation abgeschnitten.< (Ricarda:13 Jahre, Tagebuchprotokoll)“ (Schulz 2011, S.161)
Dieses Zitat von Ricarda stammt aus einer Langzeituntersuchung, in der Iren Schulz (2011) drei Jugendgruppen dazu brachte, eine Schul- und eine Ferienwoche ohne ihr Handy zu verbringen. Es untermalt den Titel der Hausarbeit „>Nicht ohne mein Handy!< - Die Bedeutung mobiler Kommunikation im Alltag Jugendlicher“ sehr gut und bringt zum Ausdruck, wie wichtig einer Jugendlichen ihr Mobiltelefon tatsächlich sein kann. Daher sollen in der folgenden Arbeit die unterschiedlichen Funktionen des Handys für die Jugendlichen herausgestellt werden.
Eine sehr wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Funktion des Handys, gerade für Jugendliche, stellt der „Short Message Service“ (kurz: SMS) dar. Dieser ermöglicht es, kurze Textnachrichten von einem Handy oder Computer zu einem anderen Handy zu schicken. Daher soll der zweite Teil der Arbeit den SMS näher beleuchten und dessen Besonderheiten erläutern. Dazu gehören die verschiedenen Nutzungsmotive der Jugendlichen, ebenso wie die benutze Sprache.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Handy und seine jugendlichen Nutzer
- Das Handy als ständiges Kontrollorgan
- Unbegrenzte Verfügbarkeit?
- Das Vertreiben von Einsamkeit und „Nahe Ferne“
- Das Handy als „pleasure phone“
- Zugehörigkeit
- Organisation
- Nutzungsmotive
- Kompetenzerwerb
- Der Short Message Service (SMS)
- Eigenschaften des SMS
- Die Sprache in der SMS-Kommunikation
- Funktionen der Kurzformen in SMS-Nachrichten
- Formen der veränderten Sprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bedeutung mobiler Kommunikation im Alltag Jugendlicher. Sie analysiert die verschiedenen Funktionen des Handys und beleuchtet insbesondere den Short Message Service (SMS) als eine zentrale Form der Kommunikation unter Jugendlichen.
- Das Handy als Kontrollorgan und Instrument der elterlichen Aufsicht
- Die Bedeutung von Erreichbarkeit und Verfügbarkeit im digitalen Zeitalter
- Die Rolle des Handys im Umgang mit Einsamkeit und der Konstruktion von Nähe und Distanz
- Der SMS als Kommunikationsmedium und seine Besonderheiten
- Die Sprachentwicklung und die Verwendung von Kurzformen in der SMS-Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Relevanz des Themas „>Nicht ohne mein Handy!< - Die Bedeutung mobiler Kommunikation im Alltag Jugendlicher\" dar und führt in die Thematik ein. Es zeigt, wie wichtig das Handy für Jugendliche geworden ist und wie es ihren Alltag prägt.
- Das Handy und seine jugendlichen Nutzer: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Funktionen des Handys im Alltag von Jugendlichen. Es wird erläutert, wie das Handy als ständiges Kontrollorgan, als Instrument der Erreichbarkeit, als Mittel zur Vermeidung von Einsamkeit und als „pleasure phone“ fungiert. Darüber hinaus werden die Aspekte der Zugehörigkeit und Organisation im Zusammenhang mit dem Handybesitz beleuchtet.
- Nutzungsmotive: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Motive, die Jugendliche für die Nutzung des Handys haben. Es wird auf den Kompetenzerwerb, der durch die Nutzung des Handys gefördert wird, und die Bedeutung des Short Message Service (SMS) eingegangen.
- Der Short Message Service (SMS): Dieses Kapitel widmet sich der Besonderheit der SMS-Kommunikation. Es werden die Eigenschaften der SMS, die Sprache in der SMS-Kommunikation, die Funktionen von Kurzformen und die Formen der veränderten Sprache analysiert.
Schlüsselwörter
Mobile Kommunikation, Jugendliche, Handy, Smartphone, SMS, Kurzformen, Sprache, Erreichbarkeit, Kontrolle, Einsamkeit, Zugehörigkeit, Organisation, Kompetenzerwerb.
- Quote paper
- Elisa Schmidt (Author), 2011, "Nicht ohne mein Handy!" - Die Bedeutung mobiler Kommunikation im Alltag Jugendlicher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199584