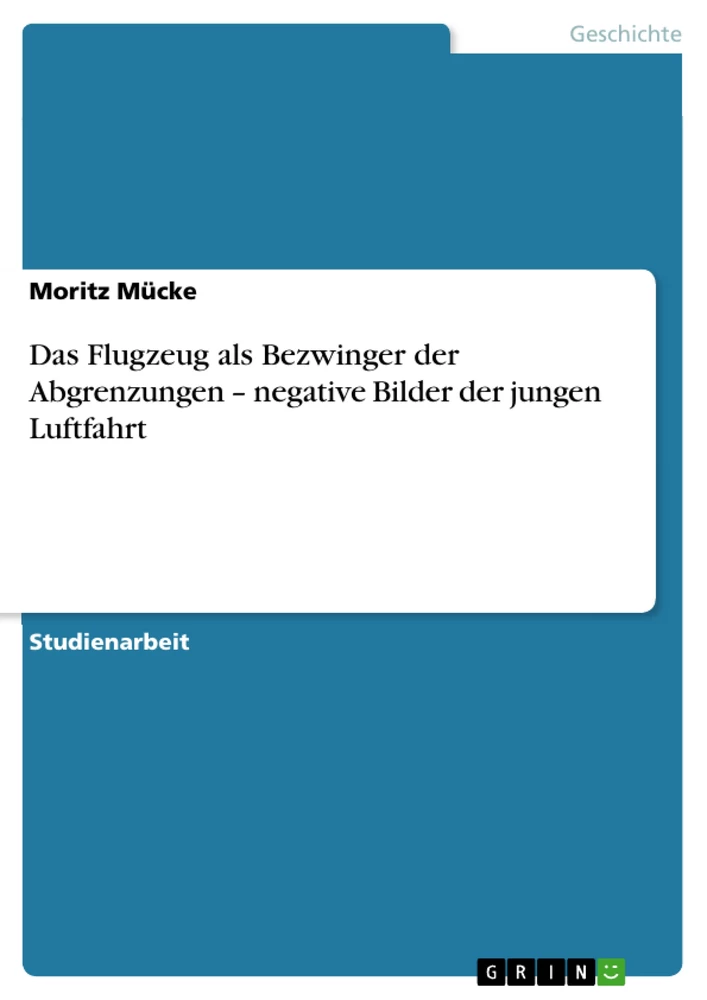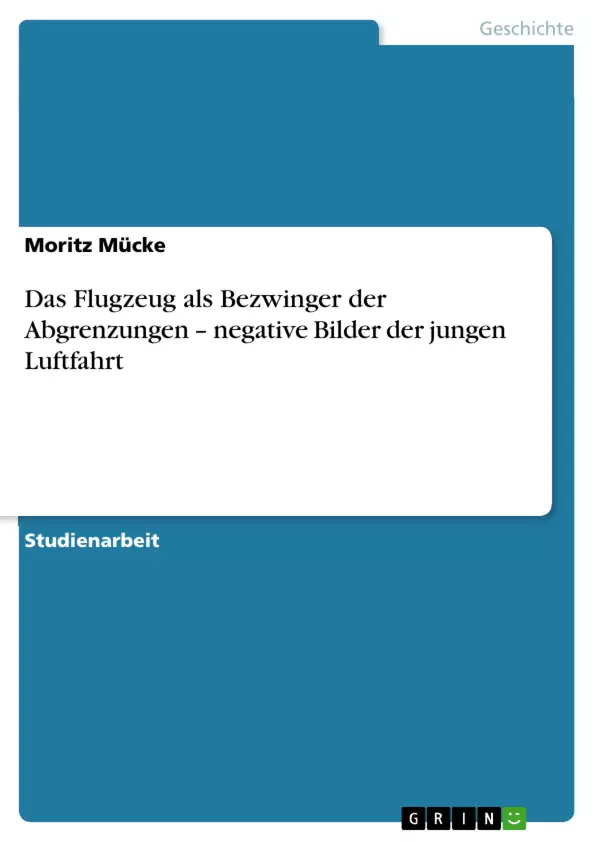Bereits in der griechischen Mythologie ist die „Doppelgesichtigkeit“ der Luftfahrt auf bemerkenswerte Weise in der Sage von Ikarus und Dädalus vorgezeichnet: zwar gelingt es den beiden, mit Flügeln aus Wachs die Fähigkeit des Fliegens technisch zu realisieren, doch Ikarus wird schnell übermütig und fliegt zu hoch empor, sodass die Sonne die Wachsflügel auf seinem Rücken zum Schmelzen bringt und er ins Meer stürzt und stirbt. Diese technologische Hybris begleitet die Menschheit auch nach der Erfindung des modernen Flugzeugs bis zum heutigen Tage. „Der Traum vom Fliegen,“ so Helmuth Trischler, „beruht, wie interkulturelle Vergleiche zeigen, auf einer anthropologischen Konstante: dem Streben nach der Entgrenzung, nach der Befreiung von der realen Raum-Zeit-Struktur. Ballon, Luftschiff und Flugzeug lieferten die technische Basis für die Verwirklichung des Traumes von Dädalus, dem irdischen Labyrinth durch die Luft zu entfliehen.“
Wie bei allen revolutionären technischen Neuerungen wurde auch die Erfindung des modernen motorisierten Flugzeugs durch die Gebrüder Wright und dessen darauffolgende stetige Weiterentwicklung – erst zur Attraktion, dann zur Kriegsmaschine und schließlich zum Massentransportmittel – nicht nur von Begeisterung und utopischen Hoffnungen begleitet, sondern auch von Skepsis und Schreckensszenarien. Kühne Erwartungen an das Flugzeug als Friedensbringer wurden spätestens mit dem Ersten Weltkrieg zunichte gemacht, während die Literatur der Zwischenkriegszeit, wie zu zeigen sein wird, oftmals apokalyptische Bilder einer fatalen Kombination aus Luft- und Gaskrieg, oder eines totalen Bombardements heraufbeschwor. Trotz der düsteren Farben, mit denen diese beiden Szenarien ausgemalt wurden, fand Ersteres im italienischen Abessinien-Krieg, und Letzteres im Bombenkrieg des Zweiten Weltkriegs eine gewisse Bestätigung. Gleichzeitig findet dabei eine Metamorphose des Fliegerhelden vom bürgerlich-individualistischen „Ritter der Lüfte“ zur im Dienste des faschistischen Kollektivs stehenden Verheißungsfigur statt.
In dieser Arbeit soll daher insbesondere nach den negativen Bildern gefragt werden, die von der jungen Luftfahrt evoziert wurden. Hierbei soll weniger die Ereignisgeschichte im Zentrum der Betrachtung stehen, als vielmehr die Wahrnehmung derselben durch die Zeitgenossen, die in Zeitungen, Literatur und Kunst ihre Erwartungen und Ängste äußerten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die junge Luftfahrt
- Aufbruch und Hoffnung
- Ängste und Schreckensszenarien
- Die Luftfahrt im Ersten Weltkrieg
- Der militärische Einsatz von Flugmaschinen
- Wahrnehmung und Kontrastierung
- Die Zwischenkriegszeit
- Kulturelle Konstruktion und literarische Verargumentierung
- Die Entgrenzung der Gewalt im Luftkrieg
- Aufbruch in die „mythische Moderne\" - Aviatik und Faschismus
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die negativen Bilder, die von der jungen Luftfahrt in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bis zur Zwischenkriegszeit evoziert wurden. Im Fokus steht dabei die Wahrnehmung und Reaktion der Zeitgenossen auf die neuen technischen Möglichkeiten und ihre Folgen. Die Arbeit untersucht die Ängste und Schreckensszenarien, die die Luftfahrt mit sich brachte, und beleuchtet dabei auch die politische und gesellschaftliche Einordnung der Luftfahrt in dieser Zeit.
- Die doppelte Natur der Luftfahrt: Hoffnung auf Fortschritt und Befreiung versus Angst vor Zerstörung und Entgrenzung
- Die Transformation des Flugzeugs von der Friedensbringer-Vision zur Kriegsmaschine
- Die Rolle der Literatur in der Vermittlung von Schreckensszenarien und der Konstruktion negativer Bilder
- Der Aufstieg des Fliegerhelden und seine politische Instrumentalisierung
- Die Entgrenzung des Raums durch die Luftfahrt als zentrales Thema der Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die doppelte Natur der Luftfahrt, indem sie die Sage von Ikarus und Dädalus als Metapher für die menschlichen Träume und Ängste im Zusammenhang mit dem Fliegen heranzieht. Außerdem wird die Entwicklung der Luftfahrt vom Traum von Frieden und Befreiung zur Kriegsmaschine skizziert.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der „jungen Luftfahrt“ und beleuchtet die anfänglichen Hoffnungen und Erwartungen, die mit der Erfindung des Flugzeugs verbunden waren. Neben der Hoffnung auf friedliche Anwendungen wird auch die Angst vor den möglichen Folgen der neuen Technologie thematisiert.
Kapitel drei untersucht den Einsatz der Luftfahrt im Ersten Weltkrieg. Der militärische Einsatz von Flugmaschinen und die damit einhergehende Veränderung der Kriegsführung werden dargestellt.
Das vierte Kapitel widmet sich der Zwischenkriegszeit. Hier werden die kulturelle Konstruktion der Luftfahrt in Literatur und Kunst, sowie die Entwicklung von Schreckensszenarien im Zusammenhang mit dem Luftkrieg untersucht.
Schlüsselwörter
Luftfahrt, Entgrenzung, Krieg, Frieden, Angst, Schreckensszenarien, Fliegerheld, Aviatik, Faschismus, Literatur, Wahrnehmung, Zeitgeschichte, Techno-Realismus, Moderne, Ikarus, Dädalus, Kriegsphilosophie, militärische Innovation, Luftkrieg, Abessinienkrieg, Zweiter Weltkrieg, Kulturelle Konstruktion, Zwischenkriegszeit, nationale Sicherheit, Raum-Zeit-Struktur.
Häufig gestellte Fragen
Welche "Doppelgesichtigkeit" wird der Luftfahrt zugeschrieben?
Die Luftfahrt wird einerseits als Erfüllung des Traums von Freiheit (Ikarus-Sage) und andererseits als zerstörerische Kriegsmaschine wahrgenommen.
Wie veränderte der Erste Weltkrieg das Bild des Flugzeugs?
Er machte kühne Erwartungen an das Flugzeug als Friedensbringer zunichte und etablierte es stattdessen als tödliche Waffe und Aufklärungsinstrument.
Was thematisiert die Literatur der Zwischenkriegszeit in Bezug auf die Aviatik?
Sie beschwor oft apokalyptische Szenarien herauf, wie die Kombination aus Luft- und Gaskrieg oder totale Bombardements von Städten.
Wie wandelte sich das Bild des Fliegerhelden?
Es fand eine Metamorphose vom individualistischen "Ritter der Lüfte" hin zur Verheißungsfigur im Dienste eines (oft faschistischen) Kollektivs statt.
Was bedeutet "Entgrenzung" im Zusammenhang mit der Luftfahrt?
Es beschreibt das Streben nach Befreiung von der realen Raum-Zeit-Struktur, birgt aber auch die Gefahr einer Entgrenzung der Gewalt im Krieg.
- Citation du texte
- Moritz Mücke (Auteur), 2012, Das Flugzeug als Bezwinger der Abgrenzungen – negative Bilder der jungen Luftfahrt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199628