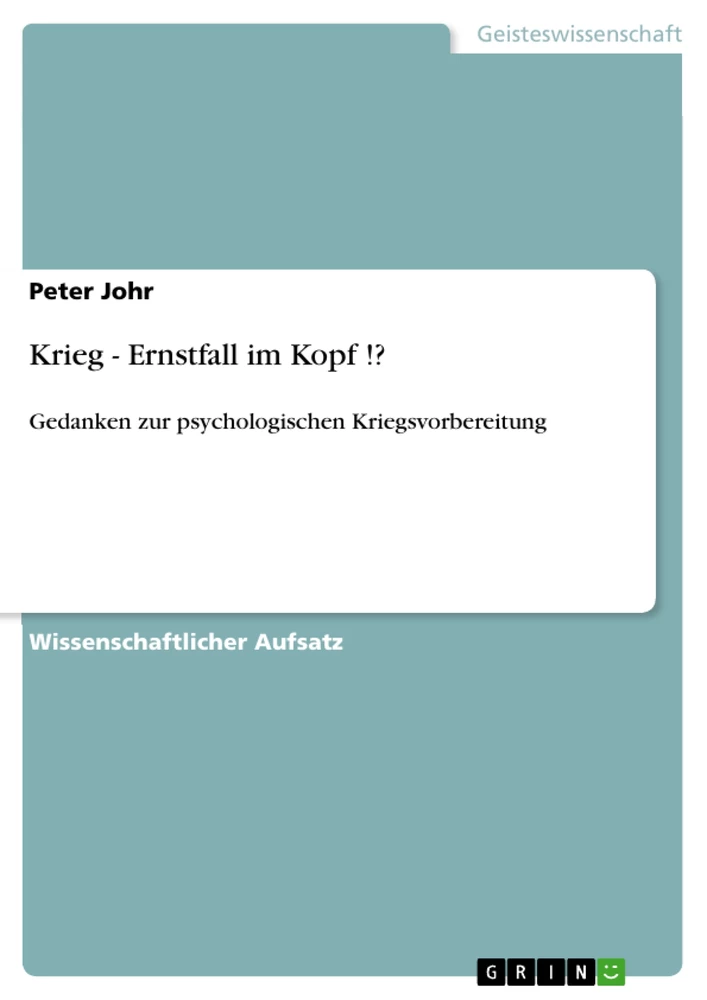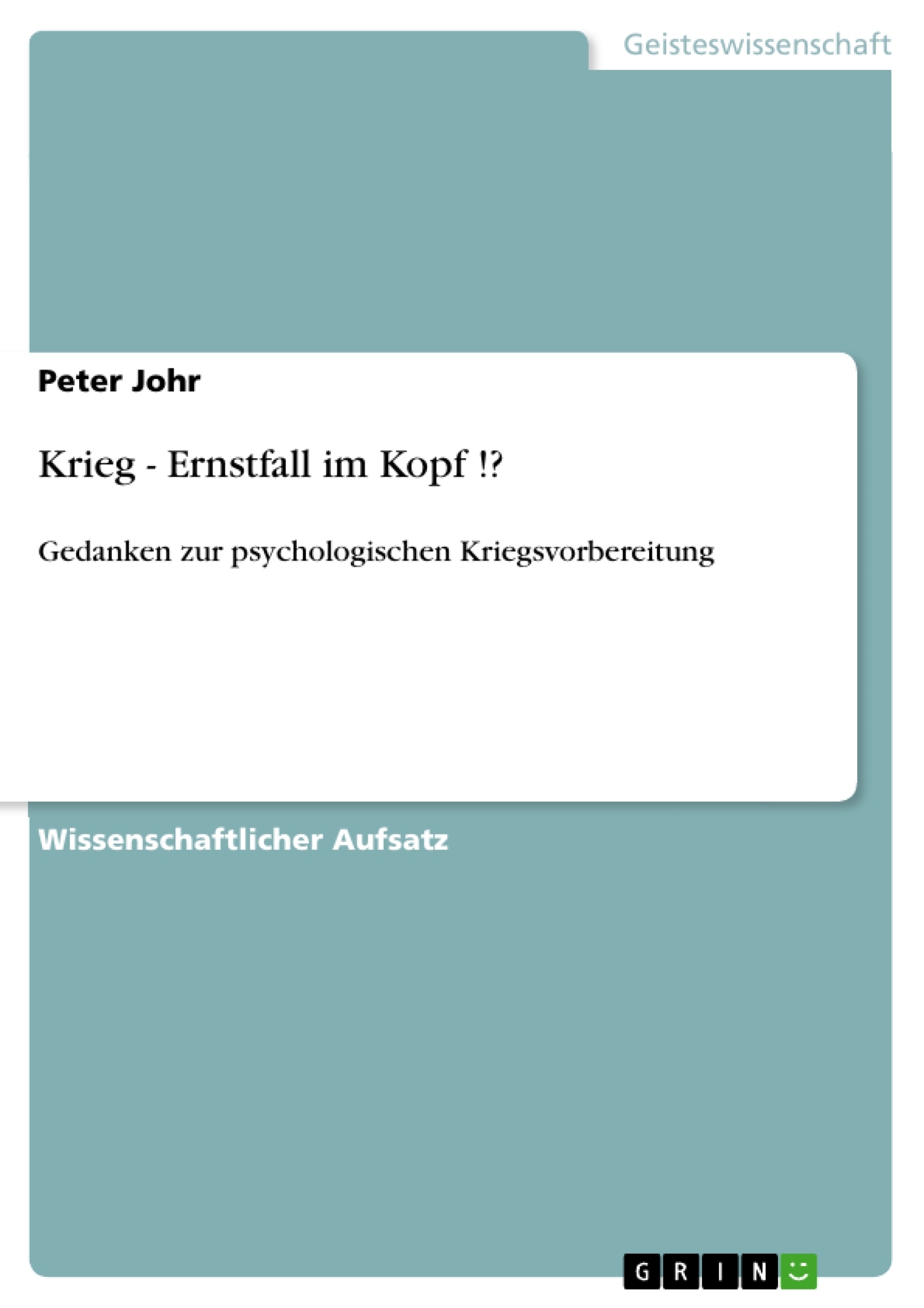Gedanken zur psychologischen Kriegsvorbereitung. Augenmerk des Autors liegt auf dem Posttraumatischen Belastungssyndrom (PTBS) bei Bundeswehrsoldaten. Die besorgniserregenden Meldungen und Berichte über psychische Folgen bei Soldaten der Bundeswehr nach Kampfeinsätzen gaben Anlass zu dieser Schrift. Eklatant sind öffentliche Informationen und Aussagen zum wehrpsychiatrischen und truppenpsychologischen Personalnotstand, die in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen werden. Prävention und Behandlung psychischer Erkrankungen von Kriegsteilnehmern - insbesondere die des PTBS - werden in ihrer augenfällig gewordenen Problematik betrachtet. Der Autor setzt sich mit den Belastungsereignissen von Gefechtssituationen und Kamphandlungen auseinander und führt psychopädagogische und psychotherepautische Konzepte zueinander. Auf deren Grundlage werden Möglichkeiten zur psychologischen Kriegsvorbereitung - immer mit Sicht auf das PTBS - skizziert.
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
1. Das Post Traumatische Belastungs Syndrom PTBS
2. Belastungsereignisse im Krieg Schlussfolgerungen
3. Bundeswehr und psychologische Kriegsvorbereitung
4. Psychologische Kriegsvorbereitung Resilienz und Vulnerabilität
5. Systematische Vorbereitung Sich vorbereitet fühlen
6. Methodische Aspekte Adaptation der Psyche Desensibilisieruung
7. Modifizierung der Verhaltenstherapie / Desensibilisierung Skizzierung
Nachbemerkung
Weiterführende Literatur
Zum Autor
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Arbeit „Krieg - Ernstfall im Kopf“?
Die Arbeit befasst sich mit der psychologischen Kriegsvorbereitung und konzentriert sich insbesondere auf das Posttraumatische Belastungssyndrom (PTBS) bei Bundeswehrsoldaten.
Welche Problematik wird im Bereich des Bundeswehr-Personals aufgezeigt?
Der Autor greift den eklatanten wehrpsychiatrischen und truppenpsychologischen Personalnotstand innerhalb der Bundeswehr auf.
Wie können psychische Erkrankungen bei Soldaten verhindert werden?
Die Schrift skizziert Möglichkeiten zur psychologischen Vorbereitung, die psychopädagogische und psychotherapeutische Konzepte verbinden, um die Resilienz zu stärken.
Was sind die zentralen Belastungsereignisse für Soldaten?
Dazu gehören Gefechtssituationen und Kampfhandlungen, die oft Auslöser für PTBS und andere psychische Folgen nach Kampfeinsätzen sind.
Welche methodischen Aspekte werden zur Vorbereitung vorgeschlagen?
Vorgeschlagen werden unter anderem die Adaptation der Psyche, systematische Desensibilisierung und die Modifizierung verhaltenstherapeutischer Ansätze.
- Citation du texte
- Dipl.-paed. Peter Johr (Auteur), 2012, Krieg - Ernstfall im Kopf !?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199734