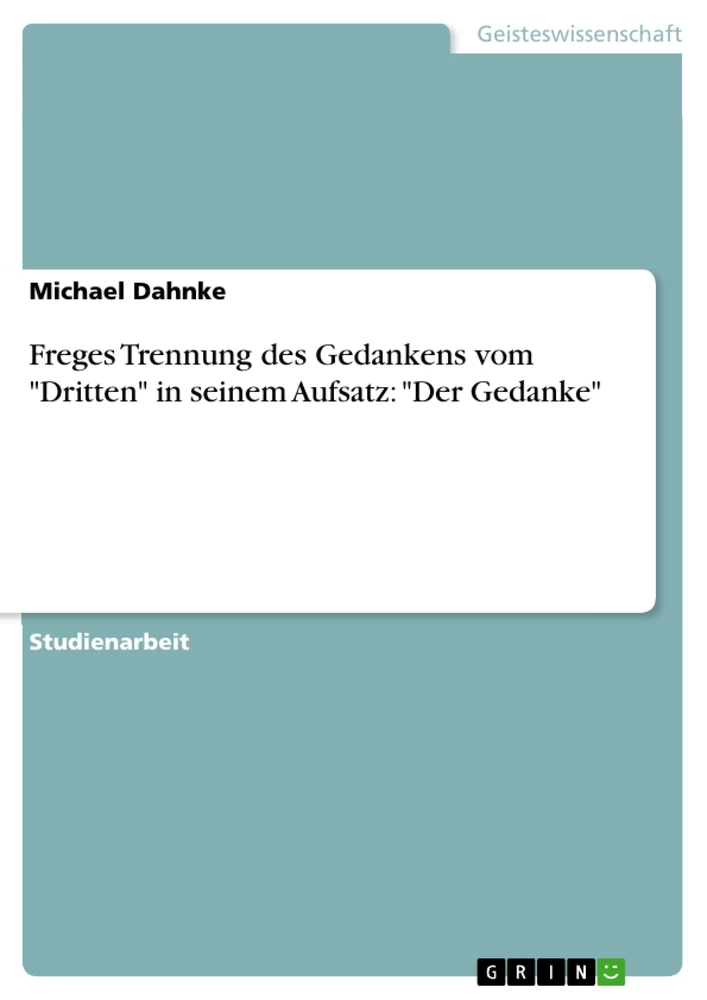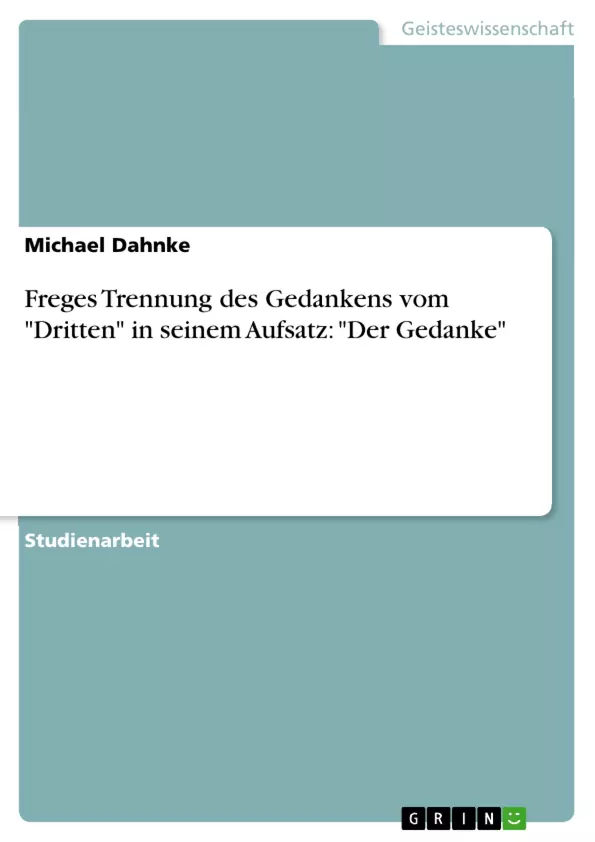Ich skizziere anhand dreier Abschnitte aus Freges Aufsatz »Der Gedanke. Eine Logische Untersuchung« (63,23–64,26) Freges Unterscheidung zwischen dem Inhalt einer Satzäußerung und dem in ihr ausgedrückten Gedanken und kritisiere die Unterscheidung anschließend.
Inhaltsverzeichnis
- Rekonstruktion
- »Behauptende Kraft« und »Gedanke«
- »Behauptende Kraft«
- »Gedanke«
- Das »Dritte«
- Negative Definition
- Skala . . .
- Praktische Beispiele.
- Appendix
- Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz untersucht Freges Konzeption des »Gedankens« und seine Unterscheidung zwischen dem Inhalt einer Satzäußerung und dem in ihr ausgedrückten Gedanken. Der Text analysiert Freges Argumentation anhand des Begriffs der »behauptende Kraft« und des »Dritten«, welches er als zusätzliche Elemente sprachlicher Äußerungen neben dem Gedanken identifiziert.
- Rekonstruktion von Freges Unterscheidung zwischen Gedanken und »Dritten«
- Analyse der »behauptende Kraft« als Ausdruck der Anerkennung der Wahrheit eines Gedankens
- Untersuchung des »Dritten« als nicht-behauptetes Element in sprachlichen Äußerungen
- Kritik an Freges Unterscheidung und ihren Implikationen
- Diskussion der Rolle des »Dritten« in verschiedenen Bereichen der Sprache, insbesondere in wissenschaftlichen und dichterischen Texten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Rekonstruktion
In diesem Kapitel wird Freges Definition des »Gedankens« als wahrheitswertfähiger Sinn eines Satzes rekonstruiert. Freges Unterscheidung zwischen »behauptende Kraft«, »Gedanke« und »Dritte« wird anhand der Form und des Inhalts sprachlicher Satzäußerungen erläutert. Der Abschnitt analysiert die Rolle der »behauptende Kraft« als formales Mittel zum Ausdruck der Anerkennung der Wahrheit eines Gedankens und die negative Definition des »Dritten« als nicht-behaupteter Teil einer Äußerung.
1.1 »Behauptende Kraft« und »Gedanke«
Freges Argumentation zur »behauptende Kraft« wird hier genauer betrachtet. Der Abschnitt analysiert die Rolle der »behauptende Kraft« als Mittel zur Anerkennung der Wahrheit eines Gedankens. Außerdem wird die Unterscheidung zwischen der »behauptende Kraft« und dem »Gedanke« selbst erläutert.
1.1.1 »Behauptende Kraft«
Der Text diskutiert die Funktion der »behauptende Kraft« in Bezug auf Behauptungssätze und ihre Rolle bei der Kundgabe von Wahrheitsansprüchen. Die Rolle der »behauptende Kraft« wird anhand von Beispielen illustriert, die verschiedene Formen der Behauptungssätze und ihre implizierten Wahrheitsansprüche aufzeigen.
1.1.2 »Gedanke«
Dieser Abschnitt fokussiert auf Freges Definition des »Gedankens« als wahrheitswertfähiger Sinn eines Satzes. Es wird diskutiert, wie der »Gedanke« als Teil des Satzes betrachtet wird, in dem die Wahrheit in Frage kommt.
1.2 Das »Dritte«
Der Text analysiert Freges Konzeption des »Dritten« anhand von drei zentralen Aspekten: die negative Definition des »Dritten« als nicht-behaupteter Teil einer Äußerung, die Skalierung des »Dritten« in verschiedenen Formen sprachlicher Äußerungen und die Diskussion von praktischen Beispielen, die das Auftreten des »Dritten« in Konnotationen, Andeutungen und Umformungen von Sätzen veranschaulichen.
1.2.1 Negative Definition
Die negative Definition des »Dritten« als das, worauf sich die Behauptung nicht erstreckt, wird im Detail analysiert. Der Text zeigt auf, dass das »Dritte« den Teil einer sprachlichen Äußerung umfasst, der nicht als wahr behauptet wird.
1.2.2 Skala
Der Abschnitt untersucht die Skala von »strenger« Wissenschaft bis zur Dichtung, um das unterschiedliche Auftreten des »Dritten« in verschiedenen Textformen zu illustrieren. Die Skala dient als Werkzeug, um das Ausmaß des »Dritten« in wissenschaftlichen und dichterischen Texten zu veranschaulichen.
1.2.3 Praktische Beispiele
Dieser Abschnitt gibt praktische Beispiele für das Auftreten des »Dritten« in sprachlichen Äußerungen, indem Konnotationen, Andeutungen und Umformungen von Sätzen im Detail betrachtet werden. Durch die Analyse dieser Beispiele werden die verschiedenen Funktionen des »Dritten« in der Sprache verdeutlicht.
1.2.4 Appendix
Dieser Abschnitt liefert zusätzliche Informationen und Anmerkungen zum Thema des »Dritten«. Der Text erweitert die Analyse durch die Bereitstellung von ergänzenden Informationen und Perspektiven auf das »Dritte« in der Sprache.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Gedanke, Behauptende Kraft, Dritte, Wahrheitswert, Satzäußerung, Sprache, Logik, Wissenschaft, Dichtung, Konnotation, Andeutung, Umformung, Übersetzung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Gottlob Frege unter einem „Gedanken“?
Für Frege ist ein Gedanke der wahrheitswertfähige Sinn eines Satzes, also das, was in einem Satz als wahr oder falsch in Frage kommt.
Was bezeichnet Frege als „behauptende Kraft“?
Die behauptende Kraft ist das formale Mittel, mit dem die Anerkennung der Wahrheit eines Gedankens in einer sprachlichen Äußerung ausgedrückt wird.
Was ist das „Dritte“ in Freges logischer Untersuchung?
Das „Dritte“ umfasst jene Teile einer Äußerung (wie Konnotationen oder Andeutungen), die nicht zum Gedanken gehören und auf die sich die behauptende Kraft nicht erstreckt.
Wie unterscheidet Frege zwischen Wissenschaft und Dichtung?
Frege nutzt eine Skala: In der strengen Wissenschaft wird das „Dritte“ minimiert, während es in der Dichtung eine zentrale Rolle spielt, da dort die Wahrheit oft nicht behauptet wird.
Welche Rolle spielen Konnotationen laut Frege?
Konnotationen gehören zum „Dritten“; sie färben den Gedanken ein, beeinflussen aber nicht dessen Wahrheitswert.
- Arbeit zitieren
- Magister Artium Michael Dahnke (Autor:in), 2004, Freges Trennung des Gedankens vom "Dritten" in seinem Aufsatz: "Der Gedanke", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199822