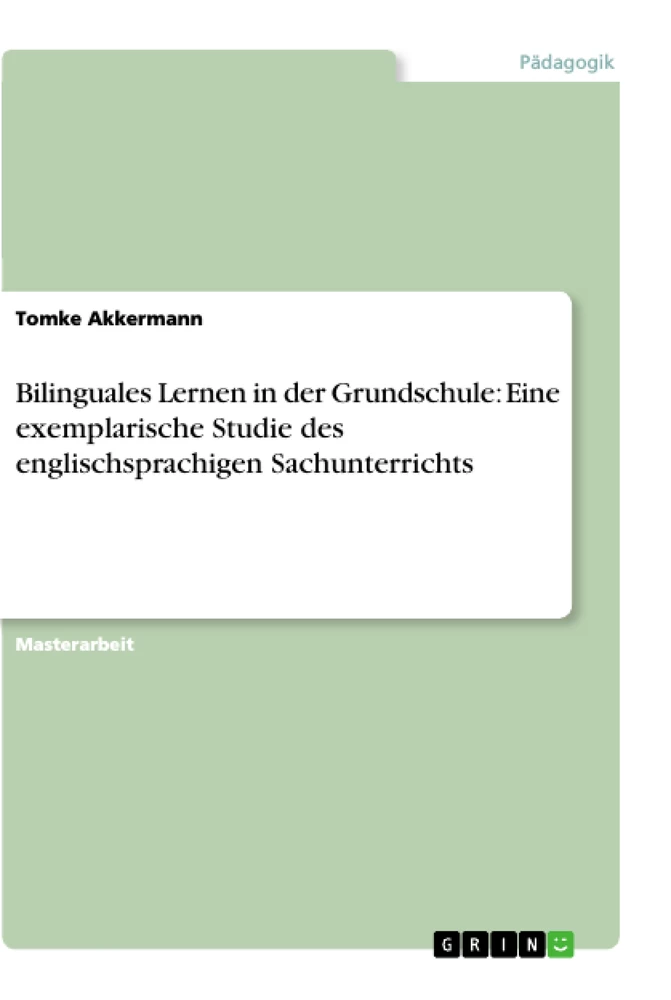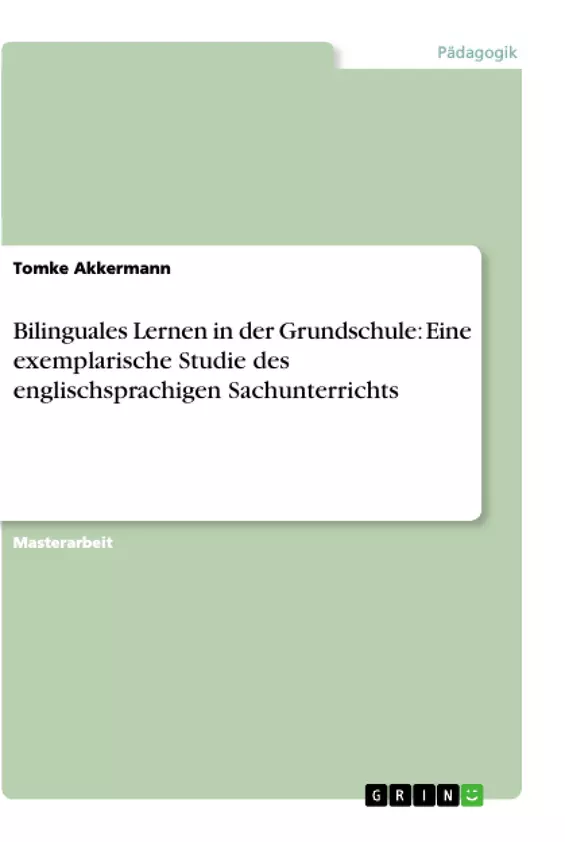Es scheint in den deutschen Schulen nichts Neues zu sein Sachfachinhalte auf einer anderen Sprache wie der Muttersprache zu vermitteln. Von Englisch über Französisch bis hin zu Türkisch finden sich allerlei Fremdsprachen, die in den Schulen Einzug gefunden haben, um über nichtsprachliche Sachgegenstände aufzuklären. Dabei ist es nicht verwunderlich, dass Englisch den Platz der beliebtesten Sprache für diese Art des Lernens und Lehrens einnimmt. Englisch ist die „Weltsprache“, die im integrativen Europa die Bürger zu mehrsprachigen Lernern verhelfen soll. Es gibt keinen Zweifel, dass Englisch auch in den Schulen als Fremdsprache ganz oben steht. Für den Einzelnen mag es vielleicht der Klang der Sprache sein, der reizvoll ist. Global betrachtet ist Englisch vor allem auch utilitaristisch, denn Berufe erfordern (gute) Englischkenntnisse. Aber warum ist es eigentlich die englische Sprache, die in den Grundschulen so einen Beliebtheitsgrad erlangt? Was bedeutet Englisch den Grundschülern? Können Sachinhalte auf diese Weise eventuell einfacher und nachhaltiger gelernt werden? In den öffentlichen Diskussionen stellen sich einige zunehmend gegen die traditionellen sogenannten „bilingualen Züge“1. Woher kommt das und welche Alternativen beziehungsweise Innovationen bieten sich an? Dass sich „bilinguale“ Ideen früher wie heute immer noch vermehrt in der Sekundarstufe finden lassen, sollte ebenfalls nicht verwundern. Aber auch Grundschulen und sogar vorschulische Einrichtungen befassen sich mit der Idee, fachliche Inhalte auf einer Fremdsprache zu behandeln. Doch sind „bilinguale“ Ideen überhaupt für Grundschüler2 geeignet? Wie müssen die Themen strukturiert sein, damit auch Kinder die Sachinhalte und die sprachlichen Bausteine nachvollziehen können?
Die Form der Module hat seit geraumer Zeit einen Platz in den deutschen Schulen gefunden. Ein einfacheres, unaufwendigeres System, heißt es gegenüber herkömmlicher „bilingualer“ Konzepte. Doch ist die modularisierte Form wirklich vorteilhaft und eignen sich Module überhaupt auf der englischen Sprache für die Grundschüler? Die Arbeit soll zeigen wie englischsprachige Module in der Primarstufe vorteilhaft umgesetzt werden könnten. Auf Fragen der Methodik, Inhalte, aber auch didaktischen Schwerpunkte soll eingegangen werden. Ziel dieser Arbeit ist es schließlich mit Hilfe theoretischer Grundlagen ein mögliches didaktisch-methodisches Konzept für englischsprachige Module in der Primarstufe zu erstellen...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 2.1. Definitionsspektrum
- 2.2. Modulare Ansätze
- 2.2.1. Geschichte
- 2.2.2. Formen und Merkmale
- 2.3. Module in den Bundesländern
- 2.4. Ziele und Kompetenzen modularisierter Bildung
- 2.5. Grundschule – Sekundarstufe
- 3. Didaktik
- 3.1. Die „unvollendete“ Theorie für Module
- 3.2. Implementierung englischsprachiger Module im Sachunterricht
- 4. Methodische Perspektiven
- 4.1. Thema „food“
- 4.2. Didaktisch-methodische Leitlinien
- 5. Evaluation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie englischsprachige Module im Sachunterricht der Grundschule sinnvoll eingesetzt werden können. Das Ziel ist es, ein didaktisch-methodisches Konzept für solche Module zu entwickeln und anhand des Beispiels „food“ eine modularisierte Unterrichtsreihe zu konzipieren.
- Die didaktische und methodische Integration von Sachthemen und Englischunterricht in Modulform
- Die Entwicklung eines theoretischen Fundaments für die Umsetzung englischsprachiger Module in der Grundschule
- Die praktische Evaluation einer modularisierten Unterrichtsreihe zum Thema „food“
- Die Berücksichtigung von Lernerautonomie und „rich input“ im Modulkontext
- Die Entwicklung eines didaktisch-methodischen Konzepts für die Grundschule
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt den aktuellen Forschungsstand zu bilingualen Ideen in der deutschen Schule vor und führt den Begriff „Modul“ als alternative Form des Sachfachunterrichts ein. Kapitel 2 betrachtet Module im Detail und analysiert verschiedene Formen und Merkmale sowie deren Verbreitung in den Bundesländern. Kapitel 3 befasst sich mit der didaktischen Fundierung von Modulen und geht auf die Problematik der „unvollendeten“ Theorie für Module ein. Kapitel 4 zeigt anhand des Beispiels „food“ wie methodische Perspektiven im englischsprachigen Modulunterricht der Grundschule aussehen könnten. Kapitel 5 evaluiert die im Rahmen der Arbeit entwickelte Modulreihe zum Thema „food“ und analysiert deren Wirkung auf die Schüler.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenfeld des bilingualen Sachfachunterrichts in der Grundschule, insbesondere mit der Konzeption und Implementierung von englischsprachigen Modulen. Im Fokus stehen Begriffe wie „CLIL“, „LAC“, „funktionaler Sprachgebrauch“, „Arbeitssprache“, „Lernerautonomie“ und „rich input“.
Häufig gestellte Fragen zum bilingualen Lernen in der Grundschule
Was ist das Ziel dieser Studie zum bilingualen Lernen?
Ziel ist die Entwicklung eines didaktisch-methodischen Konzepts für englischsprachige Module im Sachunterricht der Grundschule, um Sachinhalte und Sprache effektiv zu verknüpfen.
Warum ist Englisch die bevorzugte Sprache für diesen Unterricht?
Englisch gilt als Weltsprache und ist aufgrund seiner utilitaristischen Bedeutung für die berufliche Zukunft der Schüler die am häufigsten gewählte Fremdsprache in deutschen Schulen.
Was sind "modulare Ansätze" im bilingualen Sachunterricht?
Modulare Ansätze bieten ein flexibleres System gegenüber herkömmlichen bilingualen Zügen, bei dem fachliche Inhalte zeitlich begrenzt in einer Fremdsprache behandelt werden.
Sind bilinguale Konzepte bereits für Grundschüler geeignet?
Ja, die Arbeit untersucht, wie Themen strukturiert sein müssen, damit Kinder sowohl die Sachinhalte als auch die sprachlichen Bausteine erfolgreich nachvollziehen können.
Welches Thema dient als praktisches Beispiel für die Unterrichtsreihe?
In der Arbeit wird das Thema "food" (Essen) exemplarisch genutzt, um die methodischen Perspektiven und die Evaluation einer Modulreihe darzustellen.
Welche Rolle spielt die Lernerautonomie in diesem Konzept?
Die Förderung der Lernerautonomie und die Bereitstellung von "rich input" sind zentrale didaktische Schwerpunkte bei der Umsetzung der englischsprachigen Module.
- Quote paper
- Tomke Akkermann (Author), 2012, Bilinguales Lernen in der Grundschule: Eine exemplarische Studie des englischsprachigen Sachunterrichts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199835