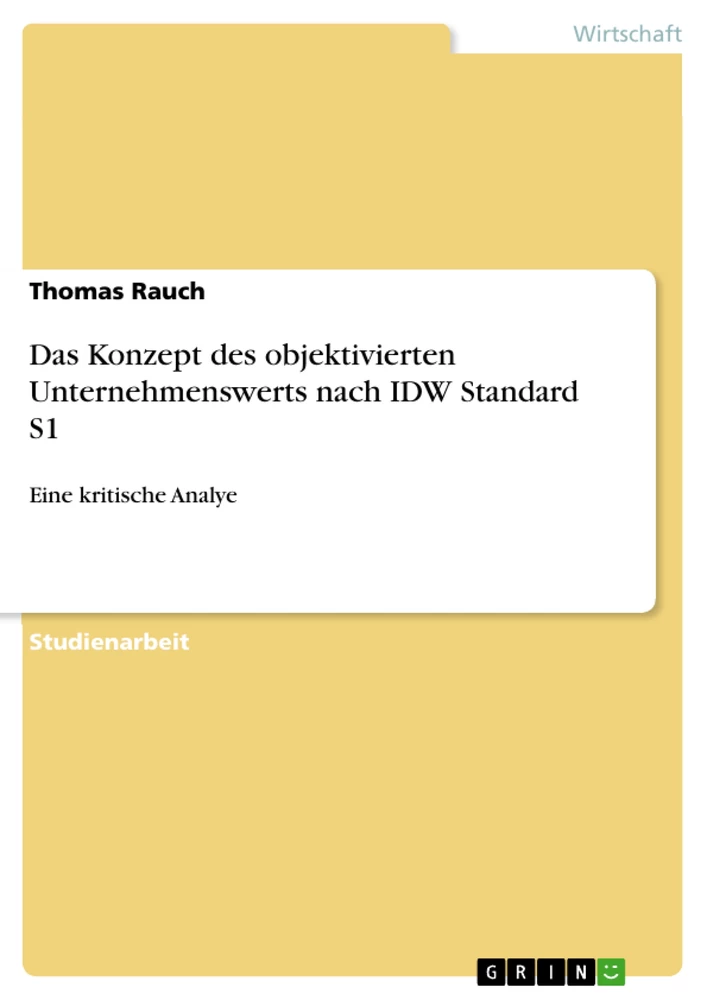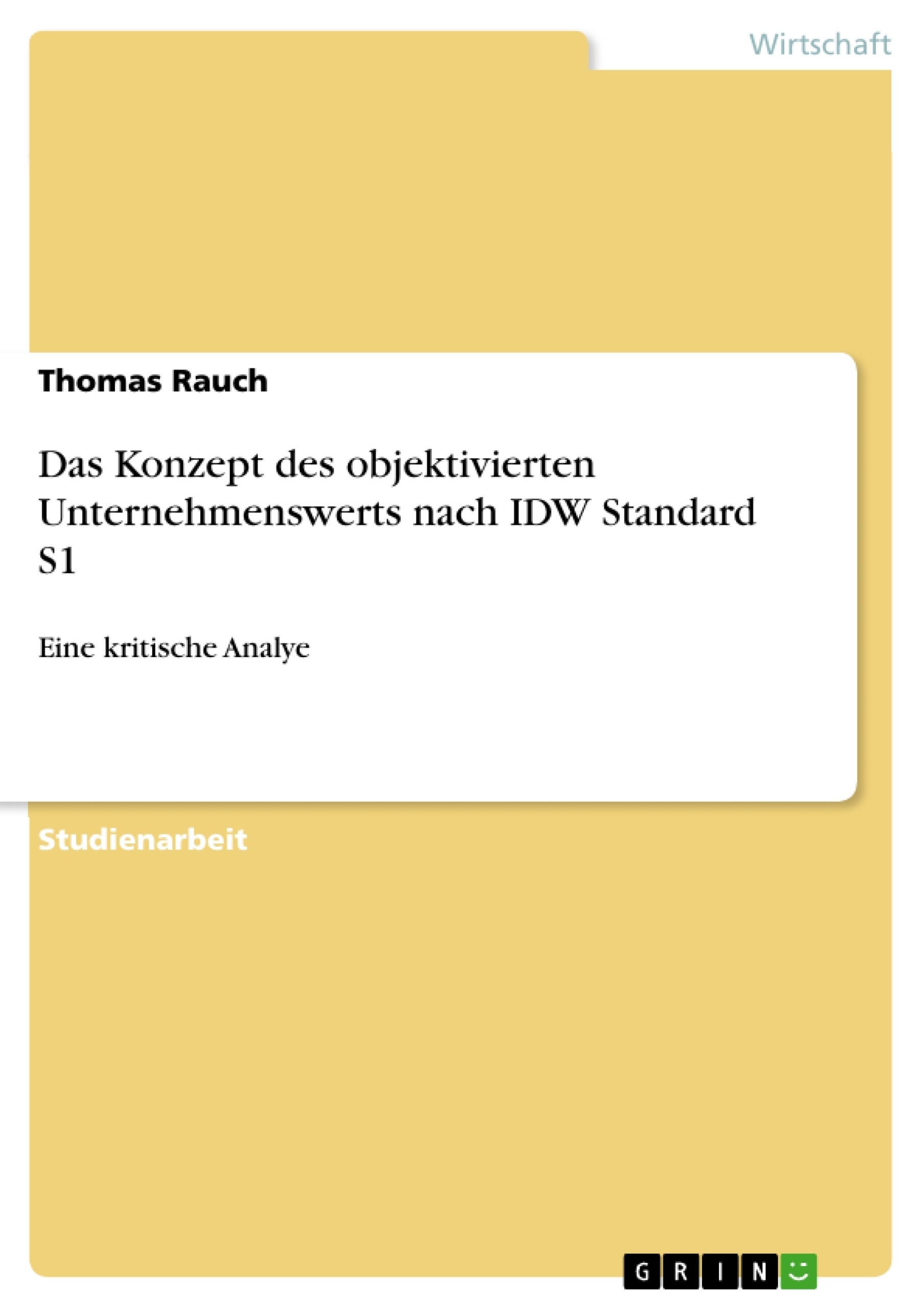Bei vielen betriebswirtschaftlichen Transaktionen ist heute eine Unternehmensbewertung zentraler Bestandteil. Hierbei gelingt es in der Disziplin Unternehmensbewertung eine Vielzahl von Einzeldisziplinen zu verbinden. Beispielsweise hat die Unternehmensbewertung in der Theorie und Praxis eine Vielzahl von Berührungspunkten zur klassischen Betriebswirtschaftslehre, Finanzierungs- und Investitionstheorie, sowie zur Steuerlehre. Hier ist es also nicht verwunderlich, dass der Wirtschaftsprüfer in seiner Funktion als Gutachter bei objektivierten Unternehmensbewertungen umfassendes und aktuelles Know-how in einem breiten Spektrum vorhalten muss. Der objektivierte Unternehmenswert soll einen normierten, intersubjektiven Unternehmenswert darstellen, der von Adressaten und Verfahrensbeteiligten des Bewertungsgutachtens nachprüfbar sein soll. Um dies zu gewährleisten hat das Institut der Wirtschaftsprüfer den IDW Standard S1 entwickelt an dem sich die Wirtschaftsprüfer bei der Erstellung eines objektivierten Unternehmenswerts orientieren. Diese Arbeit gibt einen Überblick über die Unternehmensbewertung nach den Vorstellungen des IDW Standard S1 um diese anschließend kritisch zu diskutieren.
Einleitend wird auf allgemein gültige Grundlagen der Unternehmensbewertung eingegangen. Hierbei wird der Begriff des Unternehmenswerts, das Zweckadäquanzprinzip, typische Bewertungsanlässe, sowie die Vorgehensweise bei der Unternehmensbewertung dargestellt. Im Kern der Arbeit werden die spezifischen Erfordernisse des Bewertungsstandards IDW S1 aufgezeigt. Im darauf folgenden Kapitel wird dieser Standard kritisch betrachtet und analysiert. Hierbei wird auf die Probleme des IDW S1 sowie die Anwendungsschwierigkeiten in der Praxis eingegangen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit zur objektivierten Unternehmensbewertung nach IDW Standard S1.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einführung
1.1 Problemstellung der Arbeit
1.2 Vorgehensweise der Untersuchung
2 Grundlagen der Unternehmensbewertung
2.1 Begriff des Unternehmenswerts
2.2 Zweckadäquanzprinzip und Funktionslehre
2.3 Anlässe zur Ermittlung eines objektivierten Unternehmenswerts
2.4 Vorgehensweise der Unternehmensbewertung
2.4.1 Der Bewertungsauftrag
2.4.2 Die Vergangenheitsanalyse
2.4.3 Die Ertragsprognose
2.4.4 Bestimmung Diskontierungssatz
3 Der objektivierte Unternehmenswert nach IDW Standard S1
3.1 Der Ansatz des IDW
3.2 Die Unternehmensbewertung nach IDW Standard S1
3.2.1 Wichtige Grundsätze nach IDW Standard S1
3.2.2 Bewertungsverfahren
3.2.3 Berücksichtigung von Steuern
3.2.4 Der Kapitalisierungszinssatz nach IDW
4 Kritische Betrachtung des IDW S1
4.1 Probleme bei der Unternehmensbewertung nach IDW S1
4.2 Theorie versus Praxis
5 Fazit
Literatur- und Quellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist der IDW Standard S1?
Es ist ein vom Institut der Wirtschaftsprüfer entwickelter Standard, der Grundsätze für die Durchführung von Unternehmensbewertungen festlegt, um einen objektivierten Unternehmenswert zu ermitteln.
Was versteht man unter einem objektivierten Unternehmenswert?
Ein normierter, intersubjektiv nachprüfbarer Wert, der unabhängig von individuellen Vorstellungen einzelner Parteien durch einen neutralen Gutachter ermittelt wird.
Welche Schritte umfasst die Unternehmensbewertung nach IDW S1?
Dazu gehören der Bewertungsauftrag, eine detaillierte Vergangenheitsanalyse, die Ertragsprognose und die Bestimmung des angemessenen Diskontierungssatzes.
Wie wird der Kapitalisierungszinssatz bestimmt?
Der Zinssatz wird nach spezifischen Vorgaben des IDW ermittelt, um das Risiko und die Zeitpräferenz des Kapitals adäquat abzubilden.
Welche Kritik gibt es am IDW S1?
Kritikpunkte betreffen oft die Diskrepanz zwischen theoretischen Anforderungen und der praktischen Umsetzbarkeit sowie Probleme bei der Berücksichtigung von Steuern.
- Quote paper
- Thomas Rauch (Author), 2011, Das Konzept des objektivierten Unternehmenswerts nach IDW Standard S1, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200056