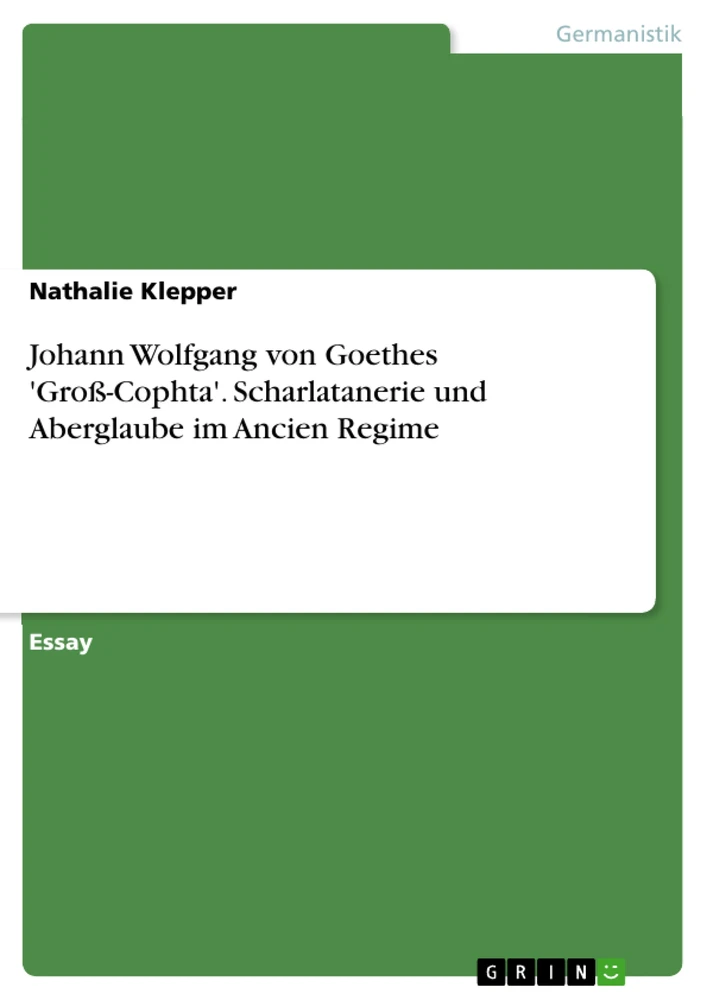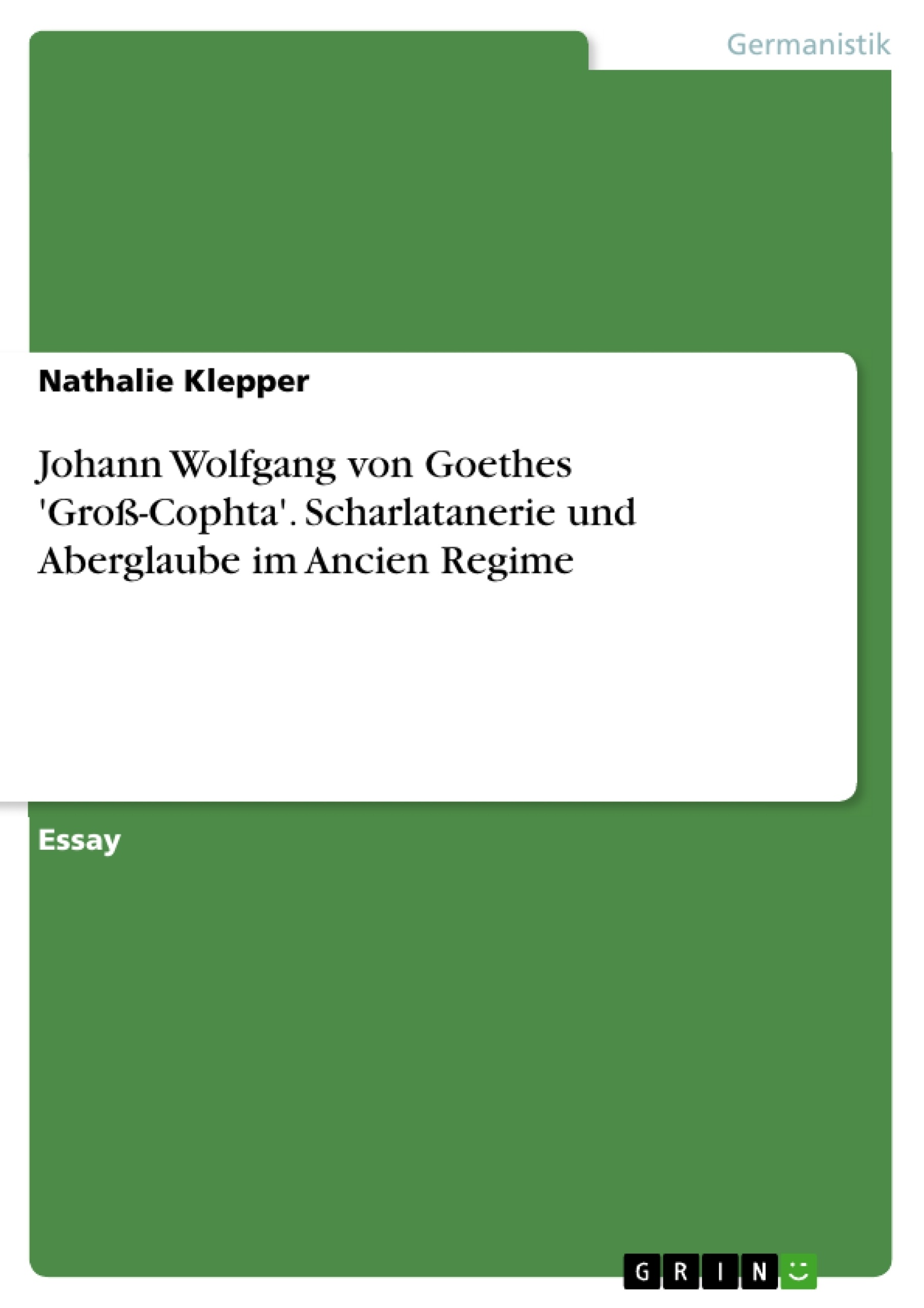"Der Groß-Cophta" (1791) ist nach "Das römische Karneval" (1788) Goethes erste poetische Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution, diesem für den Dichter äußerst erschütternden Ereignis. Für das Lustspiel "Der Groß-Cophta", das in der Goethe-Forschung oft – zu unrecht – als „verfehlt“ bezeichnet wird, verband der Dichter kunstvoll zwei seiner größten Abneigungen: einerseits gegen die Revolution und andererseits gegen den Alchemisten und Hochstapler Cagliostro, der zwar an der Revolution nicht unmittelbar beteiligt war, Goethe jedoch als Symptom einer Zeit des moralischen Verfalls der Gesellschaft und als Menetekel für den Untergang des Ancien Regime, und damit der alten Welt, galt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der historische Cagliostro, die Halsbandaffäre und die Französische Revolution
- Goethes Groß-Cophta als literarische Verarbeitung einer „famosen Hexen-Epoche“
- Der Zauber des Cagliostro
- Cagliostro als Verneinung der Aufklärung
- Dekadenz der Gesellschaft und Anfälligkeit für Scharlatanerie
- Die politische Dimension der Unvernunft
- Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Goethes Komödie Der Groß-Cophta (1791) im Kontext der Französischen Revolution und untersucht die Rolle des Scharlatans Cagliostro als Symptom für den moralischen Verfall des Ancien Regime. Die Arbeit befasst sich mit Cagliostros historischen Aktionen, der Halsbandaffäre und ihrer Bedeutung für den gesellschaftlichen und politischen Umbruch in Frankreich.
- Goethes Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution und seine Kritik am Ancien Regime
- Cagliostro als Symbol für die Dekadenz der Gesellschaft und die Anfälligkeit für Aberglaube und Irrationalität
- Die politische Dimension der Unvernunft und die Rolle des Aberglaubens im Vorfeld der Französischen Revolution
- Die Darstellung von Cagliostro in Goethes Groß-Cophta und seine Bedeutung für die Entwicklung des Stückes
- Goethes literarische Verarbeitung historischer Ereignisse und die Aktualität seines Werkes im Kontext der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt Goethes Groß-Cophta als literarische Verarbeitung der Französischen Revolution vor und erläutert die besondere Bedeutung der Figur Cagliostro in Goethes Werk. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Cagliostro als Symptom für den moralischen Verfall des Ancien Regime und die Anfälligkeit der Gesellschaft für Scharlatanerie und Aberglaube.
- Der historische Cagliostro, die Halsbandaffäre und die Französische Revolution: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Ereignisse rund um Cagliostro und die Halsbandaffäre, die als Katalysator für die Französische Revolution gelten. Es wird die Rolle von Cagliostro als charismatischer Hochstapler und die Ambivalenz seiner Persönlichkeit zwischen Faszination und Verachtung dargestellt. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung von Cagliostros Manipulationen und Betrügereien für die Schwächung des Ancien Regime und die Entstehung revolutionärer Stimmung.
- Goethes Groß-Cophta als literarische Verarbeitung einer „famosen Hexen-Epoche“: Dieses Kapitel analysiert Goethes Groß-Cophta als literarische Verarbeitung der Zeit des Aberglaubens und der Scharlatanerie. Es werden die verschiedenen Facetten der Darstellung Cagliostros und seine Rolle in der Komödie beleuchtet. Die Analyse konzentriert sich auf Goethes Kritik an der Dekadenz der Gesellschaft, der Anfälligkeit für Irrationalität und die politischen Implikationen dieser Phänomene.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des Aberglaubens, der Scharlatanerie und der Dekadenz der Gesellschaft im Kontext der Französischen Revolution. Die Analyse von Goethes Groß-Cophta stellt Cagliostro als Schlüsselfigur dar, der die Verfallserscheinungen des Ancien Regime symbolisiert. Weitere wichtige Begriffe sind: Aufklärung, Irrationalität, politische Unvernunft, Halsbandaffäre, Gesellschaftliche Krisen, Umbruch und Historische Ereignisse.
- Citar trabajo
- Nathalie Klepper (Autor), 2008, Johann Wolfgang von Goethes 'Groß-Cophta'. Scharlatanerie und Aberglaube im Ancien Regime, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200057