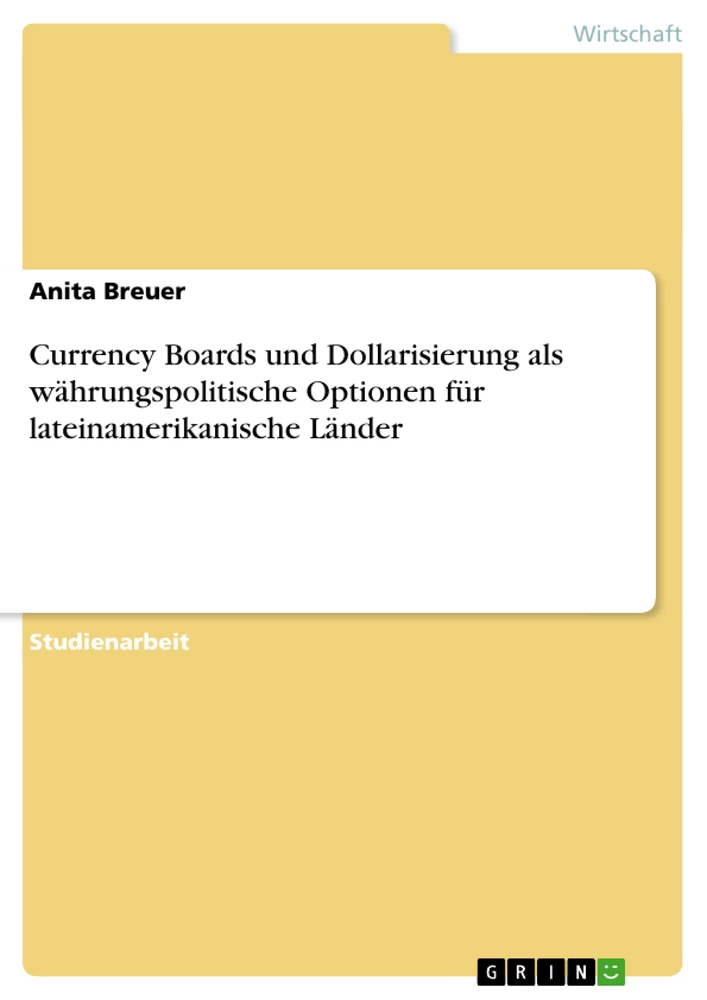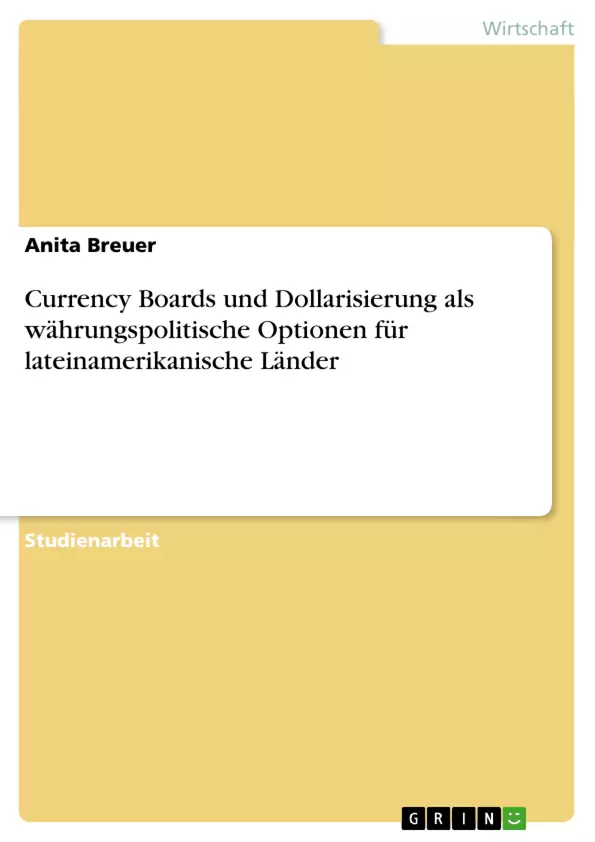Für die nationale Geldpolitik eines Landes ist die Wechselkursfrage von entscheidender
Bedeutung. Zur Auswahl stehen eine Fülle unterschiedlicher Wechselkurssysteme, die zur
besseren Übersicht grob in drei Kategorien eingeteilt werden können:
Zur ersten Kategorie gehören die, sehr seltene, Form der freien Wechselkursbildung
(independent float) und die kontrollierte Wechselkursbildung (managed float). Die zweite
Kategorie wird als die der sog. soft pegs bezeichnet. Zu diesen gehören feste Wechselkurse
mit variabler Parität, feste Wechselkurse mit Gleitparität (crawling pegs) und verschiebbare
Festkurse (adjustable pegs). Zur dritten Kategorie der extremen Wechselkurssysteme, den
sog. hard pegs, schließlich zählen stark gebundene Wechselkurse, Currency boards oder
Ökonomien, die über keine eigene Währung verfügen.1 Im Verlauf der größeren
Kapitalmarkt-Krisen seit 1994 hat sich gezeigt, daß Länder, die der zweiten Kategorie
angehörten, von diesen Krisen in besonderem Ausmaß betroffen waren (In Lateinamerika gilt
dies besonders für Mexiko 1994 und Brasilien 1998). Diese Entwicklung löste einen
Polarisierungstrend aus, in dessen Verlauf immer mehr Länder sich von der Mitte entfernten
und entweder für das freie floaten oder aber für die extremen Wechselkurssysteme optierten.2
Diese Tendenz hat der Debatte um die Dollarisierung der lateinamerikanischen Länder
neuen Stoff gegeben.
Der Dollar hat als Leitwährung in Lateinamerika lange Tradition. Die Überweisungen der in
den USA arbeitenden Migranten in ihre Heimatländer, die sog. remesas, belaufen sich nach
offiziellen Angaben auf 8 Milliarden US-Dollar jährlich3 und haben zu einer Zirkulation des
Dollars in breiten Bevölkerungsschichten beigetragen. Die Maßnahmen, die von
lateinamerikanischen Regierungen zur Institutionalisierung des Umgangs mit der
Leitwährung ergriffen wurden, sind unterschiedlich: Während Ecuador im März 2000 den
Dollar als Währung einführte und auch El Salvador im Januar 2001 den Dollar als
gesetzliches Zahlungsmittel legalisierte, optierte Argentinien 1991 für die weniger radikale
Lösung einer Kopplung des Peso an den Dollar im Verhältnis 1:1 durch Einsetzung eines
Currency Boards. Mexiko und Chile wiederum kombinieren Inflationsbekämpfung mit
flexiblen Wechselkursen. [...]
1 vgl. Fischer 2001, S. 2, sowie Dornbusch 2001, S. 15 und Issing 1996, S.233
2 vgl. Fischer 2001, S.2
3 vgl. Lowell und de la Garza, 2000, S. 1
Inhaltsverzeichnis
- 0. Hard pegs als währungspolitische Option für Lateinamerika
- I. Dollarisierung und Currency Board: terminologische Definition
- II. Die Chancen der hard pegs
- II.1 Möglichkeiten der Inflationsbekämpfung
- II.2 Zuwachs an Glaubwürdigkeit
- II.3 Stabilität und Integration
- III. Die Risiken der hard pegs
- III.1 Verlust des Seignorage-Profits durch Dollarisierung
- III.2 Abwesenheit des „Lender of Last Resort“
- III.3 Verlust der währungspolitischen Autonomie und Ausstiegs-Option durch Dollarisierung
- III.4 Das Fallbeispiel Argentinien: regionale Desintegration durch starre Wechselkursfixierung
- IV. Currency Boards als Transitionslösung auf dem Weg zu einer lateinamerikanischen Währungsunion?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse der Wechselkursregelungen für Lateinamerika, insbesondere mit der Kategorie der hard pegs. Die Arbeit stellt die Dollarisierung der ihr am nächsten gelegenen Alternative, dem Currency Board, vergleichend gegenüber und analysiert die jeweiligen Vorzüge sowie Kosten und Risiken beider Optionen. Ziel ist es, die Bedeutung der Wechselkursfrage für die nationale Geldpolitik eines Landes aufzuzeigen und die verschiedenen Möglichkeiten der Wechselkursfixierung in den Kontext der Entwicklungen in Lateinamerika zu stellen.
- Die Rolle von hard pegs in der Geldpolitik Lateinamerikas
- Vorteile und Nachteile der Dollarisierung und des Currency Boards
- Die Risiken von starren Wechselkursfixierungen
- Das Beispiel Argentinien: regionale Desintegration durch starre Wechselkursfixierung
- Currency Boards als Transitionslösung auf dem Weg zu einer lateinamerikanischen Währungsunion
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert die Begriffe Dollarisierung und Currency Board und erläutert die unterschiedlichen Formen der Dollarisierung. Im zweiten Kapitel werden die Chancen der hard pegs, insbesondere die Möglichkeiten der Inflationsbekämpfung, der Zuwachs an Glaubwürdigkeit und die Vorteile für Stabilität und Integration, beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich den Risiken von hard pegs, die u.a. den Verlust des Seignorage-Profits durch Dollarisierung, die Abwesenheit eines „Lender of Last Resort“, den Verlust der währungspolitischen Autonomie und das Beispiel Argentinien als Fallbeispiel für regionale Desintegration durch starre Wechselkursfixierung beinhalten. Das vierte Kapitel behandelt die Frage, ob Currency Boards als Transitionslösung auf dem Weg zu einer lateinamerikanischen Währungsunion dienen können.
Schlüsselwörter
Hard pegs, Dollarisierung, Currency Board, Lateinamerika, Wechselkurspolitik, Inflationsbekämpfung, Glaubwürdigkeit, Stabilität, Integration, Risiken, Seignorage-Profit, „Lender of Last Resort“, Autonomie, Argentinien, regionale Desintegration, Währungsunion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Dollarisierung und einem Currency Board?
Bei der Dollarisierung wird der US-Dollar als offizielle Währung übernommen, während ein Currency Board die eigene Währung fest an den Dollar koppelt und durch Reserven deckt.
Welche Vorteile bieten "Hard Pegs" für lateinamerikanische Länder?
Sie dienen primär der Inflationsbekämpfung, erhöhen die geldpolitische Glaubwürdigkeit und fördern die wirtschaftliche Stabilität und Integration.
Was sind die Risiken einer vollständigen Dollarisierung?
Zu den Risiken gehören der Verlust der währungspolitischen Autonomie, der Wegfall des Seignorage-Profits und das Fehlen eines "Lender of Last Resort".
Warum scheiterte das Currency Board in Argentinien?
Die starre Bindung führte zu regionaler Desintegration und wirtschaftlicher Unflexibilität, was letztlich in einer schweren Krise endete.
Können Currency Boards eine Vorstufe zu einer Währungsunion sein?
Die Arbeit diskutiert sie als mögliche Transitionslösung, um Volkswirtschaften auf dem Weg zu einer gemeinsamen lateinamerikanischen Währung zu stabilisieren.
- Quote paper
- Anita Breuer (Author), 2001, Currency Boards und Dollarisierung als währungspolitische Optionen für lateinamerikanische Länder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20008