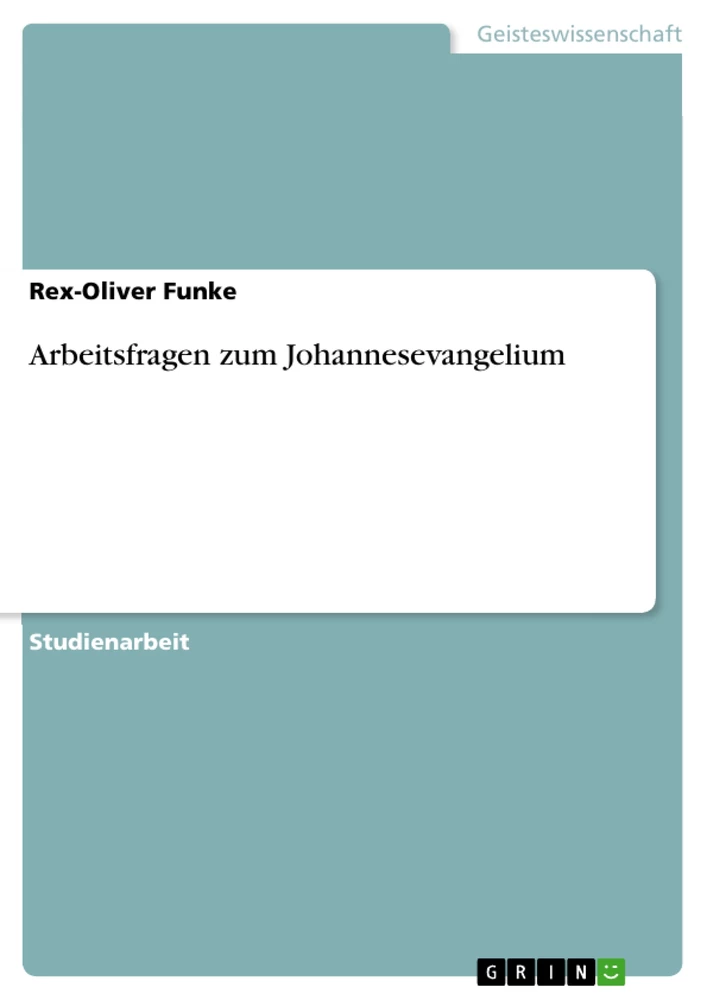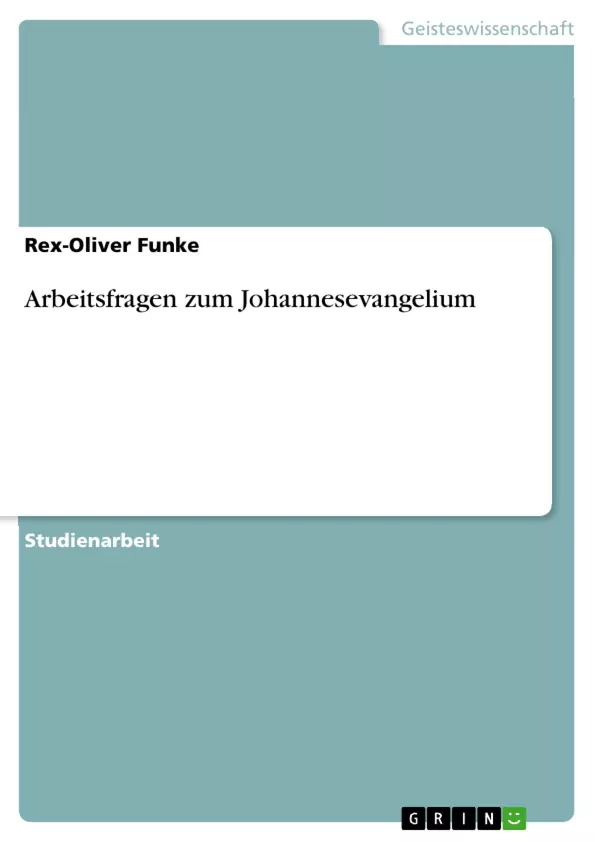1. Was wird im Prolog des Johannesevangeliums mit Hilfe des Logos-Titels ausgesagt?
2. Worin unterscheiden sich die Jüngerberufungen bei Johannes von denen bei den Synoptikern (vgl. dazu Joh 1,35-51, Mk 1, 16-20 parr; Mk 2, 13-17 parr) und was kommt darin für das johanneische Jüngerverhältnis zum Ausdruck?
3. Im Johannesevangelium kommt mehrfach ein „Jünger, den Jesus lieb hatte“ vor (vgl. Joh 13,23; 19,26; 20,2; 21,7.20). Was unterscheidet ihn von den anderen Jüngern?
4. Welche Beziehungen bestehen zwischen Zeichen und Reden Jesu? Erläutern Sie das am Beispiel der Blindenheilung (Kap.9) und der Lichtrede (Kap. 8,12-20).
5. Was ist im Johannesevangelium mit der Rede von der Erhöhung Jesu gemeint (Joh 3,14; 8,28; 12,32-34)? Wie schlägt sich das in der johanneischen Passionsdarstellung nieder?
6. Welche Funktion hat der Tröster für Gemeinde nach Joh 14-16? In welcher Weise ist nach Johannes der auferstandene Christus in seiner Gemeinde gegenwärtig?
Inhaltsverzeichnis
1. Was wird im Prolog des Johannesevangeliums mit Hilfe des Logos-Titels ausgesagt?
2. Worin unterscheiden sich die Jüngerberufungen bei Johannes von denen bei den Synoptikern (vgl. dazu Joh 1,35-51, Mk 1, 16-20 parr; Mk 2, 13-17 parr) und was kommt darin für das johanneische Jüngerverhältnis zum Ausdruck?
3. Im Johannesevangelium kommt mehrfach ein „Jünger, den Jesus lieb hatte“ vor (vgl. Joh 13,23; 19,26; 20,2; 21,7.20). Was unterscheidet ihn von den anderen Jüngern?
4. Welche Beziehungen bestehen zwischen Zeichen und Reden Jesu? Erläutern Sie das am Beispiel der Blindenheilung (Kap.9) und der Lichtrede (Kap. 8,12-20).
5. Was ist im Johannesevangelium mit der Rede von der Erhöhung Jesu gemeint (Joh 3,14; 8,28; 12,32-34)? Wie schlägt sich das in der johanneischen Passionsdarstellung nieder?
6. Welche Funktion hat der Tröster für Gemeinde nach Joh 14-16? In welcher Weise ist nach Johannes der auferstandene Christus in seiner Gemeinde gegenwärtig?
Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Dr. Rex-Oliver Funke (Author), 2012, Arbeitsfragen zum Johannesevangelium, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200088