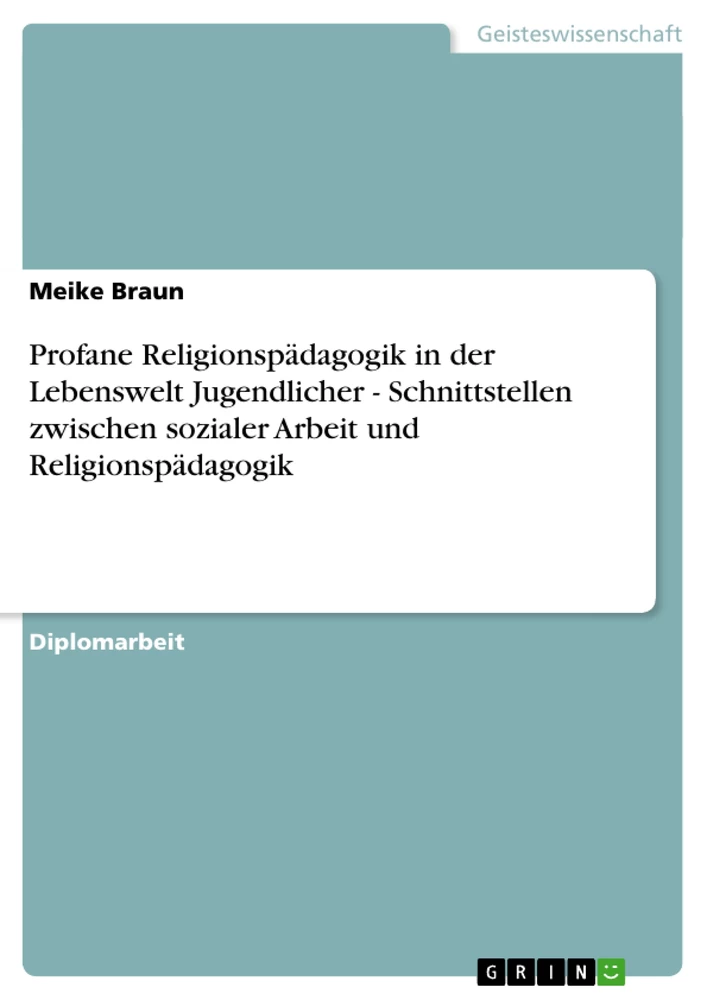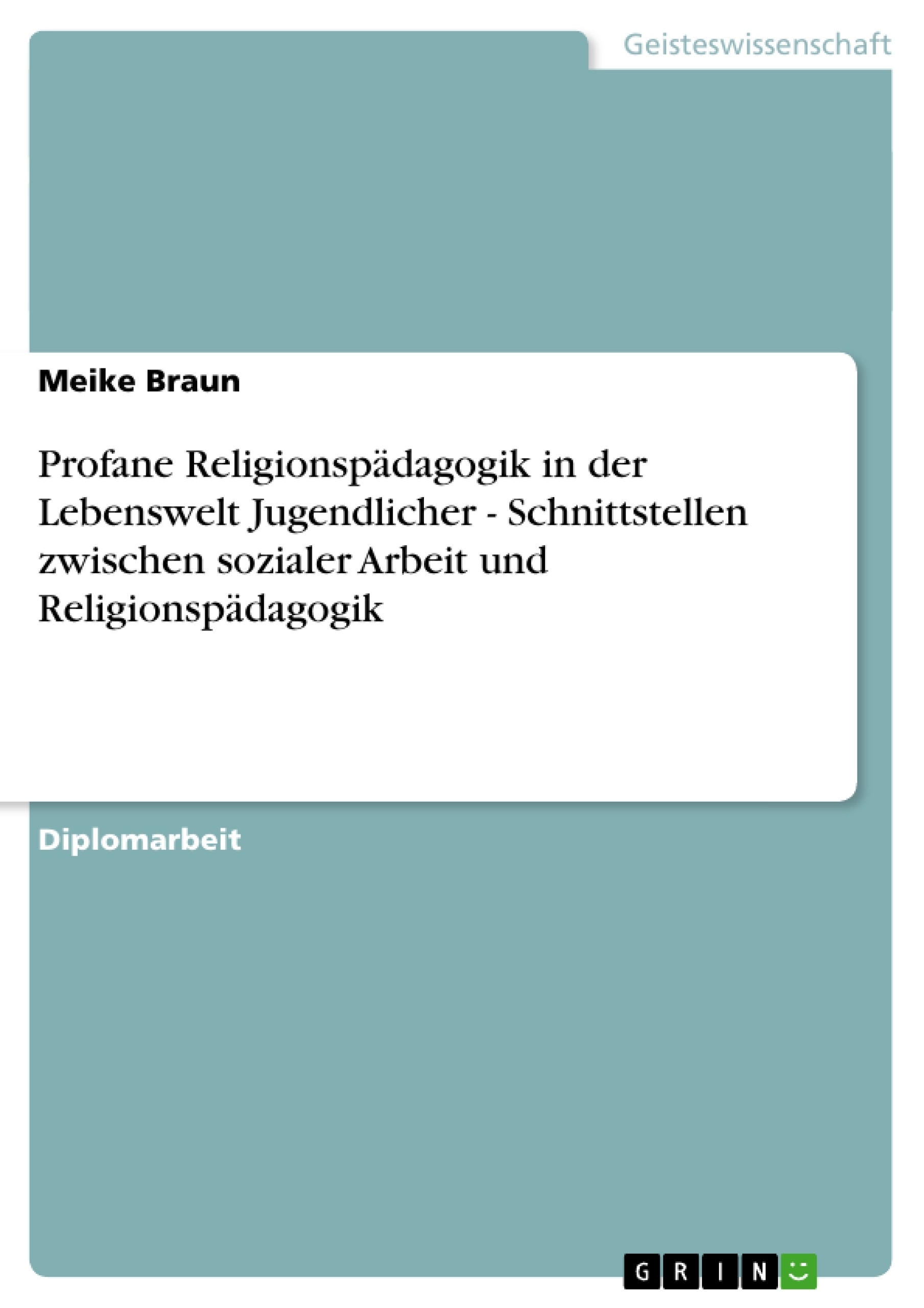Abstract
Bisher galten Soziale Arbeit und Religionspädagogik als unterschiedliche Möglichkeiten in der pädagogischen Arbeit mit Menschen. Während die Soziale Arbeit in der Lebenswelt der Klientel angesiedelt wurde, verstand man unter Religionspädagogik einen vom Alltag losgelösten Bereich. Mit dem Konzept der profanen Religionspädagogik versuchen Diet-rich Zilleßen und Bernd Beuscher diese Grenze zwischen den beiden Arbeitsbereichen aufzuheben. Die Autoren plädieren für eine Eingliederung der Religion in den Alltag in dem sie die Unterschiede zwischen heilig und profan auflösen. Durch diese Alltagsorien-tierung unter besonderer Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels zeigen sich Schnittstellen zwischen Religionspädagogik und Sozialer Arbeit. Der Alltag ist kein Rück-zugsraum mehr, sondern geprägt durch den Pluralismus. Sowohl Soziale Arbeit als auch die profane Religionspädagogik wollen den Einzelnen dahingehend befähigen, in seiner Lebenswelt adäquat mit den Anforderungen der Zeit umzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1 DAS KONZEPT DER LEBENSWELTORIENTIERTEN SOZIALEN ARBEIT (NACH HANS THIERSCH)
- 1.1 Geschichtlicher Abriss über die Entstehung des lebensweltorientierten Konzeptes
- 1.2 Die Bedeutung des Alltags
- 1.3 Die Bedeutung der Lebenswelt
- 1.4 Theoretischer Hintergrund
- 1.4.1 Die kritisch phänomenologische Alltagtheorie
- 1.5 Aufträge an die Soziale Arbeit
- 1.5.1 Alltäglichkeit als heuristisches Prinzip
- 1.5.2 Alltagsorientierung als ein Modus des Handelns und Verstehens
- 1.5.3 Handlungsmaxime der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- 1.6 Kritik
- 2 DIE LEBENSWELT JUGENDLICHER
- 2.1 Zum Begriff „Jugend“
- 2.2 Die Lebenswelt Jugendlicher im geschichtlichen Wandel der letzten fünfzig Jahre
- 2.2.1 Jugendliche in den fünfziger Jahren – „Die Halbstarken“
- 2.2.2 Jugendliche in den sechziger Jahren – „Die Rebellen“
- 2.2.3 Die siebziger Jahre - „Die überflüssige Generation“
- 2.2.4 Die achtziger Jahre - „Die Problemgeneration“
- 2.2.5 Der Anfang der neunziger Jahre - „Die Generation X“
- 2.3 Jugendliche von heute – Pluralität von Lebensführungen
- 2.3.1 Das familiäre Umfeld Jugendlicher
- 2.3.2 Normen und Werte der Jugendlichen
- 2.3.3 Freizeitbeschäftigungen der Jugendlichen
- 2.3.4 Religiosität bei Jugendlichen
- 2.3.5.1 Teilnahme am religiösen Leben
- 2.3.5.2 Auf der Such nach dem Sinn
- 2.3.6 Medien und die Möglichkeiten der grenzenlose Kommunikation
- 2.3.6.1 Fernsehen – Radio - Zeitung
- 2.3.6.2 Computer und Internet
- 2.3.6.3 Mobiltelefone
- 2.3.7 Gesellschaftliches Engagement
- 2.4 Zusammenfassung
- 2.5 Ausblick auf die Anforderungen an die Soziale Arbeit
- 3 DAS KONZEPT DER PROFANEN RELIGIONSPÄDAGOGIK (NACH DIETRICH ZILLEBEN UND BERND BEUSCHER)
- 3.1 Begriffsklärung Religionspädagogik und Profanität
- 3.2 Theologische Hintergründe
- 3.2.1 Zur Verbindung von Religion und Profanität
- 3.2.1.1 Die profane Religionspädagogik und die Methode der Korrelation nach P. Tillich
- 3.3 Das Religionsverständnis der profanen Religionspädagogik
- 3.3.1 Der schwankende Gott - Gottesvorstellungen
- 3.3.2 Im Glauben leben
- 3.3.3 Zum Verständnis der Bibel
- 3.3.4 Die Bedeutung von Mythen und Symbolen
- 3.4 Die Wahrnehmung des Fremden / des Anderen
- 3.5 Bezug zur Lebenswelt
- 3.6 Bedeutungen für die Praxis - Anforderungen an Professionelle
- 3.6.1 Die Haltung des Professionellen
- 3.7 Zusammenfassung und Ausblick
- 4 SCHNITTSTELLEN ZWISCHEN DER PROFANEN RELIGIONSPÄDAGOGIK UND DEM KONZEPT DER LEBENSWELTORIENTIERTEN SOZIALEN ARBEIT
- 4.1 Alltag und Alltäglichkeit
- 4.2 Einsatzgebiete und Anwendungsmöglichkeiten
- 4.3 Handlungsmaxime der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit im Vergleich mit der profanen Religionspädagogik
- 4.3.1 Alltagsorientierung
- 4.3.2 Prävention
- 4.3.3 Integration
- 4.3.4 Partizipation
- 4.3.5 Regionalisierung
- 4.4 Die profane Religionspädagogik in der Lebenswelt Jugendlicher
- 4.4.1 Allgemeine Aspekte
- 4.4.2 Die Aufgabe der Familie: Ausbildung von Werten und Normen
- 4.4.3 Medien
- 4.4.4 Religiosität
- 4.5 Die Religionspädagogik als ein Arbeitsbereich der Sozialen Arbeit
- 4.5.1 Zur Haltung des professionell Handelnden
- 4.5.2 Religion und Soziale Arbeit
- 4.5.3 Zu Diskussionen aufrufen – Wahrnehmung des Fremden
- 5 IDEEN FÜR DIE PRAXIS
- 5.1 Grundlegende Anforderungen an die Praxis
- 5.2 Ideen für die offene Jugendarbeit
- 5.3 Möglichkeiten für Jugendgruppen
- 5.4 Freizeitarbeit
- 5.5 Offene Gottesdienstformen
- 5.6 Ausblick zum Thema Ganztagsschule
- 6 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Schnittpunkte zwischen dem Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit und der Religionspädagogik. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, wie profane Religionspädagogik im Kontext der Lebenswelt Jugendlicher relevant und effektiv eingesetzt werden kann. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Konzepte herauszuarbeiten und praxisrelevante Ideen für den Einsatz von profaner Religionspädagogik in der Sozialen Arbeit zu entwickeln.
- Lebensweltorientierung und Alltagsnähe in der Sozialen Arbeit und Religionspädagogik
- Entwicklung und Wandel der Lebenswelt von Jugendlichen in den vergangenen Jahrzehnten
- Relevanz und Bedeutung von profaner Religionspädagogik im Pluralismus
- Schnittstellen und mögliche Synergien zwischen Sozialer Arbeit und profaner Religionspädagogik
- Praxisanwendungen von profaner Religionspädagogik in verschiedenen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit nach Hans Thiersch. Es werden die historischen Wurzeln, die Bedeutung des Alltags und der Lebenswelt sowie die theoretischen Grundlagen des Konzepts erläutert. Anschließend wird die Lebenswelt Jugendlicher im Wandel der letzten fünfzig Jahre beleuchtet, um die aktuellen Herausforderungen und Bedürfnisse von Jugendlichen im 21. Jahrhundert zu verstehen. Im dritten Kapitel wird das Konzept der profanen Religionspädagogik nach Dietrich Zilleben und Bernd Beuscher vorgestellt. Es werden die theologischen Hintergründe, das Religionsverständnis, die Bedeutung von Mythen und Symbolen sowie die Wahrnehmung des Fremden analysiert. Das vierte Kapitel untersucht die Schnittpunkte zwischen profaner Religionspädagogik und lebensweltorientierter Sozialen Arbeit. Es werden Einsatzgebiete, Handlungsmaximen und mögliche Synergien zwischen beiden Konzepten aufgezeigt. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Anwendung von profaner Religionspädagogik in der Lebenswelt von Jugendlichen. Das fünfte Kapitel liefert konkrete Ideen für die Praxis und beleuchtet verschiedene Einsatzmöglichkeiten von profaner Religionspädagogik in der offenen Jugendarbeit, Jugendgruppen, Freizeitarbeit und offenen Gottesdienstformen. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und stellt die Relevanz von profaner Religionspädagogik im Kontext der Lebenswelt Jugendlicher heraus.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Lebensweltorientierung, Soziale Arbeit, Religionspädagogik, Profanität, Jugend, Pluralismus, Wertewandel, Religion, Religiosität, Alltag, Handlungsmaximen, Praxisanwendungen und Ideen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "profane Religionspädagogik"?
Es ist ein Konzept von Zilleßen und Beuscher, das die Grenze zwischen Heiligem und Profanem auflöst und Religion direkt in den Alltag integriert.
Wie hängen Soziale Arbeit und Religionspädagogik zusammen?
Beide Disziplinen zielen darauf ab, Individuen (insbesondere Jugendliche) zu befähigen, adäquat mit den Anforderungen ihrer komplexen Lebenswelt umzugehen.
Was bedeutet Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch?
Das Konzept stellt den Alltag der Klienten in den Mittelpunkt und fordert von der Sozialen Arbeit Prävention, Integration und Partizipation.
Wie hat sich die Lebenswelt Jugendlicher verändert?
Die Arbeit zeigt den Wandel von den "Halbstarken" der 50er bis zur heutigen "Generation X" und der Pluralität moderner Lebensführungen auf.
Welche Rolle spielen Medien in der heutigen Jugendwelt?
Medien ermöglichen grenzenlose Kommunikation, prägen die Freizeitgestaltung und sind ein zentrales Feld für die Vermittlung von Werten und Normen.
- Citar trabajo
- Diplom-Sozialpädagogin Meike Braun (Autor), 2003, Profane Religionspädagogik in der Lebenswelt Jugendlicher - Schnittstellen zwischen sozialer Arbeit und Religionspädagogik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20016