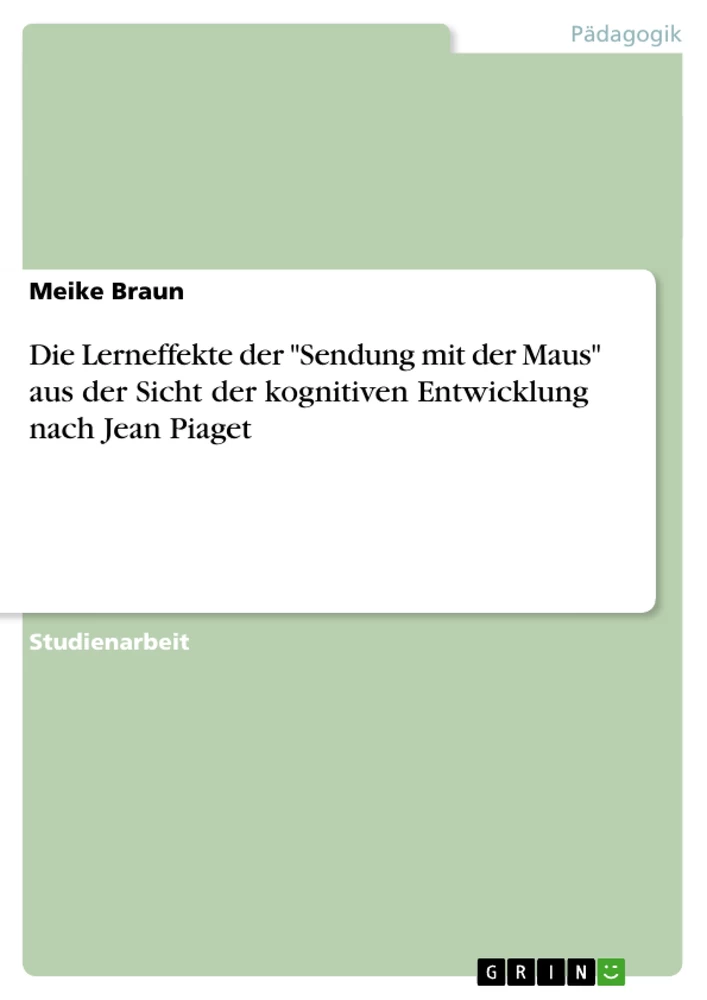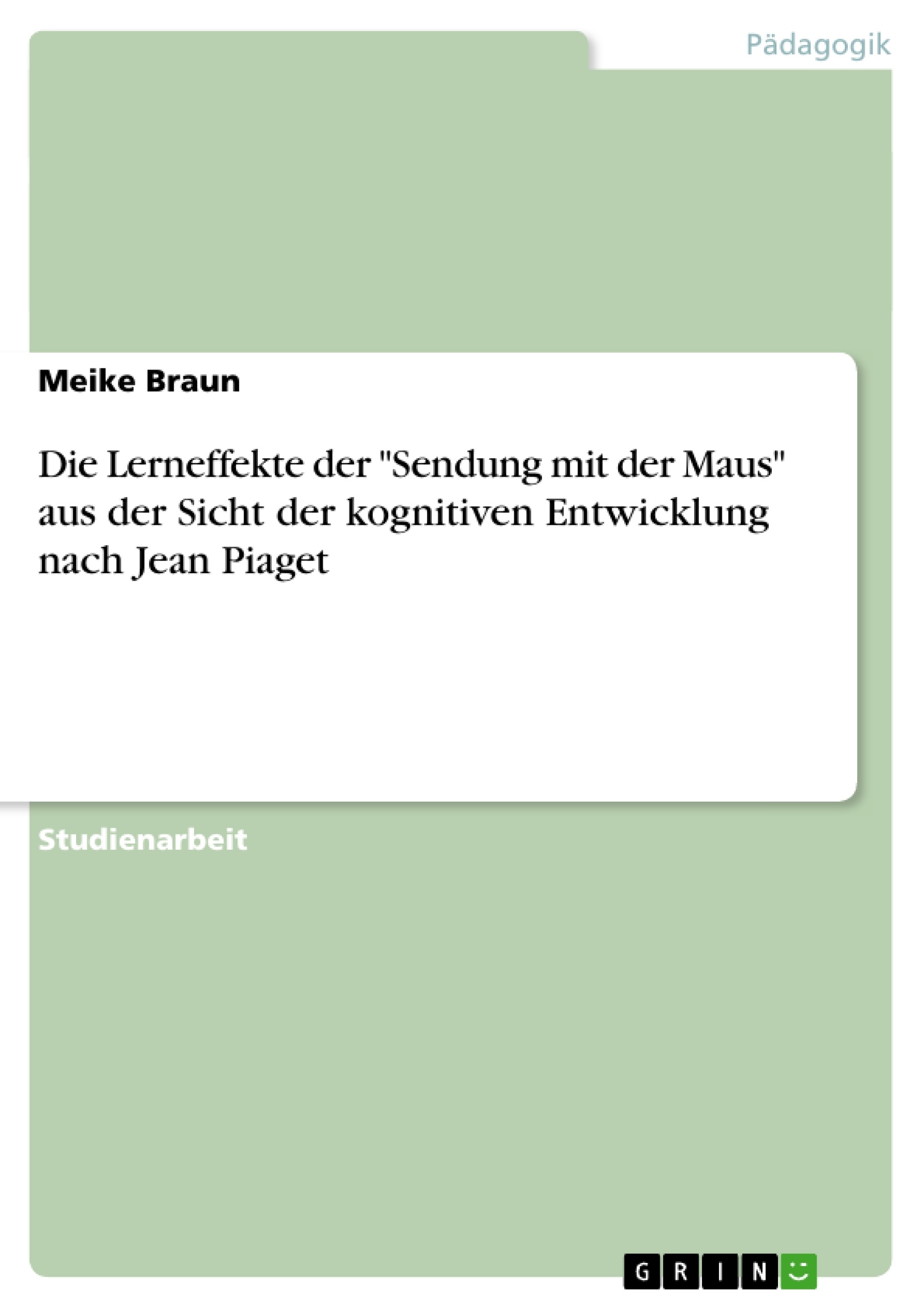Wie kommen Löcher in den Käse? Wie funktioniert ein Atomkraftwerk? Wie kommen Streifen in die Zahnpasta? Das sind alles Fragen, die mir als Kind in der „Sendung mit der Maus“ beantwortet wurden. Regelmäßig schauten meine Eltern, mein Bruder und ich mit großer Begeisterung dieses Magazin. Und auch heute noch hat die Maus nichts von ihrer Faszination eingebüßt und obwohl ich nun schon seit längerem aus der eigentlichen Zielgruppe draußen bin, schaue ich regelmäßig die „Sendung mit der Maus“ und lerne immer wieder dazu. Ich finde die Fragestellungen sehr interessant, weil sehr oft Dinge des täglichen Lebens angesprochen werden, über die man sich keine Gedanken macht, „weil das halt so ist“. Die „Sendung mit der Maus“ kennt kein „weil das halt so ist“ und nimmt gerade diese Dinge auf. Aber selbst für mich klingen manche Beiträge doch recht kompliziert, so dass sich bei mit die Frage stellte, in wie weit kann die eigentliche Zielgruppe – Vorschulkinder ab 4 Jahren – diese Zusammenhänge erkennen und auch verstehen.
Ziel dieser Arbeit soll sein einen kurzen Überblick über das Konzept der „Sendung mit der Maus“ zu geben und anhand des Modells der kognitiven Entwicklung Jean Piagets festzustellen, ob Vorschulkinder dazu in der Lage sind. Leider kann ich nicht auf alle Elemente der „Sendung mit der Maus“ eingehen, so dass ich mich auf die Sachgeschichten ausgewählter Folgen beziehen werde.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Die Sendung mit der Maus
- 1.2 Der Aufbau
- 1.2.1 Die Maus-Spots
- 1.2.2 Die Lachgeschichten
- 1.2.3 Die Sachgeschichten
- 1.2.3.1 Die Sachgeschichte: „Wie kommt die Milch in die Tüte“
- 1.3 Die Lerneffekte in der „Sendung mit der Maus“
- 2 Intelligenzentwicklung aus entwicklungspsychologischer Sicht
- 2.1 Jean Piaget
- 2.2 Grundbegriffe der Theorie
- 2.2.1 Adaption - Assimilation - Akkommodation
- 2.2.2 Schema - Strukturen
- 2.2.3 Aquilibration
- 2.2.4 Kreisreaktionen
- 2.3 Das Stufenmodell der kognitiven Entwicklung
- 2.3.1 Die Sensumotorische Stufe (Geburt bis zwei Jahre)
- 2.3.2 Die konkrete Phase (zwei bis elf Jahre)
- 2.3.2.1 Die Voroperative Phase
- 2.3.2.2 Die konkret-operatorische Phase
- 2.3.3 Die Stufe der formalen Operationen (zwölf bis fünfzehn Jahre)
- 2.4 Kritik
- 3 Die Lerneffekte der „Sendung mit der Maus“ aus der Sicht der kognitiven Entwicklung nach J. Piaget
- 3.1 Die Objektpermanenz als Voraussetzung von Fernseh-Verstehen
- 3.2 Die kindliche Wahrnehmung
- 3.3 Ordnen und Verstehen
- 3.4 Die Imitationen
- 3.5 Wiederholungen
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Lerneffekte der „Sendung mit der Maus“ für Vorschulkinder im Kontext der kognitiven Entwicklungstheorie Jean Piagets. Ziel ist es, die Fähigkeit von Vorschulkindern, die in der Sendung vermittelten Zusammenhänge zu verstehen, zu evaluieren. Die Arbeit beschränkt sich dabei auf die Sachgeschichten.
- Konzept und Aufbau der „Sendung mit der Maus“
- Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung
- Anwendbarkeit von Piagets Theorie auf das Fernsehverständnis von Kindern
- Analyse der Lerneffekte der Sachgeschichten
- Bewertung der didaktischen Gestaltung der Sendung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Faszination der Autorin für die „Sendung mit der Maus“ seit ihrer Kindheit. Es wird die Forschungsfrage formuliert, inwieweit Vorschulkinder die komplexen Zusammenhänge der Sachgeschichten verstehen können. Die Arbeit wird auf die Analyse der Sachgeschichten fokussiert.
1.1 Die Sendung mit der Maus: Dieses Kapitel beschreibt kurz die Entstehung der „Sendung mit der Maus“, beginnend mit den ersten Sachgeschichten von Armin Maiwald bis zur Etablierung als erfolgreiche Kinderserie. Es wird der Erfolg und die langjährige Popularität der Sendung hervorgehoben.
1.2 Der Aufbau: Das Kapitel analysiert den Aufbau der Sendung als Magazin mit wiederkehrenden Elementen wie Maus-Spots, Lach- und Sachgeschichten. Der feste Aufbau soll die jungen Zuschauer nicht überfordern und ein Gefühl der Vertrautheit vermitteln. Die verschiedenen Segmente und ihre Funktionen werden detailliert erklärt, einschließlich der Rolle der Moderatoren und der wiederkehrenden Figuren.
2 Intelligenzentwicklung aus entwicklungspsychologischer Sicht: Dieses Kapitel stellt Jean Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung vor. Es werden zentrale Begriffe wie Adaption, Assimilation, Akkommodation, Schema und Aquilibration erläutert. Das Stufenmodell der kognitiven Entwicklung wird detailliert beschrieben, wobei die relevanten Phasen für Vorschulkinder im Fokus stehen.
3 Die Lerneffekte der „Sendung mit der Maus“ aus der Sicht der kognitiven Entwicklung nach J. Piaget: Dieses Kapitel untersucht die Lerneffekte der „Sendung mit der Maus“ unter Anwendung von Piagets Theorie. Es wird analysiert, ob und wie die in der Sendung vermittelten Inhalte den kognitiven Fähigkeiten von Vorschulkindern entsprechen. Aspekte wie Objektpermanenz, kindliche Wahrnehmung, Ordnen und Verstehen sowie die Rolle von Imitation und Wiederholung werden im Hinblick auf die kognitiven Entwicklungsstufen diskutiert.
Schlüsselwörter
Sendung mit der Maus, kognitive Entwicklung, Jean Piaget, Vorschulkinder, Lerneffekte, Sachgeschichten, Fernsehverständnis, Adaption, Assimilation, Akkommodation, Objektpermanenz, Wahrnehmung, Imitation.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der „Sendung mit der Maus“
Was ist der Gegenstand der Analyse?
Die Analyse untersucht die Lerneffekte der „Sendung mit der Maus“ für Vorschulkinder im Kontext der kognitiven Entwicklungstheorie Jean Piagets. Der Fokus liegt dabei auf den Sachgeschichten und der Frage, inwieweit Vorschulkinder die vermittelten Zusammenhänge verstehen können.
Welche Aspekte der „Sendung mit der Maus“ werden betrachtet?
Die Analyse betrachtet den Aufbau der Sendung (Maus-Spots, Lach- und Sachgeschichten), die didaktische Gestaltung und die in den Sachgeschichten vermittelten Inhalte. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Analyse einer exemplarischen Sachgeschichte („Wie kommt die Milch in die Tüte?“).
Welche Theorie dient als Grundlage der Analyse?
Die Analyse basiert auf Jean Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung. Zentrale Begriffe wie Adaption, Assimilation, Akkommodation, Schema, Aquilibration und das Stufenmodell der kognitiven Entwicklung werden erläutert und auf das Fernsehverständnis von Kindern angewendet.
Welche Entwicklungsstufen nach Piaget sind relevant?
Die relevanten Entwicklungsstufen nach Piaget sind die sensumotorische Stufe (Geburt bis zwei Jahre), die präoperative Phase (zwei bis sieben Jahre) und die konkret-operatorische Phase (sieben bis elf Jahre), da diese die Altersgruppe der Vorschulkinder abdecken.
Welche kognitiven Fähigkeiten von Kindern werden im Zusammenhang mit der „Sendung mit der Maus“ untersucht?
Die Analyse untersucht die Bedeutung von Objektpermanenz, kindlicher Wahrnehmung, der Fähigkeit zum Ordnen und Verstehen sowie die Rolle von Imitation und Wiederholung für das Verständnis der Sachgeschichten.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Analyse?
Die Analyse bewertet die didaktische Gestaltung der „Sendung mit der Maus“ im Hinblick auf die kognitiven Fähigkeiten von Vorschulkindern und untersucht, ob und wie die vermittelten Inhalte den kognitiven Entwicklungsstufen nach Piaget entsprechen. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und gibt eine Einschätzung der Lerneffekte.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Analyse?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Sendung mit der Maus, kognitive Entwicklung, Jean Piaget, Vorschulkinder, Lerneffekte, Sachgeschichten, Fernsehverständnis, Adaption, Assimilation, Akkommodation, Objektpermanenz, Wahrnehmung, Imitation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur „Sendung mit der Maus“, zu Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung und zur Anwendung der Theorie auf die Lerneffekte der Sendung, sowie ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel erleichtern den Überblick.
- Citation du texte
- Diplom-Sozialpädagogin Meike Braun (Auteur), 2003, Die Lerneffekte der "Sendung mit der Maus" aus der Sicht der kognitiven Entwicklung nach Jean Piaget, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20017