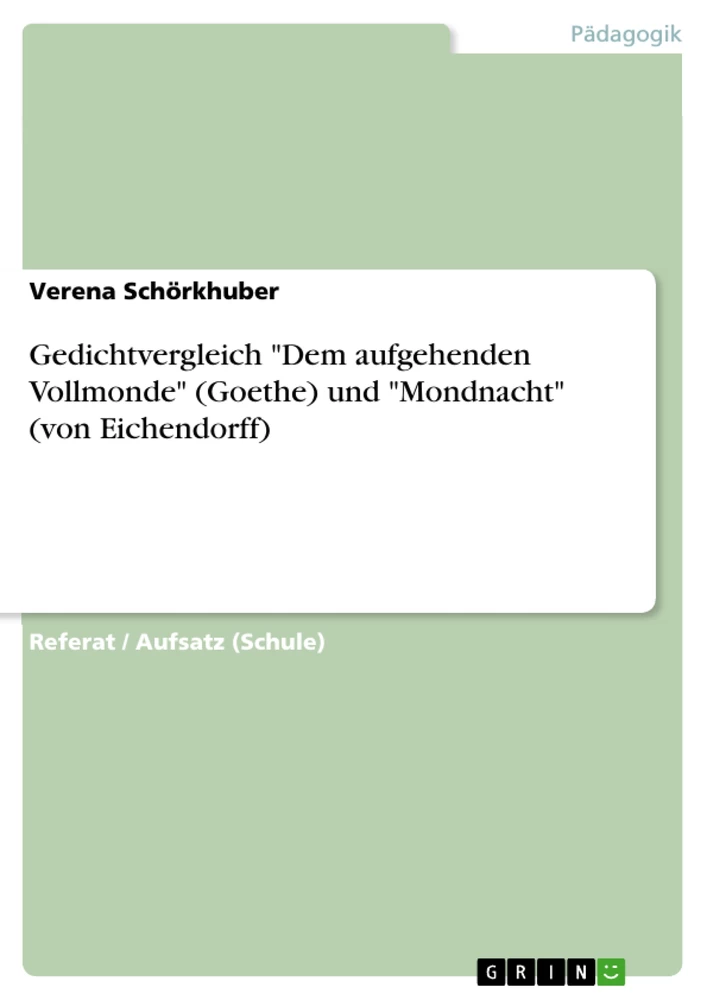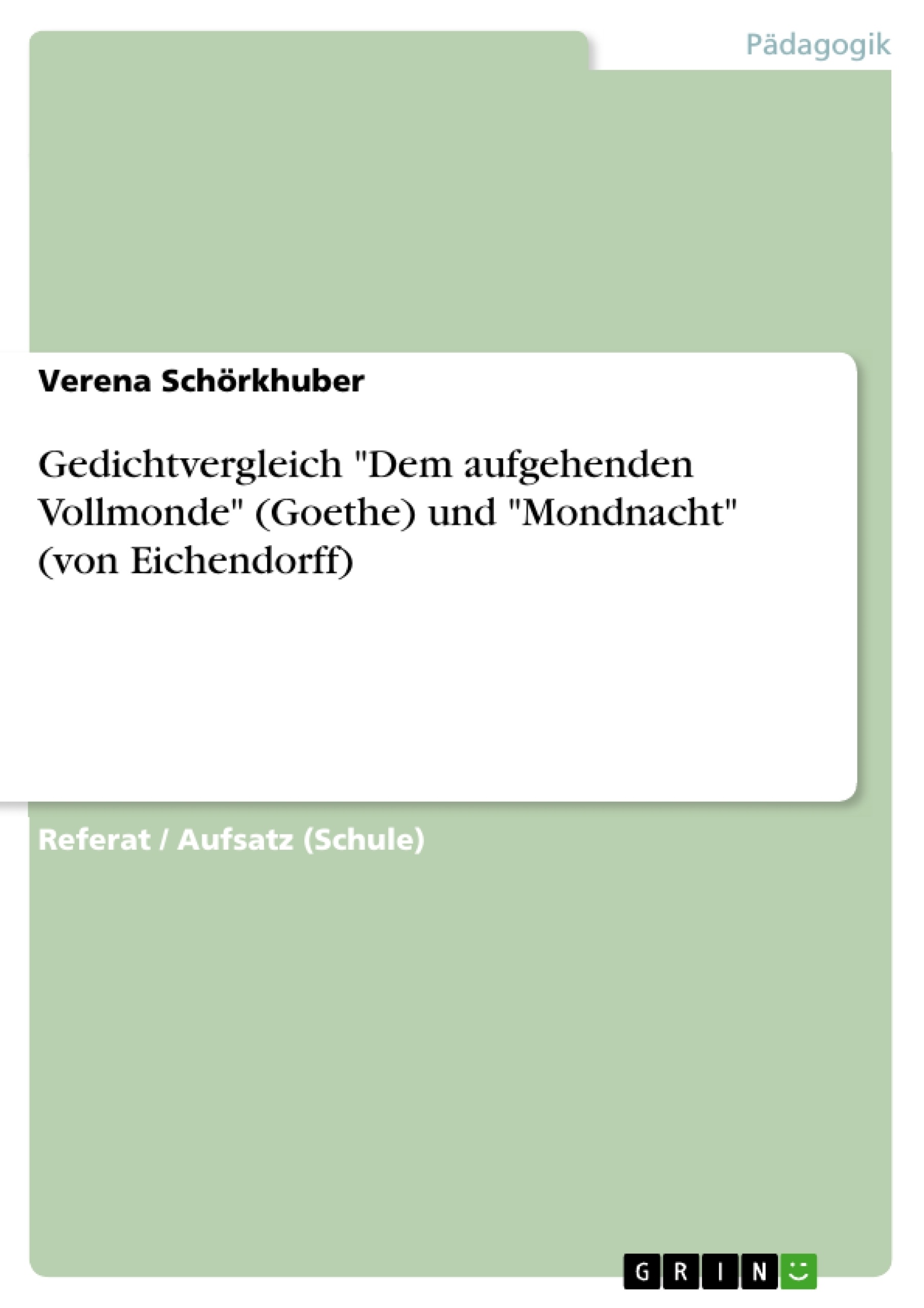Aufsatz (Wortanzahl: 919), welcher im Rahmen einer schriftlichen Schularbeit im Unterrichtsfach Deutsch verfasst und mit der Note "Sehr gut" beurteilt wurde.
AUFGABENSTELLUNG:
Vergleiche das Gedicht „Dem aufgehenden Vollmonde“ von Johann Wolfgang von Goethe mit der „Mondnacht“ Joseph von Eichendorffs und analysiere die formalen, sprachlichen und inhaltlichen Merkmale.
AUSZUG (Beginn):
Mit dem Gedicht „Dem aufgehenden Vollmonde“ von Johann Wolfgang von Goethe und „Mondnacht“ von Joseph von Eichendorff stehen sich zwei Gedichte gegenüber, die, obwohl sie aus verschiedenen Literaturepochen, die sich aber schon sehr ähnlich sind, stammen, nämlich aus der Klassik bzw. Sturm-und-Drang-Zeit (Goethe) und aus der Romantik (Eichendorff), dennoch unzählige formale als auch sprachliche und inhaltliche Gemeinsamkeiten aufweisen.
Die Epoche „Romantik“ lässt sich festlegen auf den Zeitraum von 1795-1830. Sie beginnt parallel zur Klassik und beschäftigt sich mit deren Vorstellungen. Die Romantik versteht sich selbst aber auf keinen Fall als „Gegenströmung“; sondern vielmehr als Ergänzung; Gefühle werden zum Beurteilungsinstrument.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text vergleicht die Gedichte „Dem aufgehenden Vollmonde“ von Goethe und „Mondnacht“ von Eichendorff. Ziel ist es, die formalen, sprachlichen und inhaltlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Werke aufzuzeigen und diese im Kontext ihrer jeweiligen Epochen (Klassik/Sturm und Drang und Romantik) zu analysieren.
- Formaler Vergleich der Gedichte (Strophenform, Reimschema)
- Sprachliche Analyse (Stilmittel, Wortwahl)
- Inhaltliche Analyse (Motive, Symbole, Thematik)
- Epochenzugehörigkeit und deren Einfluss auf die Gedichte
- Vergleich der Darstellung von Natur und Emotionen
Zusammenfassung der Kapitel
Gedichtvergleich: Der Text beginnt mit einem Vergleich der Gedichte "Dem aufgehenden Vollmonde" von Goethe und "Mondnacht" von Eichendorff, wobei die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Form, Sprache und Inhalt im Kontext der jeweiligen Epochen (Klassik/Sturm und Drang und Romantik) beleuchtet werden. Die Analyse legt den Fokus auf die Übereinstimmungen der beiden Gedichte trotz ihrer unterschiedlichen Epochenzugehörigkeit.
Goethes "Dem aufgehenden Vollmonde": Goethes Gedicht, bestehend aus drei vierzeiligen Strophen, adressiert den Vollmond direkt. Das lyrische Ich beschreibt seine Beobachtung des Mondes, der zunächst nah erscheint, dann von Wolken verdeckt wird. Die zweite Strophe drückt die damit verbundene Betrübnis aus, die mit der Sehnsucht nach einer fernen Geliebten verknüpft ist. Der Mond wird als Trostspender interpretiert, der dem lyrischen Ich ein Gefühl des Geliebtwerdens vermittelt. Die letzte Strophe zeigt den Mond, der seinen Weg durch die Wolken bahnt und in voller Pracht erscheint, während das lyrische Ich seine Sehnsucht und den Schmerz der Trennung erneut ausdrückt. Die Grundstimmung ist geprägt von ruhiger Träumerei und stürmischen Gefühlen, die durch den Anblick des Mondes ausgelöst werden. Die Sprache ist leicht verständlich, aber gehoben.
Eichendorffs "Mondnacht": Eichendorffs "Mondnacht", ebenfalls in drei vierzeiligen Strophen gegliedert, ist ein typisches Beispiel der Spätromantik. Das Gedicht beginnt mit einem überirdischen Vergleich ("Himmelskuss"), der die Stimmung beschreibt. Die ersten beiden Strophen beschreiben die wunderschöne Natur, während die dritte Strophe das lyrische Ich einführt, dessen Seele durch die stille Landschaft fliegt und die Heimkehr (möglicherweise den Tod) als Rückkehr nach Hause empfindet. Die Bewegung verläuft von oben nach unten (Himmel zur Erde) in den ersten Strophen und umgekehrt in der letzten, symbolisierend die Erhebung des Geistes aus der Dunkelheit. Die einzigartige Atmosphäre wird durch sprachliche Bilder hervorgehoben, die der Seele Flügel verleihen und ihre freie Bewegung in der Natur zeigen.
Schlüsselwörter
- Goethe
- Eichendorff
- Gedichtvergleich
- Romantik
- Klassik
- Sturm und Drang
- Mond
- Natur
- Sehnsucht
- Liebe
- Sprache
- Stilmittel
- formale Analyse
- inhaltliche Analyse
- lyrisches Ich
- Stimmung
- Symbol
Goethe vs. Eichendorff: Ein Gedichtvergleich - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Dieser Text analysiert und vergleicht die Gedichte "Dem aufgehenden Vollmonde" von Johann Wolfgang von Goethe und "Mondnacht" von Joseph von Eichendorff. Der Fokus liegt auf den formalen, sprachlichen und inhaltlichen Gemeinsamkeiten und Unterschieden beider Werke im Kontext ihrer jeweiligen Epochen (Klassik/Sturm und Drang und Romantik).
Welche Gedichte werden verglichen?
Es werden Goethes "Dem aufgehenden Vollmonde" und Eichendorffs "Mondnacht" verglichen.
Welche Aspekte der Gedichte werden analysiert?
Die Analyse umfasst einen formalen Vergleich (Strophenform, Reimschema), eine sprachliche Analyse (Stilmittel, Wortwahl), eine inhaltliche Analyse (Motive, Symbole, Thematik) und die Betrachtung der Epochenzugehörigkeit und deren Einfluss auf die Gedichte. Der Vergleich der Darstellung von Natur und Emotionen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen zu jedem Gedicht und einen Vergleich der beiden, sowie eine Liste mit Schlüsselbegriffen.
Welche Epochen sind relevant für die Analyse?
Die Analyse betrachtet die Epochen Klassik/Sturm und Drang (Goethe) und Romantik (Eichendorff) und deren Einfluss auf die jeweiligen Gedichte.
Wie wird Goethes "Dem aufgehenden Vollmonde" beschrieben?
Goethes Gedicht, bestehend aus drei vierzeiligen Strophen, beschreibt die Beobachtung des Vollmonds, der zunächst nah erscheint, dann von Wolken verdeckt wird. Es thematisiert die damit verbundene Betrübnis und Sehnsucht nach einer fernen Geliebten. Der Mond wird als Trostspender interpretiert. Die Grundstimmung ist geprägt von ruhiger Träumerei und stürmischen Gefühlen.
Wie wird Eichendorffs "Mondnacht" beschrieben?
Eichendorffs "Mondnacht", ebenfalls in drei vierzeiligen Strophen, ist ein typisches Beispiel der Spätromantik. Das Gedicht beschreibt die wunderschöne Natur und das lyrische Ich, dessen Seele durch die stille Landschaft fliegt. Die Bewegung verläuft von oben nach unten (Himmel zur Erde) und umgekehrt, symbolisierend die Erhebung des Geistes aus der Dunkelheit. Die einzigartige Atmosphäre wird durch sprachliche Bilder hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Eichendorff, Gedichtvergleich, Romantik, Klassik, Sturm und Drang, Mond, Natur, Sehnsucht, Liebe, Sprache, Stilmittel, formale Analyse, inhaltliche Analyse, lyrisches Ich, Stimmung, Symbol.
Was ist das Hauptziel des Vergleichs?
Das Hauptziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Gedichte in Form, Sprache und Inhalt aufzuzeigen und diese im Kontext ihrer jeweiligen Epochen zu analysieren, insbesondere die Übereinstimmungen trotz unterschiedlicher Epochenzugehörigkeit zu beleuchten.
- Quote paper
- MMag. Verena Schörkhuber (Author), 2003, Gedichtvergleich "Dem aufgehenden Vollmonde" (Goethe) und "Mondnacht" (von Eichendorff), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200198