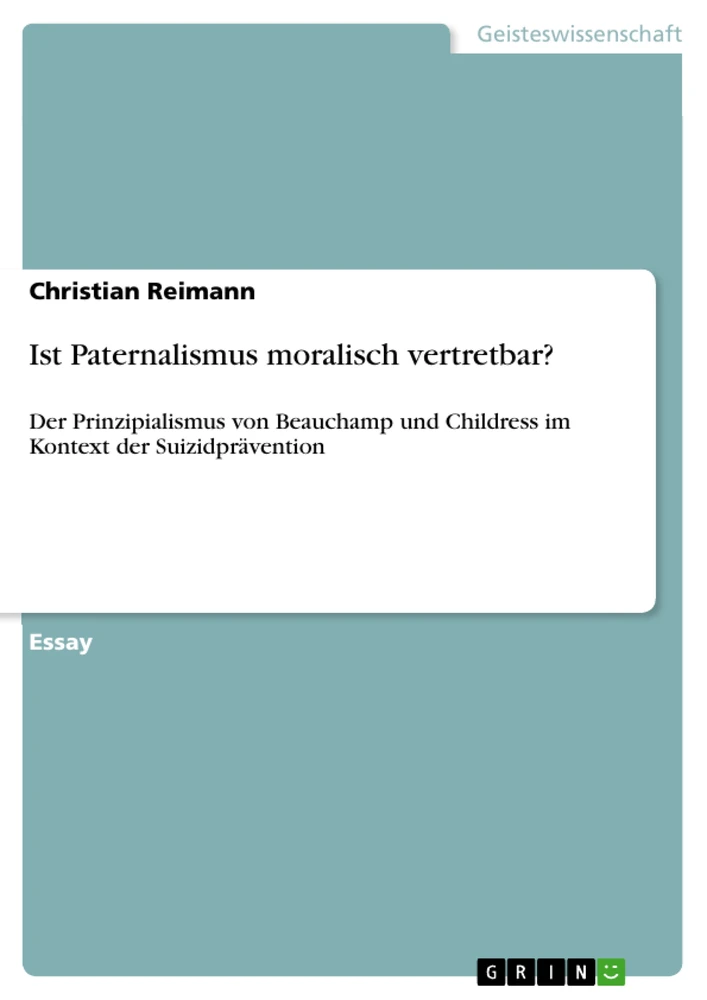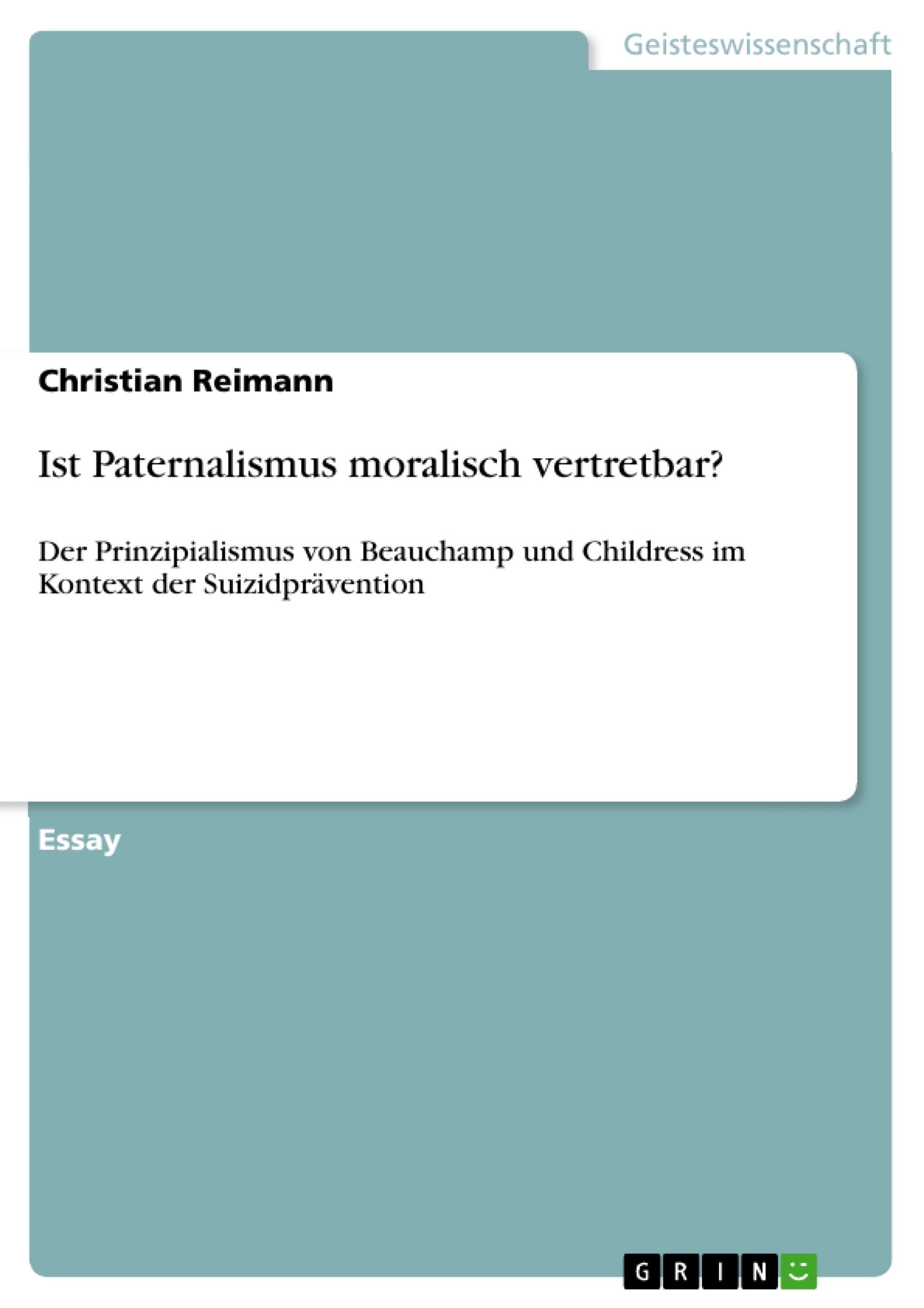Im bio- und medizinethischen Diskurs ist die Position des so genannten Prinzipialismus, deren Ausgangspunkt für die Beurteilung moralisch richtigen und falschen Handelns allgemein verbreitete Moralvorstellungen sind, von zentraler Relevanz. Ihre Bedeutung zeigt sich nicht zuletzt an der praxisbezogenen Relevanz des Werks Principles of Biomethical Ethics (erste Auflage: 1979) von Tom L. Beauchamp und James F. Childress, das in den USA im Bereich Medizin und Medizinethik als Standardwerk gilt (vgl. etwa Ach/Runtenberg 2002, 56). In diesem Ansatz verfolgen die Autoren ausgehend von vier traditionell anerkannten moralischen Prinzipien ein bestimmtes Ziel: die Rechtfertigung einer commom morality, d.h. einer gemeinsamen Moral, „[…] die bei der gesellschaftlichen Urteilsbildung über moralisch strittige Fragen eine hinreichende Urteilsgrundlage zur Verfügung stellt“ (Düwell 2008, 91). Dabei diskutieren Beauchamp und Childress auch die Frage nach der moralischen Rechtfertigung von Paternalismus, den sie allgemein definieren als: „the intentional overriding of one person’s known preferences or actions by another person, where the person who overrides justifies the action by the goal of benefiting or avoiding harm to the person whose preferences or actions are overridden“ (2001, 178, Hervorhebung im Original).
Die Frage nach der Rechtfertigung paternalistischer Eingriffe bildet das Thema des vorliegenden Essays. Der Fokus liegt dabei auf der Diskussion paternalistischer Eingriffe in Verbindung mit suizidgefährdeten Personen. In diesem Zusammenhang soll folgende Frage untersucht werden: Bietet der Ansatz von Beauchamp und Childress eine ausreichende Grundlage zur moralischen Rechtfertigung paternalistischer Handlungen als Mittel zur Suizidprävention?
Im Fortgang soll dargelegt und diskutiert werden, dass der von den Autoren vorgeschlagene Ansatz als moralische Urteilsgrundlage unzureichend ist. Zu diesem Zweck ist es zunächst erforderlich, zu demonstrieren, mittels welcher Argumente Beauchamp und Childress Paternalismus im Kontext der Suizidvorbeugung rechtfertigen (vgl. 2.1.), um anschließend ihre Position anhand eines Gedankenexperimentes als heuristisches Mittel zu problematisieren (vgl. 2.2.). Den Abschluss bildet eine Zusammenfassung, in welcher auf die Ergebnisse des zweiten Kapitels zurückgegriffen und der Ansatz von Beauchamp und Childress kritisch gewürdigt wird (vgl. 3.).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Paternalismus – ein moralisch vertretbares Mittel zur Suizidprävention?
- 2.1 Argumente zur moralischen Rechtfertigung von Paternalismus
- 2.2 Das Problem des Bilanzselbstmordes
- 3. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay untersucht die moralische Vertretbarkeit von paternalistischen Eingriffen in der Suizidprävention, insbesondere im Kontext des Prinzipialismus von Beauchamp und Childress. Die Arbeit hinterfragt, ob der von Beauchamp und Childress vorgeschlagene Ansatz eine ausreichende Grundlage für die moralische Rechtfertigung paternalistischer Handlungen bietet.
- Moralische Rechtfertigung von Paternalismus
- Prinzipialismus von Beauchamp und Childress
- Autonomie vs. Wohltätigkeit
- Suizidprävention und ethische Konflikte
- Anwendung des Prinzipialismus auf konkrete Fälle
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Prinzipialismus von Beauchamp und Childress als zentralen Ansatz im bio- und medizinethischen Diskurs vor und hebt dessen Bedeutung für die Beurteilung moralisch richtigen und falschen Handelns hervor. Sie führt das Werk „Principles of Biomethical Ethics“ ein und erläutert das Ziel des Prinzipialismus, eine gemeinsame Moral (common morality) zu begründen. Die Einleitung definiert Paternalismus und benennt die zentrale Forschungsfrage des Essays: Bietet der Ansatz von Beauchamp und Childress eine ausreichende Grundlage zur moralischen Rechtfertigung paternalistischer Handlungen als Mittel zur Suizidprävention? Der Essay gliedert sich in die Darstellung der Argumente von Beauchamp und Childress zur Rechtfertigung von Paternalismus, die Problematisierung dieser Position anhand eines Gedankenexperiments und eine abschließende kritische Würdigung des Ansatzes.
2. Paternalismus – ein moralisch vertretbares Mittel zur Suizidprävention?: Dieses Kapitel untersucht, wie Beauchamp und Childress Paternalismus als moralischen Prinzipienkonflikt darstellen und welche Argumente sie zur Rechtfertigung paternalistischer Handlungen anführen. Es werden die vier Prinzipien des Prinzipialismus – Autonomie, Nichtschädigung, Wohltätigkeit und Gerechtigkeit – detailliert erläutert. Die Autoren betonen, dass diese Prinzipien prima-facie-Pflichten darstellen, die im Konfliktfall gegeneinander abgewogen werden müssen. Der Fokus liegt auf dem Konflikt zwischen Autonomie und Wohltätigkeit im Kontext paternalistischer Eingriffe. Beauchamp und Childress argumentieren, dass paternalistische Handlungen gerechtfertigt sein können, wenn der Nutzen die Einschränkung der Autonomie überwiegt. Das Kapitel bereitet die kritische Auseinandersetzung mit dieser Position im folgenden Abschnitt vor.
2.1 Argumente zur moralischen Rechtfertigung von Paternalismus: Dieser Abschnitt beschreibt detailliert die vier Prinzipien des Prinzipialismus von Beauchamp und Childress (Autonomie, Nichtschädigung, Wohltätigkeit und Gerechtigkeit) und ihre Rolle im Kontext von paternalistischen Handlungen. Es wird herausgestellt, dass diese Prinzipien keine absolute Geltung besitzen, sondern als prima-facie-Pflichten verstanden werden, die im Konfliktfall durch Abwägung ihrer relativen Gewichtung gelöst werden müssen. Der Abschnitt betont den Spezifikationsprozess, der die konkrete Anwendung der Prinzipien im Einzelfall erfordert und die Notwendigkeit eines rationalen Diskurses, der weitere relevante Normen und Prinzipien berücksichtigt. Die Abwägung zwischen Autonomie und Wohltätigkeit im Kontext paternalistischer Eingriffe wird als zentraler Punkt hervorgehoben, wobei kein Prinzip a priori Priorität besitzt.
Schlüsselwörter
Paternalismus, Suizidprävention, Prinzipialismus, Beauchamp und Childress, Autonomie, Wohltätigkeit, Nicht-Schädigung, Gerechtigkeit, prima-facie-Pflichten, moralische Rechtfertigung, ethischer Konflikt, Abwägung von Prinzipien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Essay: Paternalismus in der Suizidprävention
Was ist das zentrale Thema des Essays?
Der Essay untersucht die moralische Vertretbarkeit paternalistischer Eingriffe in der Suizidprävention. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Prinzipialismus von Beauchamp und Childress eine ausreichende Grundlage für die moralische Rechtfertigung solcher Eingriffe bietet.
Welche Methode wird im Essay verwendet?
Der Essay analysiert den Prinzipialismus von Beauchamp und Childress, ein bedeutendes ethisches Modell im biomedizinischen Bereich. Er untersucht die vier Prinzipien (Autonomie, Nichtschädigung, Wohltätigkeit und Gerechtigkeit) und deren Anwendung auf den Konflikt zwischen paternalistischen Eingriffen und der Autonomie des Individuums im Kontext von Suizidprävention.
Welche Prinzipien von Beauchamp und Childress werden behandelt?
Der Essay behandelt die vier Prinzipien des Prinzipialismus: Autonomie, Nichtschädigung (Nicht-Schädigung), Wohltätigkeit und Gerechtigkeit. Diese werden als prima-facie-Pflichten dargestellt, die im Konfliktfall gegeneinander abgewogen werden müssen. Der Essay konzentriert sich insbesondere auf den Konflikt zwischen Autonomie und Wohltätigkeit bei paternalistischen Maßnahmen zur Suizidprävention.
Wie wird Paternalismus im Essay definiert?
Der Essay definiert Paternalismus als Eingriff in die Autonomie einer Person mit dem Ziel, sie vor potentiellem Schaden zu schützen, auch gegen ihren Willen. Der Essay hinterfragt, unter welchen Bedingungen solche Eingriffe moralisch vertretbar sind, insbesondere im Kontext der Suizidprävention.
Welche konkreten Fragen werden im Essay behandelt?
Der Essay untersucht, ob die Argumente von Beauchamp und Childress eine hinreichende Grundlage für die moralische Rechtfertigung paternalistischer Handlungen in der Suizidprävention liefern. Es wird hinterfragt, ob der Nutzen solcher Eingriffe die Einschränkung der Autonomie rechtfertigt und wie die Abwägung der Prinzipien im Einzelfall erfolgen sollte.
Wie ist der Essay aufgebaut?
Der Essay gliedert sich in eine Einleitung, die den Prinzipialismus von Beauchamp und Childress und die Forschungsfrage einführt. Es folgt ein Kapitel zur Darstellung und kritischen Analyse der Argumente von Beauchamp und Childress zur Rechtfertigung von Paternalismus, einschließlich einer detaillierten Betrachtung der vier Prinzipien. Der Essay schließt mit einer Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Essay?
Schlüsselwörter sind: Paternalismus, Suizidprävention, Prinzipialismus, Beauchamp und Childress, Autonomie, Wohltätigkeit, Nicht-Schädigung, Gerechtigkeit, prima-facie-Pflichten, moralische Rechtfertigung, ethischer Konflikt, Abwägung von Prinzipien.
Welche Rolle spielt der „Bilanzselbstmord“ im Essay?
Der Essay erwähnt das Problem des "Bilanzselbstmordes", ein Gedankenexperiment, das wahrscheinlich dazu dient, die Grenzen und Herausforderungen der Anwendung des Prinzipialismus von Beauchamp und Childress auf komplexe Fälle der Suizidprävention zu veranschaulichen.
- Quote paper
- Christian Reimann (Author), 2012, Ist Paternalismus moralisch vertretbar?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200239