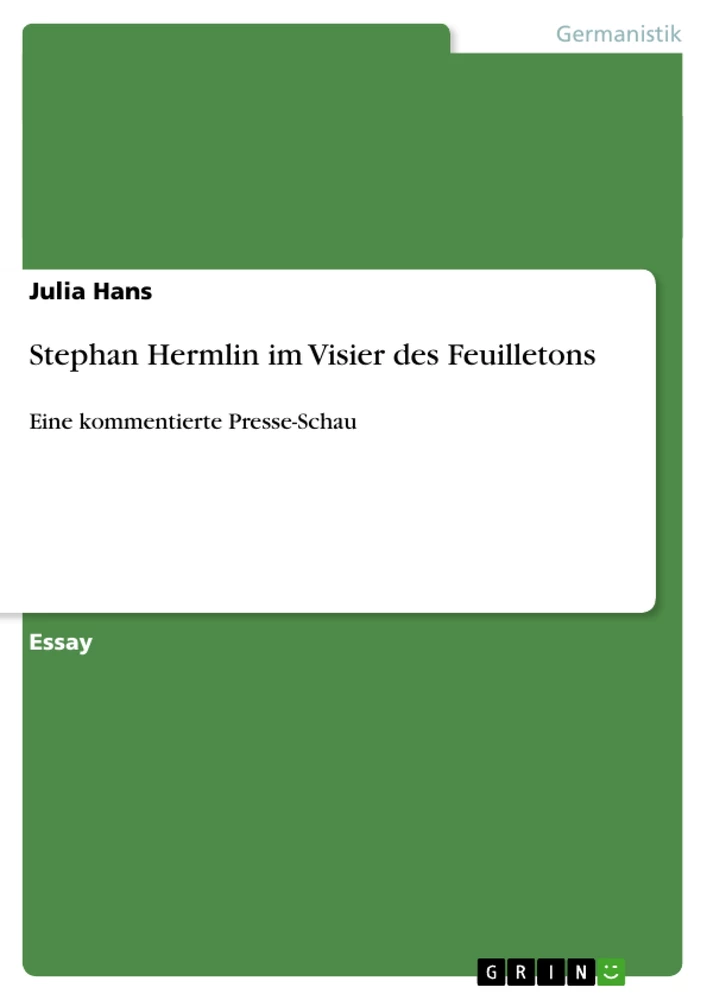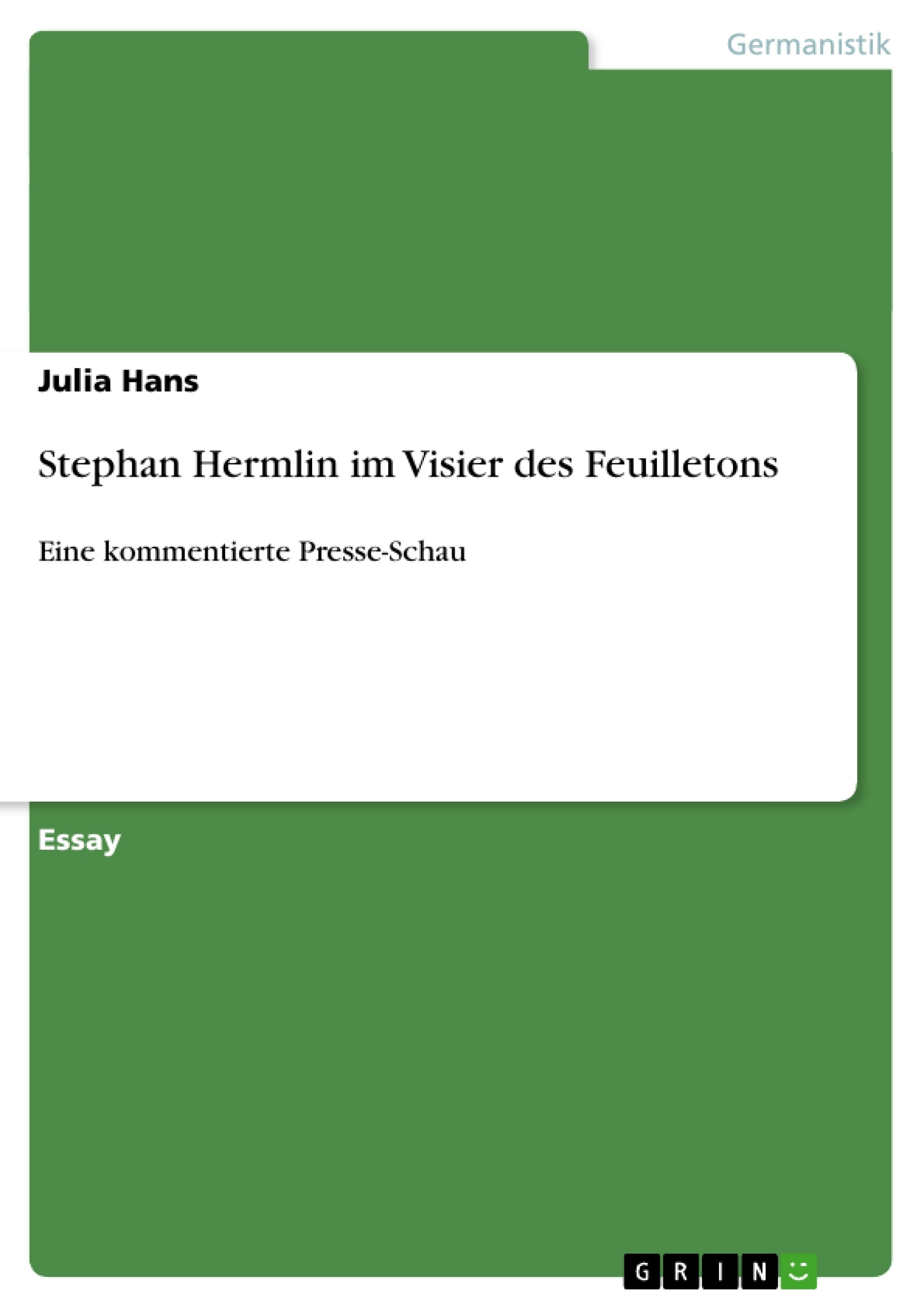Die Arbeit befasst sich mit der feuelletonistischen Auseinandersetzung mit Karl Corinos Artikel "Stephan Hermlin hat seinen Lebensmythos erlogen. Dichtung in eigener Sache", der am 04.10.1996 in der ZEIT veröffentlicht wurde. In diesem wirft Corino Hermlin vor, er habe durch in seinem stets als Autobiographie deklarierten Werk "Abendlicht" falsche Angaben getätigt und somit seine Vita gefälscht. Die Arbeit fasst zunächst die Debatte zusammen, um sie in einem nächsten Schritt literaturwissenschaftlich auszuwerten.
Stephan Hermlin im Visier des Feuilletons - Eine kommentierte Presse-Schau
Karl Corino provozierte mit seinem am 4. Oktober 1996 in der ZEIT veröffentlichten Artikel DDR-Schriftsteller Stephan Hermlin hat seinen Lebensmythos erlogen. Dichtung in eigener Sache eine feuilletonistische Debatte, die durch sämtliche Zeitungen Deutschlands und auch darüber hinaus ging. Der Grund für diesen Disput war der in dem Bericht artikulierte Vorwurf, Hermlin habe mit Lügen seine Vita verfälscht. Vor allen Dingen sein Werk Abendlicht (1979), das von dem Großteil der Kritiker stets als Autobiographie gelesen wurde, basiere auf Unwahrheiten. Die anschließende Diskussion wurde auf verschiedenen Ebenen ausgetragen, und zwar auf einer politischen, die mit einer persönlichen eng verbunden war, sowie auf einer literarischen. Die Auseinandersetzung wird im folgenden dargestellt, wobei auf die literarische Dimension besonderes Augenmerk gelegt wird. Anschließend wird der Disput auf seine literaturwissenschaftliche Tauglichkeit hin analysiert und evaluiert.
1 Zusammenfassung des Streitgesprächs
Die Debattierenden spalteten sich in zwei Lager - eines, das Corinos Meinung vertrat und ein anderes, das es nicht tat und also den Literaten Hermlin unterstützte. Hierbei definierten sich die Befürworter der einen oder anderen Meinung nach der eigenen, auch politischen, Vergangenheit: Der Großteil derjenigen, die Hermlin beistanden, waren bezeichnenderweise Menschen, die in der ehemaligen DDR gelebt hatten, die Corino-Unterstützer kamen aus dem Westen. Es kam von Anfang an zu dieser Trennung, weshalb auch die Diskussion als solche größtenteils politisch geführt wurde. Auch der Verfasser des Zeit-Artikels war verantwortlich für das Entstehen einer politischen Ebene, denn in seinem Beitrag betonte er bereits in der Überschrift allein durch die Bezeichnung Hermlins als DDR-Schriftsteller die geographische Herkunft und die damit scheinbar auch einhergehende politische Verortung des Autors. Durch das Eingangszitat des Artikels, das Hermlins Meinung zur Ursache des Endes der in der DDR geltenden Staatsform wiedergibt, wird die politische Ebene verstärkt.
Die politische Auseinandersetzung bestand im Wesentlichen aus dem Vorwurf der in der ehemaligen DDR Lebenden, Corino wolle diesen ihre Identifikationsfigur nehmen und eine Legende demontieren, sogar Antisemitismus-Vorwürfe wurden laut. Die Aufdeckung Corinos wurde als skandalträchtig angesehen. Sie wolle Hermlin unbedingt „beschmutzen“ (Dieckmann v. 12.10.96), da Corino mit seiner politischen Meinung nicht konform gehe. Die Westler konterten, Hermlin habe sich mit seinem geschönten Lebenslauf als Helden stilisiert. Da diese Biographie verantwortlich für Hermlins Einfluss und Sonderstellung in der DDR war, sei eine Fälschung verwerflich. Das Verhalten Hermlins sei indes so verwunderlich nicht, da der Kommunismus an sich auf Lügen und Fälschungen basiere. Mit diesem Argument wurde das Eingangszitat von Corinos Artikel erneut aufgegriffen.
Die Argumentation auf persönlicher Ebene bestand vor allen Dingen darin, die Widersprüchlichkeit des Schriftstellers zu betonen: Hermlin verhielt sich zum einen staatskonform durch Rechtfertigung des Baus der Mauer, zum anderen auch renitent durch Initiation der Biermann-Petition und Überstützung anderer Schriftsteller. Mit diesem Verhalten habe der Schriftsteller bereits seinen paradoxen Charakter offenbart, eine Lüge sei daher nicht sonderlich erstaunlich. Ehemalige Ostler versuchten, die Fälschung zu verharmlosen, indem sie die Verdienste des Autors in der DDR und seinen Widerstand gegen den Nationalsozialismus betonten. Selbst wenn Hermlins Biographie nicht der Wahrheit entspreche, so habe er den daraus resultierenden Einfluss doch sinn- und verdienstvoll eingesetzt.
Auf literarischer Ebene wurde zunächst versucht, Abendlicht gattungstheoretisch einzuordnen. Die Hermlin-Befürworter stützten sich darauf, dass das Buch keine Gattungsbezeichnung trage und daher nicht als Autobiographie gelesen werden könne. Corino wurde vorgeworfen, unwissenschaftlich zu arbeiten, indem er „deutlich erkennbare Fiktion als […] Fakt“ (Heym) ausgebe, und das trotz Hermlins erklärter Neigung, „Atmosphärisches über das eigentlich Berichtete zu stellen“ (Dieckmann v. 25.10.96). Es wurde auf den Klappentext der Reclam-Ausgabe verwiesen, in dem das Werk zum einen als Prosa klassifiziert und zum anderen die „besondere Artung“ (Dieckmann v. 12.10.96) betont werde: „[...] aus der Rückschau gewonnen und doch keine Autobiographie [...]“. Das Corino- Lager entgegnete, dass das zwar stimme, Hermlins Prosa jedoch - und zwar nicht nur Abendlicht, sondern auch bereits zuvor veröffentlichte Erzählungen - von den Kritikern stets autobiographisch gelesen worden sei und Hermlin einer solchen Lesart nichts entgegengesetzt habe. Diese Rezeption kam unter anderem durch die Zurückhaltung Hermlins in Interviews, sich zu persönlichen Fragen zu äußern, zustande. Das Werbematerial des Verlages habe diese Lesart zudem verstärkt. Deswegen sei eine Überprüfung der in Abendlicht dargestellten Ereignisse auf ihren Wahrheitsgehalt hin durchaus legitim. Rückfragen von Seiten der Kritiker seien außerdem absehbar gewesen, da Hermlin sein Werk und sein Leben durch Ver- und Bearbeitung seiner Biographie in seinen Texten stets miteinander vermischte. Eine solche Untersuchung sei indes auch Aufgabe der Literaturwissenschaft und habe mit Denunziation nichts zu tun.
Die andere Seite bemühte literaturwissenschaftliche Beispiele, um Hermlin zu unterstützen. Auch Karl May sei nie in Kurdistan gewesen. Die Werke Thomas Manns seien vollends aus bereits vorliegender Literatur oder der eigenen Biographie gespeist. Bei Vladimir Nabokov werde der Lebenslauf durch kunstvolle Verarbeitung zur Fiktion, im Endeffekt nur noch rudimentär vorhanden und folglich nicht mehr als dieser erkennbar. Überdies hätten Dichter ihr Leben schon immer als „literarische Verfügungsmasse“ (Jessen) angesehen. Literatur werde durch den ihr entsprungenen politischen Hintergrund anders bewertet und könne in dieser Weise sogar qualitativ aufgewertet werden, wand das Corino-Lager ein. Gesetzt den Fall, Anne Frank hätte ihr Tagebuch nicht in einem Amsterdamer Versteck verfasst: Das Buch hätte gegenwärtig eine andere Bedeutung.
[...]
- Arbeit zitieren
- B.A. Julia Hans (Autor:in), 2012, Stephan Hermlin im Visier des Feuilletons, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200293