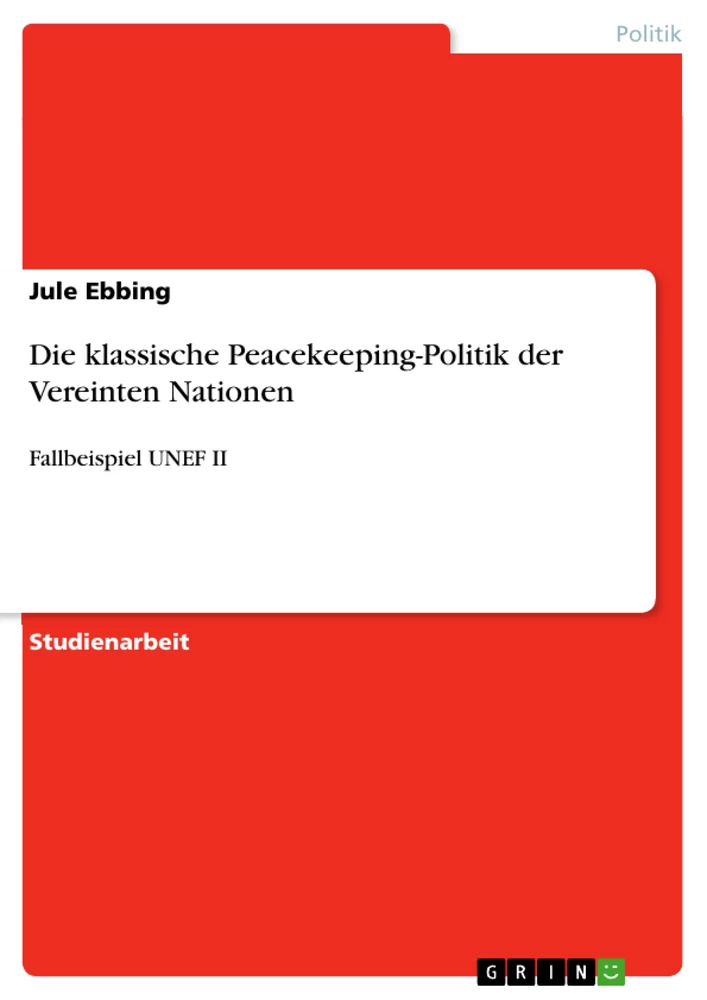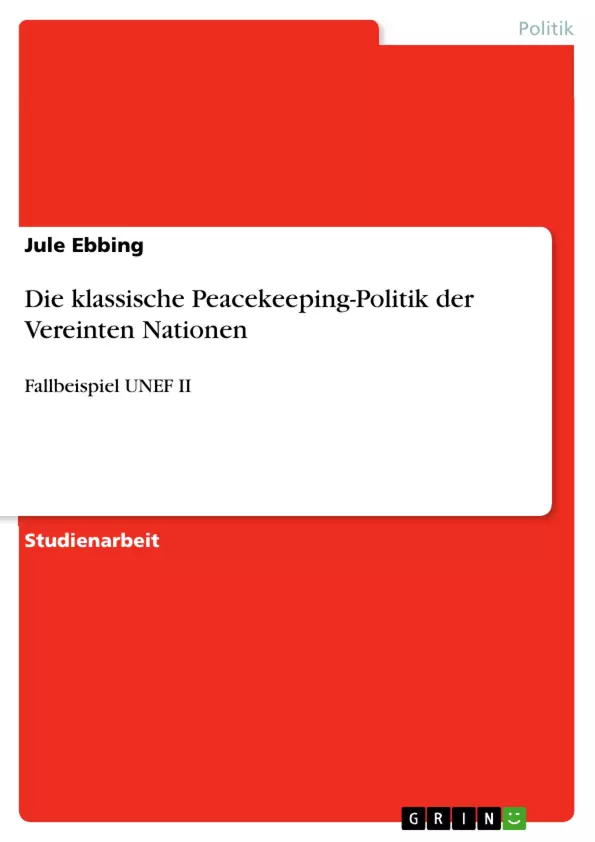Die Politik der Friedenssicherung der Vereinten Nationen wurde in ihren Anfängen vor allem durch den ehemaligen Generalsekretär Dag Hammarskjöld (1953-1961) geprägt, er definierte den Begriff des Peacekeeping mit Hilfe der UN-Charta, indem er das Instrument der Friedenssicherung als Mittelweg zwischen der in Kapitel VI festgeschriebenen friedlichen Konfliktlösung und den in Kapitel VII beschriebenen Zwangsmaßnahmen ansiedelte – laut Hammarskjöld fällt Peacekeeping also unter „Kapitel VI ½“ der Charta.
Vor allem in Zeiten des Kalten Krieges fand er hierdurch einen Weg, die Unstimmigkeiten innerhalb des Sicherheitsrates – vor allem zwischen den ständigen Mitgliedern USA und UdSSR – weitestgehend zu umgehen, indem er friedensstiftende Einsätze der UN auf freiwilliger Basis initiierte.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Form dieser klassischen Peacekeeping-Missionen und versucht deren Grundsätze und Leitlinien anhand der UNEF II-Mission, die von 1973-1979 den Frieden zwischen Israel und Ägypten sichern sollte, aufzuzeigen.
Insbesondere soll der Fragestellung nachgegangen werden, inwiefern die von Kurt Waldheim 1973 formulierten Grundsätze und Leitlinien der United Nations Emergency Force denen des klassischen Peacekeeping entsprechen. Somit soll aufgezeigt werden, dass der UNEF II-Einsatz als Exempel für die klassischen friedenssichernden UNEinsätze gelten kann.
Zunächst werden hierzu die allgemeinen Grundsätze der UN und ihr Friedensbegriff aufgegriffen, um die in Kapitel VI und VII der Charta aufgeführten Mittel zur Konfliktbeilegung im Folgenden erläutern zu können.
Auf dieser Basis werden die Grundsätze der klassischen Peacekeeping-Operationen dargelegt. Als Grundlage für die in Kapitel 4 anschließenden Überlegungen zu UNEF II, werden anschließend die historischen Hintergründe – der Sechstage- und Jom Kippur-Krieg – als Auslöser für den UN-Einsatz geschildert.
Abschließend folgt die Auseinandersetzung mit den von Waldheim formulierten Vorgaben für UNEF II, bei der diese an den Leitlinien des klassischen Peacekeeping gemessen und bewertet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Die Peacekeeping-Politik der Vereinten Nationen.
- Grundsätze und Friedensbegriff der Vereinten Nationen ..
- Kapitel VI der Charta: Friedliche Konfliktlösung .
- Kapitel VII der Charta: Zwangsmaßnahmen
- Grundsätze des klassischen Peacekeeping.……..……………..\n
- Historischer Hintergrund – vom Sechstage- zum Jom Kippur-Krieg .……………………………….\n
- Grundsätze und Leitlinien der UNEF II-Mission und die Peacekeeping-\nPolitik der UN..
- Resümee
- Literaturverzeichnis ....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der klassischen Peacekeeping-Politik der Vereinten Nationen und untersucht deren Grundsätze und Leitlinien anhand des Fallbeispiels UNEF II. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, inwieweit die von Kurt Waldheim 1973 formulierten Vorgaben für die United Nations Emergency Force den Prinzipien des klassischen Peacekeeping entsprechen. Ziel ist es, aufzuzeigen, dass der UNEF II-Einsatz als Beispiel für die traditionellen friedenssichernden UN-Einsätze gelten kann.
- Die Grundsätze und der Friedensbegriff der Vereinten Nationen
- Die Konfliktlösungsmöglichkeiten nach Kapitel VI und VII der UN-Charta
- Die Grundsätze des klassischen Peacekeeping
- Der historische Hintergrund des UNEF II-Einsatzes: Der Sechstage- und Jom Kippur-Krieg
- Die Vorgaben für UNEF II im Kontext der Leitlinien des klassischen Peacekeeping
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der klassischen Peacekeeping-Politik der Vereinten Nationen ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Rolle des ehemaligen Generalsekretärs Dag Hammarskjöld bei der Definition des Peacekeeping-Begriffs und die Bedeutung der UN-Charta in diesem Kontext. Kapitel 2 behandelt die allgemeinen Grundsätze der Vereinten Nationen und ihren Friedensbegriff. Es werden die in Kapitel I und II der Charta festgehaltenen Prinzipien, insbesondere die Pflicht zur friedlichen Streitbeilegung, das Gewaltverbot und das Interventionsverbot, erläutert.
Kapitel 3 analysiert die historischen Hintergründe des UNEF II-Einsatzes, indem es die Ereignisse des Sechstagekriegs und des Jom Kippur-Krieges beschreibt. Diese beiden Konflikte bilden den Rahmen für die Peacekeeping-Mission der Vereinten Nationen.
Schlüsselwörter
Peacekeeping, Vereinte Nationen, UN-Charta, Kapitel VI, Kapitel VII, Friedliche Konfliktlösung, Zwangsmaßnahmen, UNEF II, Sechstagekrieg, Jom Kippur-Krieg, Kurt Waldheim, klassische Peacekeeping-Missionen, Grundsätze, Leitlinien.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Kapitel VI ½“ der UN-Charta?
Dag Hammarskjöld definierte Peacekeeping als Mittelweg zwischen der friedlichen Konfliktlösung (Kapitel VI) und Zwangsmaßnahmen (Kapitel VII).
Was war das Ziel der UNEF II-Mission?
Die Mission sollte von 1973 bis 1979 den Frieden zwischen Israel und Ägypten nach dem Jom-Kippur-Krieg sichern.
Was sind die Grundsätze des klassischen Peacekeeping?
Dazu gehören das Einverständnis der Konfliktparteien, die Unparteilichkeit der UN-Truppen und die Anwendung von Gewalt nur zur Selbstverteidigung.
Welche Rolle spielte Kurt Waldheim bei UNEF II?
Waldheim formulierte 1973 die Leitlinien für die Mission, die als Exempel für die klassischen friedenssichernden Einsätze der Vereinten Nationen gelten.
Warum war Peacekeeping im Kalten Krieg so wichtig?
Es erlaubte der UN, bei Konflikten zu intervenieren, ohne direkt in die Machtkämpfe zwischen den USA und der UdSSR im Sicherheitsrat verwickelt zu werden.
- Quote paper
- Jule Ebbing (Author), 2012, Die klassische Peacekeeping-Politik der Vereinten Nationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200352