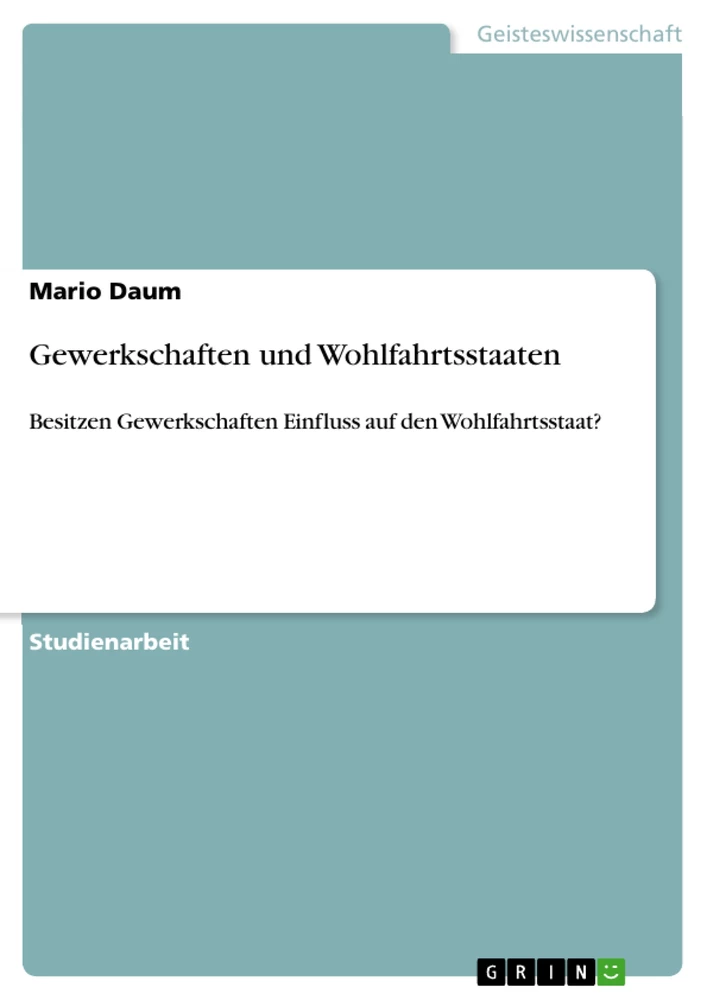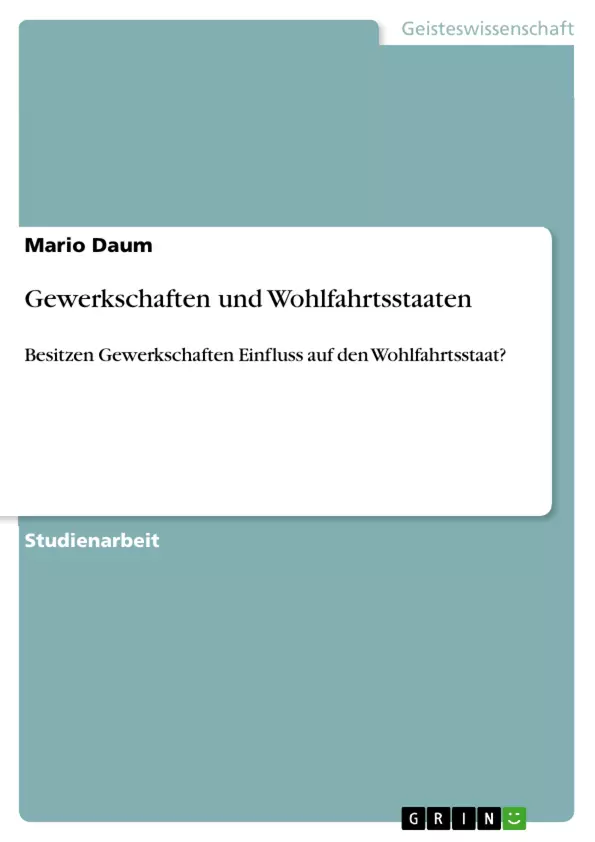In dieser Hausarbeit wird der Einfluss von Gewerkschaften auf den Wohlfahrtsstaat in Form einer Drei-Länderstudie untersucht. Der Autor zeigt anhand der Untersuchung des britischen, deutschen und schwedischen Sozialsystems, welchen Einfluss Gewerkschaften tatsächlich besitzen und wie sich dieser über die Zeit entwickelt hat. Die Länderauswahl stellt die von Esping-Andersen vorgenommen Typologie der Wohlfahrtsstaatsregime (sozialversicherungsbasiert, residual, universalistisch) dar.
In der Analyse stellt der Autor dar, welche Auswirkungen der Rückgang des gewerkschaftlichen Organisationsgrades auf die Entwicklungen innerhalb des Wohlfahrtsstaats besitzen. Hierzu wird die Armutsentwicklung, die Entwicklung der Sozialen Ungleichheit und der Organisationsgrad in Deutschland, Großbritannien und Schweden in den Jahren 1990, 2000 und 2010 verglichen.
Der Autor stellt die Hypothese auf, dass starke Gewerkschaften mit vielfältigen Einflussmöglichkeiten einen großen Einfluss auf die Gestaltung des Wohlfahrtsstaates besitzen und somit die Armut und die Soziale Ungleichheit reduziert wird. Überraschenderweise kann diese Hypothese nicht bestätigt werden, wie in den ausführlichen Analysen deutlich gemacht wird.
Dennoch sind einheitliche Trends, die mit dem Machtverlust der Gewerkschaften einhergehen, in allen drei Ländern ersichtlich.
Der Autor steuert mit seiner Arbeit einen wertvollen Beitrag zur Untersuchung des Sozialstaats und seiner Verbindung mit der Arbeiterbewegung bei.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Subsysteme und die Funktion der Gewerkschaften
- 2.1 Die Subsysteme - Arbeitsbeziehungen & Wohlfahrtsstaat
- 2.2 System der Arbeitsbeziehung und Wohlfahrtsstaat.
- 2.3 Sozialpolitische Funktionen der Gewerkschaften.
- 3 Idealtypen, Länder und Indikatoren
- 3.1 Idealtypen
- 3.2 Länderstudien
- 3.3 Zwischenfazit & Hypothesen
- 4 Analysen
- 4.1 Indikatoren des Einflusses
- 4.2 Analysen
- 4.3 Länderbezogene Ergebnisse
- 4.4 Fazit
- 5 Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Gewerkschaften auf den Wohlfahrtsstaat. Sie analysiert, ob und inwiefern Gewerkschaften die staatliche Wohlfahrtspolitik beeinflussen können und welche Systemeigenschaften und Organisationseigenschaften die Einflussmöglichkeiten von Gewerkschaften bestimmen.
- Die Rolle der Gewerkschaften in der Entstehung und Entwicklung des Wohlfahrtsstaats
- Die Funktionen der Gewerkschaften im Bereich der Sozialpolitik
- Der Einfluss von Gewerkschaften auf Armut und Ungleichheit
- Die Auswirkungen von unterschiedlichen Subsystemen auf die Einflussmöglichkeiten von Gewerkschaften
- Die Bedeutung von gewerkschaftlichem Organisationsgrad und anderen Organisationseigenschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der Arbeit ein und beleuchtet die Bedeutung von Gewerkschaften für den Wohlfahrtsstaat. Es wird die Forschungsfrage formuliert und die Methode der Untersuchung erläutert.
Kapitel 2 analysiert das Subsystem der Arbeitsbeziehungen und des Wohlfahrtsstaats und beleuchtet die historische Entwicklung des Wohlfahrtsstaats und die Einwirkung der Gewerkschaften. Zudem werden die Funktionen der Gewerkschaften innerhalb des Wohlfahrtsstaats herausgearbeitet.
Kapitel 3 präsentiert die Methodik der empirischen Untersuchung anhand von drei Ländern: Deutschland, Großbritannien und Schweden. Es werden Idealtypen der Wohlfahrtsstaaten vorgestellt und die Zuordnung der Beispielländer zu den (Ideal-)Typen erläutert.
Kapitel 4 analysiert die empirischen Daten und stellt die Ergebnisse der Untersuchung dar. Es werden Indikatoren für den Einfluss von Gewerkschaften auf den Wohlfahrtsstaat erörtert und länderbezogene Ergebnisse präsentiert.
Schlüsselwörter
Gewerkschaften, Wohlfahrtsstaat, Sozialpolitik, Einflussfaktoren, Systemeigenschaften, Organisationseigenschaften, Organisationsgrad, Armut, Ungleichheit, Länderstudie, Deutschland, Großbritannien, Schweden.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss haben Gewerkschaften auf die soziale Ungleichheit?
Die Arbeit untersucht die Hypothese, dass starke Gewerkschaften Armut und Ungleichheit reduzieren. Überraschenderweise konnte dies in der Drei-Länderstudie nicht eindeutig bestätigt werden.
Welche Länder werden in der Studie verglichen?
Die Studie vergleicht Deutschland, Großbritannien und Schweden, um unterschiedliche Wohlfahrtsstaatsregime (sozialversicherungsbasiert, residual, universalistisch) zu analysieren.
Was passiert, wenn der gewerkschaftliche Organisationsgrad sinkt?
Die Analyse zeigt, dass ein Machtverlust der Gewerkschaften mit einheitlichen Trends in der Entwicklung des Wohlfahrtsstaats in allen drei untersuchten Ländern einhergeht.
Was sind die sozialpolitischen Funktionen von Gewerkschaften?
Gewerkschaften wirken nicht nur auf die Löhne ein, sondern fungieren auch als Akteure in der Gestaltung staatlicher Sozialpolitik und der sozialen Sicherungssysteme.
Wie unterscheiden sich die Wohlfahrtsstaats-Typen nach Esping-Andersen?
Es wird zwischen dem liberalen (Großbritannien), dem konservativen (Deutschland) und dem sozialdemokratischen (Schweden) Modell unterschieden, die jeweils andere Rollen für Gewerkschaften vorsehen.
Welcher Zeitraum wird in den Analysen betrachtet?
Die Studie vergleicht Daten aus den Jahren 1990, 2000 und 2010, um langfristige Entwicklungen sichtbar zu machen.
- Quote paper
- Mario Daum (Author), 2012, Gewerkschaften und Wohlfahrtsstaaten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200364