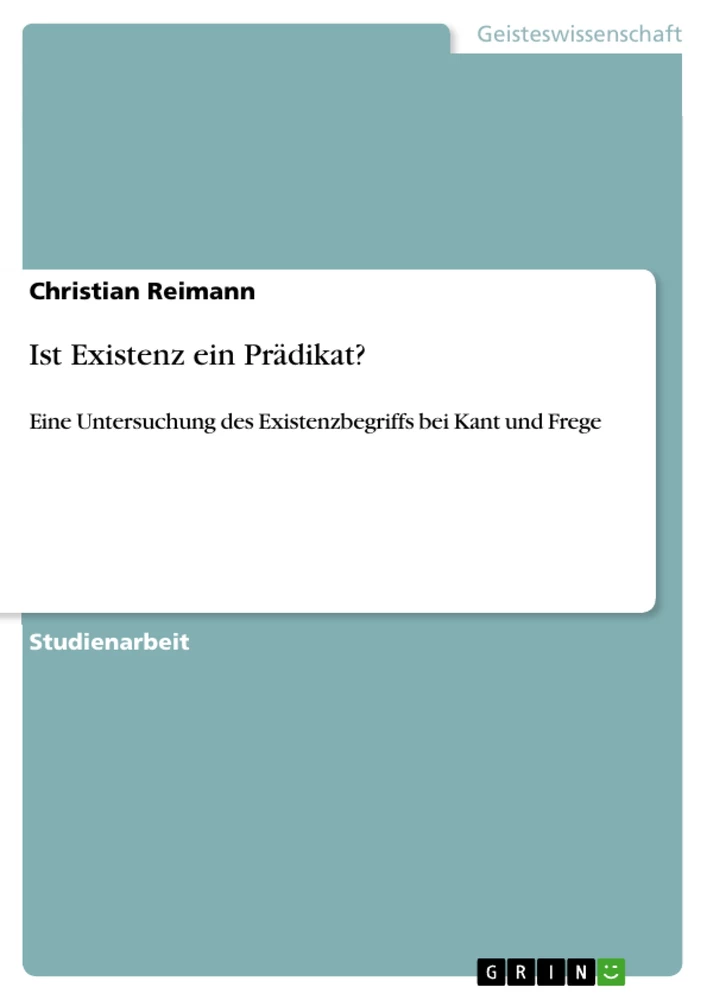Zu den zentralen Fragen in der Philosophie zählt die Frage, ob Existenz ein Prädikat ist. Hier sollte zunächst berücksichtigt werden, dass mit ‚Prädikat‘ kein grammatikalisches Prädikat gemeint ist; es steht daher nicht zur Debatte, ob das Vollverb ‚existieren‘ bei Eigenschaftszuschreibungen wie ‚ist ein Student‘ oder ‚ist fleißig‘ die grammatikalische Funktion des Kopula-Verbs erfüllt und damit eine grammatikalische Kategorie darstellt (vgl. auch Reicher 2005, S. 193). Gemeint ist stattdessen die Frage, ob Existenz eine Eigenschaft oder ein Merkmal ist, das individuellen Gegenständen zu- oder abgeschrieben werden kann. Denn wenn es so wäre, dann entspräche ein Satz der Form ‚a existiert‘ der logischen Form ‚Fa‘, wobei ‚F‘ ein genereller Term zur Bezeichnung eines Prädikatbegriffs und ‚a‘ einen singulären Term zur Bezeichnung eines bestimmten Individuums darstellt. Somit geht es bei der Frage, ob Existenz ein Prädikat sei, darum, ob Existenz vernünftigerweise als logisches Prädikat betrachtet werden kann. – Mit anderen Worten: Welche ist die angemessene logische Interpretation des Existenzbegriffs? (vgl. ebd.)
Die Beantwortung dieser Frage erfordert eine (logische) Analyse des Existenzbegriffs, die in der vorliegenden Arbeit auf der Grundlage von Texten Immanuel Kants beziehungsweise eines Texts von Gottlob Frege vorgenommen werden soll. Dabei wird folgende Untersuchungsfrage im Fokus des Interesses stehen: Wie interpretieren Kant und Frege den Existenzbegriff in logischer Hinsicht, und wie lassen sich ihre jeweiligen Positionen philosophisch beurteilen?
Den Beginn bildet Kants Analyse des Existenzbegriffs (vgl. 2.1.). Die Textgrundlage ist in diesem Zusammenhang der Abschnitt Von der Unmöglichkeit eines ontologischen Beweises vom Dasein Gottes aus der Kritik der reinen Vernunft (erste Auflage: 1781; zweite Auflage: 1787) sowie der erste Abschnitt Das Dasein ist gar kein Prädikat oder Determination von irgend einem Dinge aus der vorkritischen Abhandlung Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes (erste Auflage: 1763; dritte Auflage: 1783). Anschließend wird der Existenzbegriff bei Gottlob Frege anhand des Textes Funktion und Begriff (1891) (vgl. 2.2.) untersucht. Die jeweiligen Ergebnisse beider Analysen werden dabei in den entsprechenden Abschnitten hinsichtlich ihrer philosophischen Relevanz betrachtet und entsprechend kritisch beurteilt. Die Untersuchung endet mit einer Zusammenfassung (vgl. 3.).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ist Existenz ein logisches Prädikat?
- Kants Analyse des Existenzbegriffs
- Existenz als Begriff zweiter Stufe
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage, ob Existenz ein Prädikat ist, anhand der philosophischen Positionen von Immanuel Kant und Gottlob Frege. Ziel ist es, die jeweiligen Interpretationen des Existenzbegriffs in logischer Hinsicht zu analysieren und ihre philosophische Relevanz zu beurteilen.
- Analyse des Existenzbegriffs bei Kant im Kontext des ontologischen Gottesbeweises
- Untersuchung der Frage, ob Existenz ein Prädikat ist, und ihre Bedeutung für die Kritik am ontologischen Gottesbeweis
- Beurteilung der philosophischen Relevanz der jeweiligen Positionen von Kant und Frege
- Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse und deren Bedeutung für die Frage, ob Existenz ein logisches Prädikat ist
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel führt in die zentrale Frage der Arbeit ein: Ist Existenz ein Prädikat? Es stellt den Kontext der Debatte dar und erläutert den Unterschied zwischen grammatikalischem und logischem Prädikat. Außerdem wird die Vorgehensweise der Arbeit und die zu analysierenden Texte vorgestellt.
- Ist Existenz ein logisches Prädikat?: Dieses Kapitel analysiert den Existenzbegriff anhand der Positionen von Kant und Frege. Es beginnt mit Kants Kritik am ontologischen Gottesbeweis und untersucht seine Argumentation, warum Existenz kein Prädikat ist. Die Analyse bezieht sich dabei auf Kants Kritik der reinen Vernunft und seine vorkritische Abhandlung Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Existenz, Prädikat, ontologischer Gottesbeweis, Kant, Frege, Logik, Philosophie, Begriffsanalyse. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, ob Existenz ein logisches Prädikat ist und untersucht diese Frage anhand der Positionen von Kant und Frege.
Häufig gestellte Fragen
Ist Existenz ein logisches Prädikat?
Dies ist eine zentrale philosophische Frage. Die Arbeit untersucht, ob Existenz eine Eigenschaft ist, die Gegenständen wie andere Merkmale zu- oder abgeschrieben werden kann.
Was war Immanuel Kants Position zu diesem Thema?
Kant argumentierte, dass „Dasein“ kein reales Prädikat ist, da es dem Begriff eines Dinges nichts hinzufügt, sondern lediglich die Setzung des Dinges mit all seinen Prädikaten ausdrückt.
Wie interpretierte Gottlob Frege den Existenzbegriff?
Frege betrachtete Existenz als einen Begriff zweiter Stufe, also als eine Eigenschaft von Begriffen und nicht von Gegenständen.
Warum ist diese Frage für den ontologischen Gottesbeweis wichtig?
Wenn Existenz kein Prädikat ist, kann sie nicht als notwendige Eigenschaft in die Definition Gottes aufgenommen werden, was den Kern des ontologischen Gottesbeweises erschüttert.
Was ist der Unterschied zwischen grammatikalischem und logischem Prädikat?
Grammatikalisch kann „existieren“ ein Prädikat sein, logisch gesehen geht es jedoch darum, ob es eine inhaltliche Eigenschaft eines Individuums darstellt.
- Arbeit zitieren
- Christian Reimann (Autor:in), 2012, Ist Existenz ein Prädikat?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200380