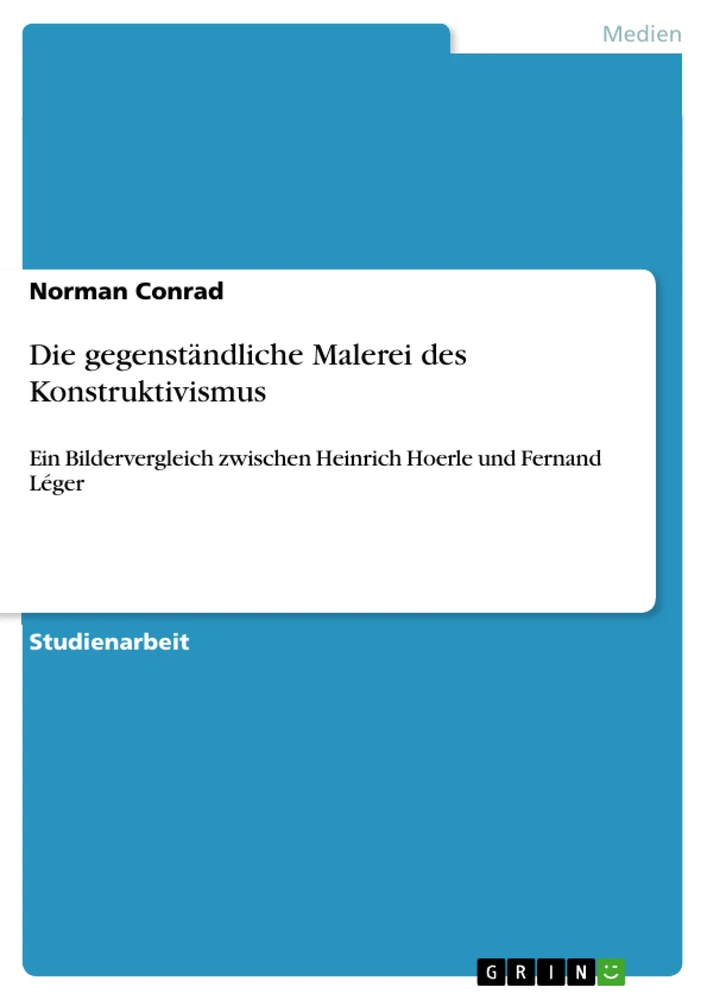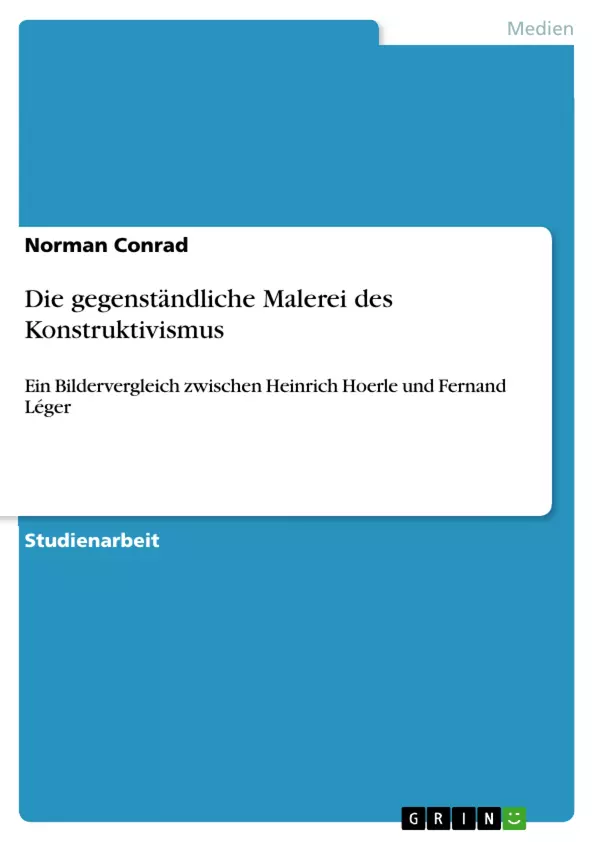Léger sagte, dass „[j]ede objektive Schöpfung des Menschen [strengsten] geometrischen Gesetzen [untersteht], und ganz gleich […]es sich auch mit den Schöpfungen der Kunst [verhält].“1 Léger plädiert hier auf Allgemeingültigkeit und steht damit für den gegenständlichen Konstruktivismus. 2 Im Mittelpunkt steht ein Vergleich zwischen einem deutschen Vertreter des gegenständlichen Konstruktivismus, Heinrich Hoerle, und einem französischem Vertreter des gegenständlichen Konstruktivismus, Fernand Léger. Der Bildvergleich bezieht sich auf die Kunst der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Historische Voraussetzungen des gegenständlichen Konstruktivismus waren Grundlage und wurden von Hoerle und Léger in ihren Bildern verarbeitet. Ausgangspunkt des Bildvergleichs ist das Verhältnis der Konstruktivisten zur Technik. In diesem Zusammenhang wird untersucht, welche wesentlichen gestalterischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede beide Künstler aufzeigen und ob es ihnen gelang ihre Vorstellungen von Kunst und Gesellschaft in ihren Bildern zum Ausdruck zu bringen. 1 Helfenstein, Josef: Die Sprache der Geometrie: Suprematismus, De Stijl und Umkreis – heute, Bern 1984, hier zit. S. 92. 2 Konstruktivismus ist eine im Wesentlichen abstrakte, nach geometrischen Gesetzmäßigkeiten konstruierte Kunst, die sich auf Wissenschaft, Technik und Forschung beruft („Ingenieurkunst“). (Vgl. Steingräber, Erich u. a. (Hg.), Deutsche Kunst der 20er und 30er Jahre. München 1979, S. 74.)
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Die Malerei des gegenständlichen Konstruktivismus
- 1.1 Kunst und Technik in den 20er Jahren
- 1.2 Technikbegeisterung und Technikfeindschaft
- 2. Politischer Konstruktivismus
- 2.1 Künstlergruppe Kölner Progressive
- 2.2 Heinrich Hoerle: „Arbeiter“ (Selbstbildnis vor Bäumen und Schornsteinen)
- 3. Französischer Konstruktivismus
- 3.1 Fernand Léger: „Le Mécanicien“ (Der Mechaniker)
- 1. Die Malerei des gegenständlichen Konstruktivismus
- III. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen Vergleich der gegenständlichen Malerei von Heinrich Hoerle und Fernand Léger im Kontext des Konstruktivismus der 1920er und 1930er Jahre durchzuführen. Der Fokus liegt auf der Analyse des Verhältnisses beider Künstler zur Technik und der Darstellung ihrer jeweiligen Vorstellungen von Kunst und Gesellschaft in ihren Werken.
- Das Verhältnis der Konstruktivisten zur Technik im Spannungsfeld von Technikbegeisterung und -feindschaft
- Die Darstellung von Mensch und Maschine in der Kunst Hoerles und Légers
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede im künstlerischen Stil und der Bildsprache
- Die soziale und politische Dimension des gegenständlichen Konstruktivismus
- Die Rolle der Kunst im Industriezeitalter
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des gegenständlichen Konstruktivismus ein und benennt den Vergleich zwischen Heinrich Hoerle und Fernand Léger als zentralen Gegenstand der Arbeit. Sie hebt die Bedeutung des Verhältnisses beider Künstler zur Technik hervor und skizziert die Fragestellung nach gestalterischen Gemeinsamkeiten und Unterschieden sowie der Ausdrucksweise ihrer Vorstellungen von Kunst und Gesellschaft in ihren Bildern. Léger’s Zitat über die geometrischen Gesetzmäßigkeiten objektiver Schöpfungen wird als Ausgangspunkt für die Betrachtung des gegenständlichen Konstruktivismus angeführt.
II. Hauptteil, Kapitel 1. Die Malerei des gegenständlichen Konstruktivismus: Dieses Kapitel untersucht das ambivalente Verhältnis der gegenständlichen Konstruktivisten zur Technik. Es beleuchtet die Sichtweise sozialistisch orientierter Künstler wie Hoerle, die die Technik sowohl als Befreiungs- als auch als Unterdrückungsinstrument sahen. Die Darstellung des Zusammenhangs von Mensch und Technik wird als zentrales Anliegen dieser Künstler hervorgehoben, wobei die Maschine sowohl als ein Mittel zur Befreiung der Arbeiterklasse als auch als ein Instrument des kapitalistischen Systems zur Unterdrückung der Arbeiterschaft gesehen wird. Der konstruktivistische Stil wird als geeignete Ausdrucksform des Industriezeitalters interpretiert.
II. Hauptteil, Kapitel 2. Politischer Konstruktivismus: Dieses Kapitel befasst sich mit dem politischen Konstruktivismus und der Künstlergruppe Kölner Progressive. Es wird auf die Kunst Heinrich Hoerles, insbesondere sein Selbstbildnis „Arbeiter“, eingegangen. Eine detaillierte Analyse dieser Bilder und deren Kontexte soll die politische und soziale Botschaft der Kunst Hoerles herausarbeiten und den Zusammenhang zwischen seinem künstlerischen Schaffen und dem politischen Klima der Zeit beleuchten. Der Fokus liegt wahrscheinlich auf der Darstellung der Arbeiterklasse und ihrer Stellung in der Gesellschaft.
II. Hauptteil, Kapitel 3. Französischer Konstruktivismus: Dieses Kapitel analysiert den französischen Konstruktivismus und konzentriert sich auf das Werk Fernand Légers, speziell auf sein Gemälde „Le Mécanicien“. Die Analyse zielt darauf ab, Légers künstlerische Auseinandersetzung mit der Technik und der modernen Gesellschaft darzustellen und diese mit der Arbeit Hoerles zu vergleichen. Die Untersuchung soll Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung von Mensch und Maschine und in der jeweiligen künstlerischen Umsetzung der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse aufzeigen.
Schlüsselwörter
Gegenständlicher Konstruktivismus, Heinrich Hoerle, Fernand Léger, Technik, Industriezeitalter, Mensch und Maschine, politische Kunst, soziale Kritik, Kölner Progressive, Bildvergleich, 20er und 30er Jahre.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gegenständlicher Konstruktivismus bei Heinrich Hoerle und Fernand Léger
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die gegenständliche Malerei von Heinrich Hoerle und Fernand Léger im Kontext des Konstruktivismus der 1920er und 1930er Jahre. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis beider Künstler zur Technik und der Darstellung ihrer Vorstellungen von Kunst und Gesellschaft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht das Verhältnis der Konstruktivisten zur Technik (Technikbegeisterung und -feindschaft), die Darstellung von Mensch und Maschine in der Kunst Hoerles und Légers, Gemeinsamkeiten und Unterschiede im künstlerischen Stil, die soziale und politische Dimension des gegenständlichen Konstruktivismus und die Rolle der Kunst im Industriezeitalter.
Welche Künstler werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Werke von Heinrich Hoerle (mit besonderem Fokus auf sein Selbstbildnis „Arbeiter“) und Fernand Léger (mit besonderem Fokus auf sein Gemälde „Le Mécanicien“).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil (mit den Kapiteln: Die Malerei des gegenständlichen Konstruktivismus, Politischer Konstruktivismus und Französischer Konstruktivismus) und eine Schlussbemerkung. Der Hauptteil analysiert das ambivalente Verhältnis der Konstruktivisten zur Technik, den politischen Konstruktivismus und die Künstlergruppe Kölner Progressive, sowie den französischen Konstruktivismus.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Gegenständlicher Konstruktivismus, Heinrich Hoerle, Fernand Léger, Technik, Industriezeitalter, Mensch und Maschine, politische Kunst, soziale Kritik, Kölner Progressive, Bildvergleich, 20er und 30er Jahre.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist ein Vergleich der gegenständlichen Malerei von Hoerle und Léger, um deren jeweilige Auseinandersetzung mit Technik, Kunst und Gesellschaft zu analysieren und Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
Welche Quellen werden verwendet? (nicht explizit im Text, aber implizit)
Die Arbeit stützt sich auf die Analyse der Werke von Hoerle und Léger, sowie auf den Kontext des Konstruktivismus der 1920er und 30er Jahre. Weitere Quellen sind implizit in der detaillierten Analyse der Bilder und der Erwähnung der „Kölner Progressive“ enthalten.
- Arbeit zitieren
- Norman Conrad (Autor:in), 2009, Die gegenständliche Malerei des Konstruktivismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200457