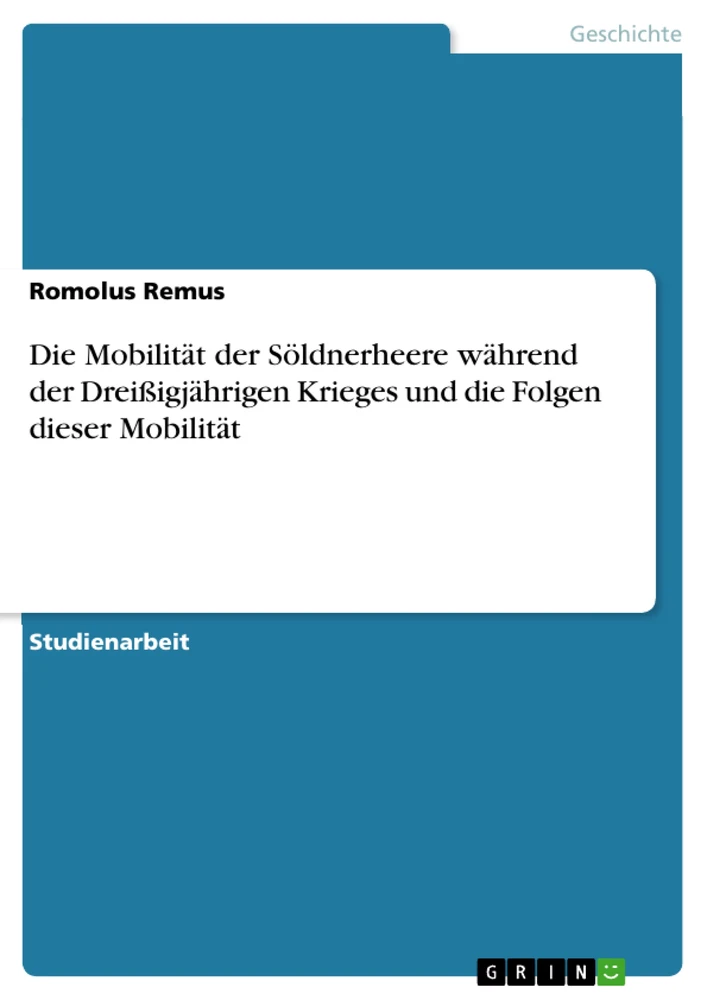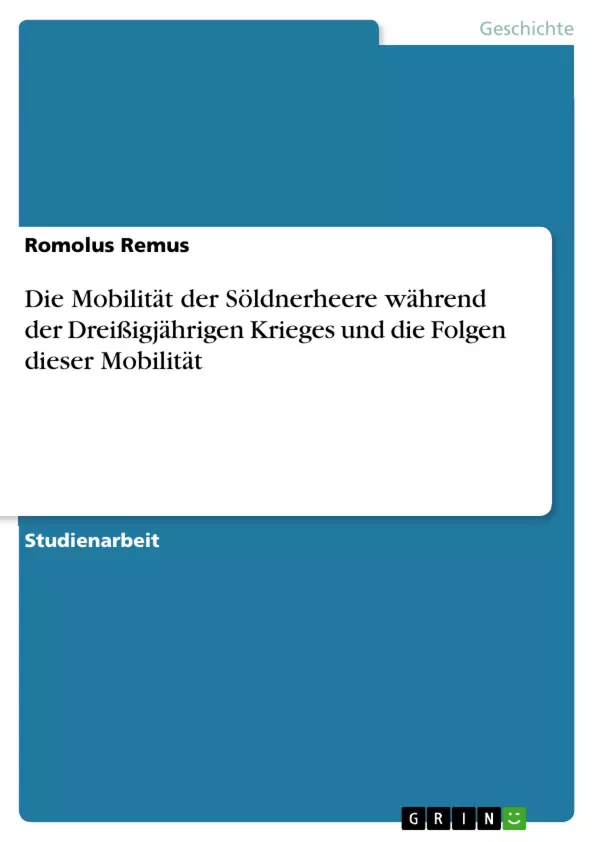Der Dreißigjährige Krieg wurde vor über 300 Jahren in Münster und Osnabrück mit dem Westfälischen Frieden für beendet erklärt, und trotzdem spüren wir seine Folgen bis heute. Nicht nur weil er die deutsche Kleinstaaterei mit Fürstentümern, Herzogtümern und Königreichen für viele weitere Jahre zementierte und Europa theologisch trennte, sondern auch weil er das Sinnbild für den ersten entfesselten europäischen Großkonflikts ist. Ein Krieg, der sich mehr und mehr verselbstständigte und sich kaum noch stoppen ließ. Auch die flächendeckende Verwüstung und das Vorgehen der Söldnerheere waren neu. Zwar lebten schon früher Söldnerheere aus dem besetzten Land, im Dreißigjährigen Krieg nahm diese Praxis aber völlig neue Maßstäbe an und wurde zur Kriegstaktik. Wallensteins berühmte Aussage „Der Krieg ernährt den Krieg“ fasst dieses Vorgehen kurz und bündig zusammen. Der Dreißigjährige Krieg war aber auch eine Zäsur in der Kriegsführung, war er doch das letzte Aufbäumen der großen Söldnerheere. Später gingen Staaten dazu über, eigene Berufsheere aufzustellen und stellten die Praxis ein, im Kriegsfall fremde Söldner unterschiedlichster Herkunft, Konfession und Motivation anzuwerben.
Mitten in diesem dreißig Jahre andauernden Inferno auf deutschem Boden schrieb der langjährige Söldner Peter Hagendorf sein Tagebuch und macht es uns heute möglich nicht nur die Gedankenwelt der Adligen, hohen Offiziere und Generälen während des Krieges zu verstehen, sondern auch die des einfachen Söldners. Sein Tagebuch, welches erst Mitte der 80er Jahre , also etwa 330 Jahre später, in der Preußischen Staatsbibliothek Berlin gefunden wurde, vermittelt uns ein völlig anderes Bild des Krieges, ein hautnahes, weniger pathetisches und relativ ideologiefreies.
Dieses Tagebuch ist für diese Hausarbeit die Hauptquelle und die einzige realitätsnahe Schilderung des Lebens eines Söldners während des Dreißigjährigen Krieges . Anhand dieser Quelle will ich herausfinden, welche Folgen die ständige Mobilität für die Söldner hatte und wie das Leben des einfachen Fußvolks war. Was waren die sozialen, psychologischen und persönlichen Folgen für die Söldner, die über dreißig Jahre von Ort zu Ort zogen, um zu töten, getötet zu werden, um für das eigene Überleben oder für persönliche Vorteile zu kämpfen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenkritik
- Äußere Quellenkritik
- Der Autor der Quelle
- Entstehungsdatum und Entstehungsort der Quelle
- Der Adressat der Quelle
- Zweck und Funktion der Quelle
- Kategorie der Quelle
- Überlieferungsart der Quelle
- Innere Quellenkritik
- Quellensyntax
- Quellensemantik- und Ikonographie
- Quellenpragmatik
- Interpretation der Quelle bezüglich der eigenen Fragestellung
- Äußere Quellenkritik
- Schluss
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Mobilität der Söldnerheere während des Dreißigjährigen Krieges und untersucht die Folgen dieser Mobilität für das Leben der einfachen Söldner. Im Mittelpunkt steht die Analyse des Tagebuchs des Söldners Peter Hagendorf, welches einen einzigartigen Einblick in die Lebenswelt und die Herausforderungen der Söldner während des Krieges bietet.
- Die Mobilität der Söldnerheere als kriegerische Taktik im Dreißigjährigen Krieg
- Die Folgen der Mobilität für die Söldner: Soziale, psychologische und persönliche Auswirkungen
- Das Leben des einfachen Fußvolks im Söldnerheer: Arbeitsbedingungen, Lebensumstände, soziale Beziehungen
- Die Rolle von Peter Hagendorfs Tagebuch als einzigartige Quelle für die Erforschung der Söldnergeschichte
- Die Bedeutung der Quellenkritik für die Interpretation historischer Quellen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema des Dreißigjährigen Krieges und die Rolle der Söldnerheere ein. Sie stellt das Tagebuch des Söldners Peter Hagendorf als Hauptquelle für die Arbeit vor und erläutert die Forschungsfrage nach den Folgen der Mobilität für die Söldner.
Quellenkritik
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Analyse der Quelle, Peter Hagendorfs Tagebuch, und behandelt sowohl die äußere als auch die innere Quellenkritik. Es wird die Autorschaft, das Entstehungsdatum, den Adressaten und den Zweck der Quelle untersucht, sowie die Quellensyntax, -semantik und -pragmatik analysiert.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Söldnerheere im Dreißigjährigen Krieg?
Söldnerheere waren die zentrale militärische Kraft. Sie lebten oft vom Land nach dem Prinzip „Der Krieg ernährt den Krieg“, was zu flächendeckender Verwüstung führte.
Wer war Peter Hagendorf und warum ist sein Tagebuch wichtig?
Peter Hagendorf war ein einfacher Söldner. Sein Tagebuch ist eine einzigartige, realitätsnahe Quelle, die das Leben und die Gedankenwelt des einfachen Fußvolks im Krieg beschreibt.
Welche Folgen hatte die ständige Mobilität für die Söldner?
Die Mobilität hatte tiefgreifende soziale, psychologische und persönliche Auswirkungen auf die Söldner, die über Jahrzehnte hinweg von Ort zu Ort zogen.
Was bedeutet der Ausspruch „Der Krieg ernährt den Krieg“?
Dieser Wallenstein zugeschriebene Satz beschreibt die Taktik, dass sich Armeen durch Plünderungen und Kontributionen aus den besetzten Gebieten selbst versorgen.
Wie veränderte sich die Kriegsführung nach dem Dreißigjährigen Krieg?
Der Krieg markierte das Ende der großen Söldnerheere. Staaten gingen dazu über, eigene stehende Berufsheere aufzustellen, um mehr Kontrolle über das Militär zu erlangen.
- Arbeit zitieren
- Romolus Remus (Autor:in), 2012, Die Mobilität der Söldnerheere während der Dreißigjährigen Krieges und die Folgen dieser Mobilität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200599