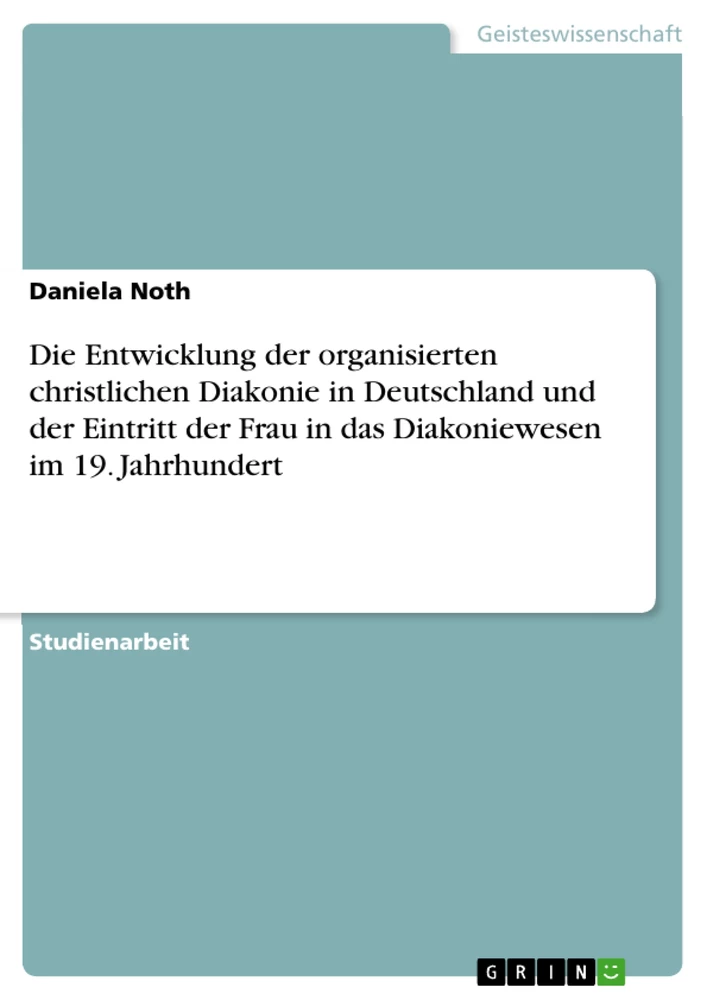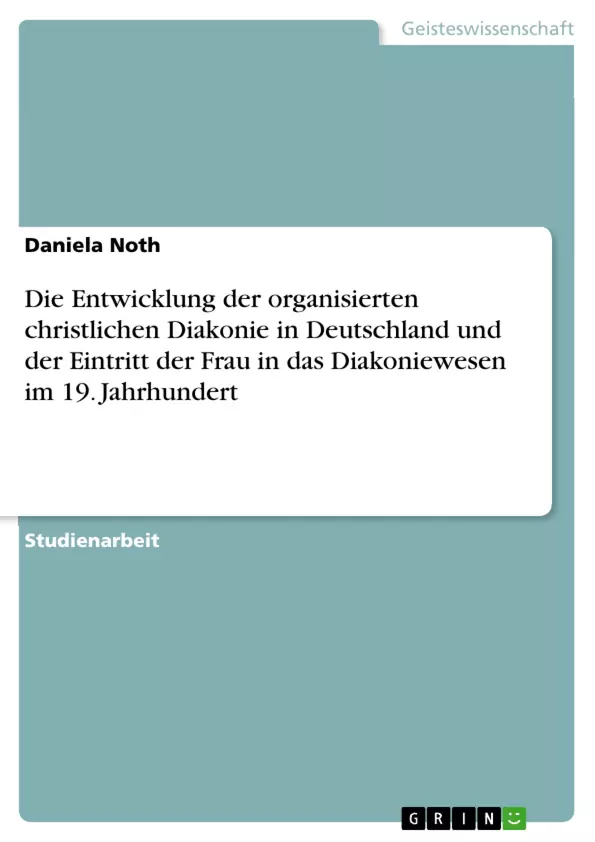Der diakonische Auftrag zu Hilfe und Nächstenliebe obliegt einer langen Tradition, nicht zuletzt aufgrund biblischer Weisungen und Überlieferungen. In welcher Form und Ausprägung dieser Hilfsauftrag jedoch - persönlich sowie institutionell - zu allen Zeiten verstanden und gelebt wurde unterliegt einer wechselhaften Entwicklung. Auch wer diese Hilfen in Anspruch nahm und - insbesondere - wer Hilfe leistete bzw. leisten durfte änderte sich im Laufe der Diakonieentwicklung. So wurden Frauen eben erst spät zu „offiziellen“ und gesellschaftlich anerkannten Mitarbeiterinnen in verschiedenen diakonischen Handlungs-räumen. Heute sind Frauen und Männer in den verschiedensten Bereichen diakonisch tätig - auch die Diakonie selbst hat viele unterschiedliche „Gesichter“: sie kann organisiert sowie spontan sein; sie kann in einer dauerhaft bestehenden Institution oder situativ wechselnden Hilfeleistung erfolgen; sie kann durch Ehrenamtliche oder beruflich Angestellte ausgeübt werden; es gibt offizielle und private Diakonie; mittlerweile kann sie kirchlich sowie außerkirchlich verortet sein; u.v.m. Diese heutige Vielschichtigkeit und Vielgestaltigkeit bezeugt meines Erachtens einerseits die lange Tradition der Diakonie, andererseits (und damit verbunden) die hohe Relevanz einer christlich motivierten Diakonie für die Gesellschaft und zuletzt eben auch die zu vielen Zeiten bewusst praktizierte Auseinandersetzung und Reflexion der diakonisch Tätigen, die ihre Rolle und Bedeutung immer wieder zu rechtfertigen und auszuloten suchten.
Im Rahmen dieser Arbeit soll neben einer kurzen Begriffsbestimmung zunächst der geschichtliche Verlauf von Altertum bis zur Inneren Mission im 19. Jahrhundert überblickend dargestellt werden, der zur Entstehung der organisierten christlichen Diakonie führte. Vertiefend soll dann auf die Bemühungen Theodor Fliedners eingegangen werden, der mit seiner Gründung einer Krankenpflegeanstalt erstmalig den Wert der Frauen für die Diakonie sowie auch den Wert der Diakonie als Existenzsicherung für die Frauen erkannte.
Am Ende soll schließlich eine kurze Bündelung von Erkenntnissen stehen, die aus der geschichtlichen Betrachtung hinsichtlich vergangener sowie heutiger Diakonie gewonnen werden konnten. Denn die Diskurse über Diakonie in der Gegenwart stehen letztlich in Zusammenhang mit ihrer historischen Werdung und können bzw. sollten nicht losgelöst davon geführt werden. (...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Diakonisches Handeln und Diakonie
- Diakonie - Versuch einer Begriffsbestimmung.
- Diakonie in der Gegenwartsgesellschaft.
- Die geschichtliche Entwicklung der christlichen Diakonie...
- Von Altertum bis Reichskirche
- Die Verbindung von Mönchtum und Diakonie im Mittelalter.
- Werkgerechtigkeit vs. Reformation..........\n
- Die Vorläufer der organisierten Diakonie im 17. und 18. Jahrhundert.
- Erweckung und Innere Mission im 19. Jahrhundert..
- Der Eintritt der Frauen in die organisierte Diakonie.
- Amalie Sieveking und erste Initiativen von Frauen
- Theodor Fliedners Beitrag zur Begründung des Diakonissenwesens
- Die Diakonissenarbeit Wilhelm Löhes...
- Die Krise im Diakonissenwesen..
- Erkenntnisse aus der historischen Betrachtung
- Grundlegende Beobachtungen.......
- Die Frau in der Diakonie
- Parallelen zur Diskussion um Diakonie in der Gegenwart..
- Literatur.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der geschichtlichen Entwicklung der organisierten christlichen Diakonie in Deutschland und beleuchtet dabei insbesondere den Eintritt der Frau in das Diakoniewesen im 19. Jahrhundert. Die Arbeit soll einen Überblick über die verschiedenen Phasen der Diakonieentwicklung geben, angefangen vom Altertum bis zur Inneren Mission im 19. Jahrhundert, und dabei die Rolle der Frau in diesem Prozess herausstellen.
- Begriffsdefinition von Diakonie im historischen Kontext
- Die Bedeutung von Diakonie in der Gegenwartsgesellschaft
- Entwicklung der organisierten Diakonie von der Antike bis zum 19. Jahrhundert
- Der Einfluss von Amalie Sieveking und Theodor Fliedner auf die Etablierung des Diakonissenwesens
- Die Bedeutung der Frau in der Diakonie und ihre Rolle in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Relevanz der Diakonie im historischen Kontext dar. Es wird auf die Vielschichtigkeit des diakonischen Handelns und die unterschiedlichen Formen der Diakonie in der heutigen Zeit hingewiesen.
- Diakonisches Handeln und Diakonie: In diesem Kapitel wird der Begriff "Diakonie" näher betrachtet. Es werden verschiedene Aspekte des Begriffs erläutert, darunter das personale Verhältnis im diakonischen Handeln und die Bedeutung des Dienstes an Notleidenden.
- Die geschichtliche Entwicklung der christlichen Diakonie: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Diakonie von der Antike bis zum 19. Jahrhundert. Dabei werden verschiedene Epochen und deren Einfluss auf die Form und Ausprägung der Diakonie betrachtet.
- Der Eintritt der Frauen in die organisierte Diakonie: In diesem Kapitel wird der Fokus auf den Eintritt der Frauen in die organisierte Diakonie im 19. Jahrhundert gelegt. Es werden die Beiträge von Amalie Sieveking und Theodor Fliedner sowie die Entwicklung des Diakonissenwesens beschrieben.
Schlüsselwörter
Diese Hausarbeit konzentriert sich auf die Themen Diakonie, organisierte Diakonie, christliche Diakonie, Frauen in der Diakonie, Diakonissenwesen, Geschichte der Diakonie, Amalie Sieveking, Theodor Fliedner, Innerer Mission, und die Entwicklung der Diakonie im 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Diakonie“?
Diakonie bezeichnet den Dienst am Menschen in christlicher Nächstenliebe, der sowohl individuell als auch institutionell ausgeübt werden kann.
Wann traten Frauen offiziell in das Diakoniewesen ein?
Ein entscheidender Wendepunkt war das 19. Jahrhundert, insbesondere durch die Gründung von Diakonissenanstalten, die Frauen eine gesellschaftlich anerkannte Tätigkeit ermöglichten.
Wer war Theodor Fliedner?
Fliedner gründete 1836 die Diakonissenanstalt Kaiserswerth und erkannte als einer der Ersten den Wert der Frauen für die organisierte Krankenpflege und Diakonie.
Was war die „Innere Mission“?
Die von Johann Hinrich Wichern begründete Bewegung im 19. Jahrhundert zielte darauf ab, soziale Not innerhalb der christlichen Gesellschaft durch organisierte Hilfe zu lindern.
Welche Rolle spielte Amalie Sieveking?
Sieveking war eine Pionierin, die bereits vor der offiziellen Diakonissenbewegung weibliche Hilfsinitiativen in der Armen- und Krankenpflege startete.
- Quote paper
- M.A. Daniela Noth (Author), 2012, Die Entwicklung der organisierten christlichen Diakonie in Deutschland und der Eintritt der Frau in das Diakoniewesen im 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200638