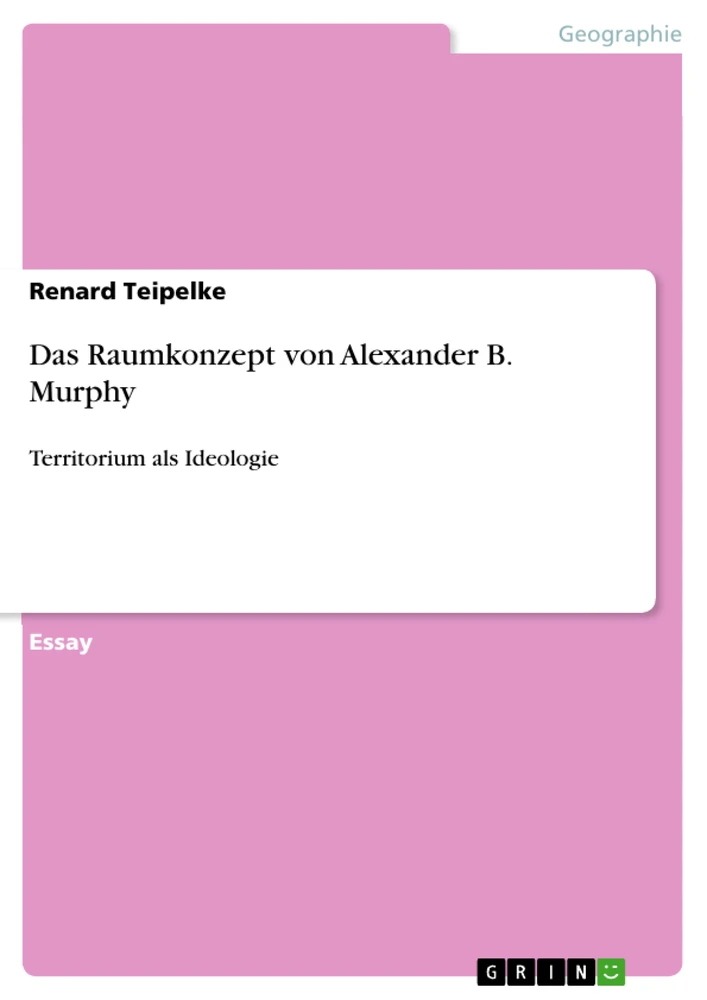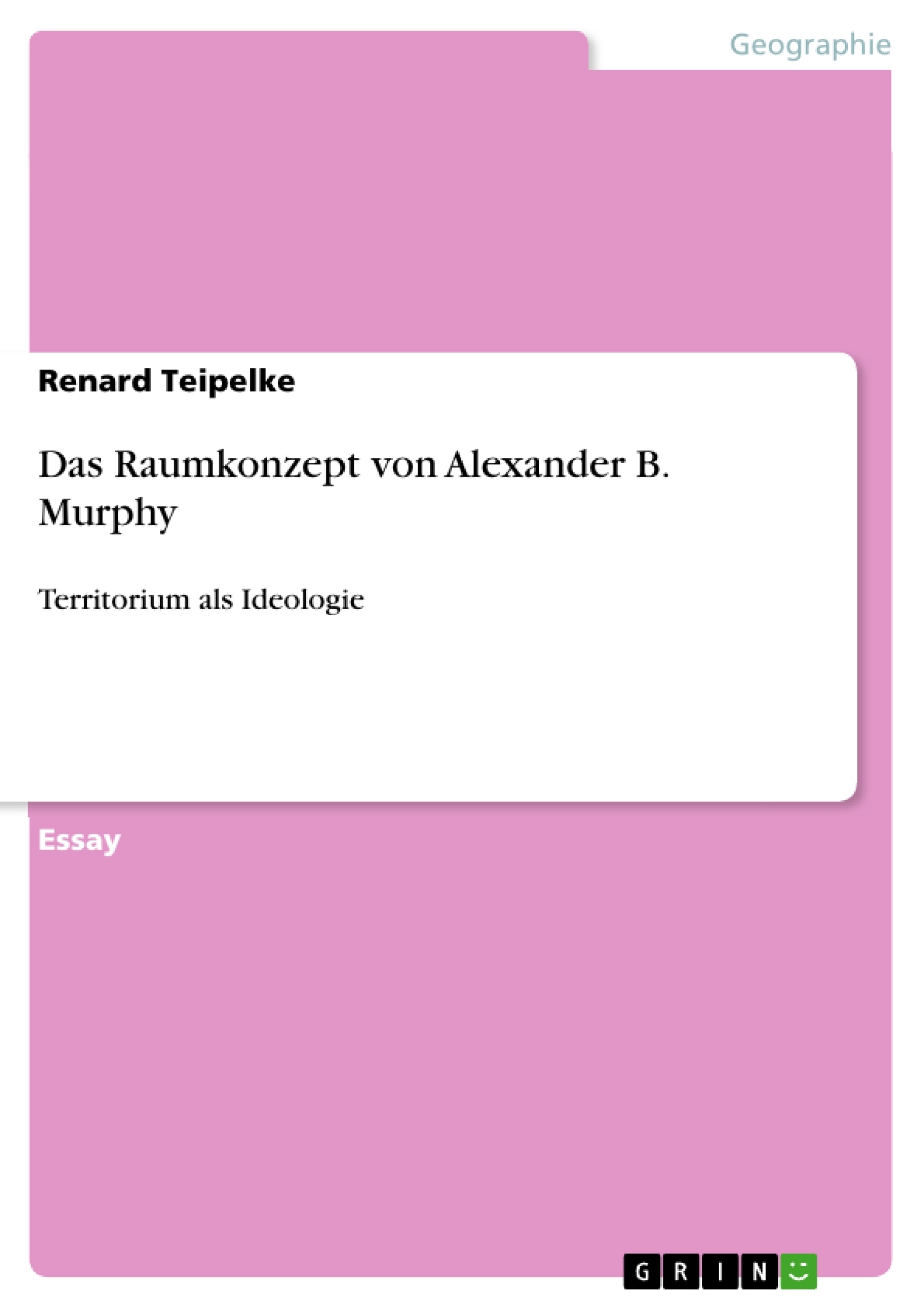Existential questions – who gets to have a country and who gets to be a country (Khanna 2011: 75) -- Mit dieser Formulierung pointiert Khanna in seinem populären Sachbuch „How to Run the World“ (2011) den grundlegenden Ansatz der geografischen und politikwissenschaftlichen Forschung zu Geopolitik und Territorium. Territorium ist dabei mehr als nur ein Begriff oder Startpunkt für die Untersuchung zwischenstaatlicher oder innerstaatlicher Konflikte, sondern bedarf einer konzeptionellen Fassung beziehungsweise theoretischen Untersuchung. Dieser Aufgabe hat sich Murphy in seinem 2005 publizierten Beitrag „Territorial Ideology and Interstate Conflict“ angenommen und soll daher nachfolgend einer kritischen Betrachtung unterzogen werden.
Murphys Raumkonzept sieht hierbei Territorium als Ideologie an und möchte Konflikte im modernen Staatensystem seit dem 20. Jahrhundert über eine Untersuchung verschiedener Ausprägungen dieser Ideologie, also unterschiedlicher territorialer Logiken, erklären können.
Nachdem ich Murphys zentrale Argumentation und Konzeption von Territorium als Ideologie vorgestellt habe (Kapitel 2), werde ich diese kritisch analysieren. In den nachfolgenden Ausführungen vertrete ich dabei die These, dass mit Murphys Raumkonzept eine Vielzahl territorialer Konflikte im modernen Staatensystem erläutert werden kann. Die Theorie des Autors kann aber nicht zugrundeliegende Ursachen solcher Konflikte ausreichend identifizieren und erklären, weil die Kategorien territorialer Logiken zum Teil Unschärfen enthalten (Kapitel 3). Murphy fällt in die von Agnew kritisierte „territorial trap“ (vgl. Elden 2010: 801), weil er den Nationalstaat als scheinbar naturgegebenes Organisationsprinzip von Gesellschaft voraussetzt (Kapitel 4). Damit verbunden ist eine Eindimensionalität in Murphy Betrachtung (Territorium als ganzheitlich erklärendes Konzept), weshalb allerdings sein Ansatz nicht generell abzulehnen, sondern stattdessen ertragreich zu erweitern ist. Dies werde ich mithilfe von Jessop/Brenner/Jones (2008) und deren Forderung nach Mehrdimensionalität in Raumtheorien erläutern und an einer Verknüpfung mit Swyngedouws Raumkonzept der Maßstabsebene (1997) exemplarisch zeigen (Kapitel 5). In einem abschließenden Teil (Kapitel 6) werde ich resümieren, wo die Potenziale und Grenzen von Murphys Raumkonzept liegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Murphys Raumkonzept
- Die Unschärfe politisch-ökonomischer territorialer Logik
- Die Territorial Trap bei Murphy
- Mehrdimensionalität als Weiterentwicklung von Murphys Raumkonzept
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Raumkonzept von Alexander B. Murphy, das Territorium als Ideologie betrachtet und damit Konflikte im modernen Staatensystem seit dem 20. Jahrhundert erklären möchte. Die Analyse soll zeigen, wie Murphys Konzept die Entstehung und Dynamik von territorialen Konflikten auf verschiedenen Ebenen beschreibt. Darüber hinaus wird die Arbeit kritisch beleuchten, welche Potenziale und Grenzen Murphys Ansatz beinhaltet.
- Territorium als Ideologie: Murphys Konzept von territorialer Legitimation und den verschiedenen „Logiken“ der territorialen Ansprüche
- Kritik an Murphys Ansatz: Unschärfen in den Kategorien territorialer Logiken und die „territorial trap“, die den Nationalstaat als naturgegebenes Organisationsprinzip voraussetzt
- Mehrdimensionalität als Erweiterung: Ein alternatives Raumkonzept, das über die eindimensionale Sichtweise von Territorium hinausgeht und die Rolle von ökonomischen, sozialen und politischen Faktoren integriert
- Potenziale und Grenzen von Murphys Raumkonzept: Die Anwendung des Konzepts auf konkrete Konflikte und seine Relevanz für das Verständnis des modernen Staatensystems
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die grundlegende Problematik des Verhältnisses von Territorium und Geopolitik vor und führt in Murphys Raumkonzept als theoretischen Ansatz ein.
- Kapitel 2: Das Kapitel erläutert Murphys Konzept von Territorium als Ideologie, das auf der Annahme beruht, dass territorialer Konflikt durch verschiedene „Logiken“ der territorialen Legitimation geformt wird.
- Kapitel 3: In diesem Kapitel wird die Unschärfe in Murphys Kategorien territorialer Logiken diskutiert und argumentiert, dass die Theorie nicht alle Ursachen von Konflikten ausreichend erklären kann.
- Kapitel 4: Der Abschnitt beleuchtet die „territorial trap“, in die Murphy fällt, indem er den Nationalstaat als naturgegebenes Organisationsprinzip voraussetzt.
- Kapitel 5: Das Kapitel präsentiert ein alternatives Raumkonzept, das Mehrdimensionalität berücksichtigt und die eindimensionale Sichtweise von Territorium erweitert.
Schlüsselwörter
Das Raumkonzept von Alexander B. Murphy, Territorium als Ideologie, territorialer Konflikt, Regime territorialer Legitimation, ethnokulturelle, physisch-räumliche, politisch-territoriale Logiken, „territorial trap“, Mehrdimensionalität, Staatensystem, Nationalstaat, Geopolitik, Grenzziehung, Autonomiebestrebungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Murphys zentraler Ansatz zum Thema Territorium?
Alexander B. Murphy betrachtet Territorium als eine Ideologie, die genutzt wird, um Herrschaftsansprüche im modernen Staatensystem zu legitimieren.
Welche „territorialen Logiken“ unterscheidet Murphy?
Er unterscheidet verschiedene Logiken wie die ethnokulturelle, die physisch-räumliche und die politisch-territoriale Logik zur Begründung von Gebietsansprüchen.
Was versteht man unter der „Territorial Trap“?
Die „territoriale Falle“ bezeichnet die Annahme, dass der Nationalstaat die naturgegebene und einzige Form der gesellschaftlichen Organisation im Raum darstellt.
Warum wird Murphys Raumkonzept kritisiert?
Kritiker bemängeln eine gewisse Unschärfe in seinen Kategorien und die Tatsache, dass er den Nationalstaat als Fixpunkt setzt, ohne alternative Raumebenen ausreichend zu berücksichtigen.
Wie lässt sich Murphys Ansatz erweitern?
Durch eine mehrdimensionale Betrachtung, die neben dem Territorium auch ökonomische Netzwerke, soziale Maßstabsebenen (Scale) und politische Verflechtungen einbezieht.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Renard Teipelke (Author), 2012, Das Raumkonzept von Alexander B. Murphy, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200691