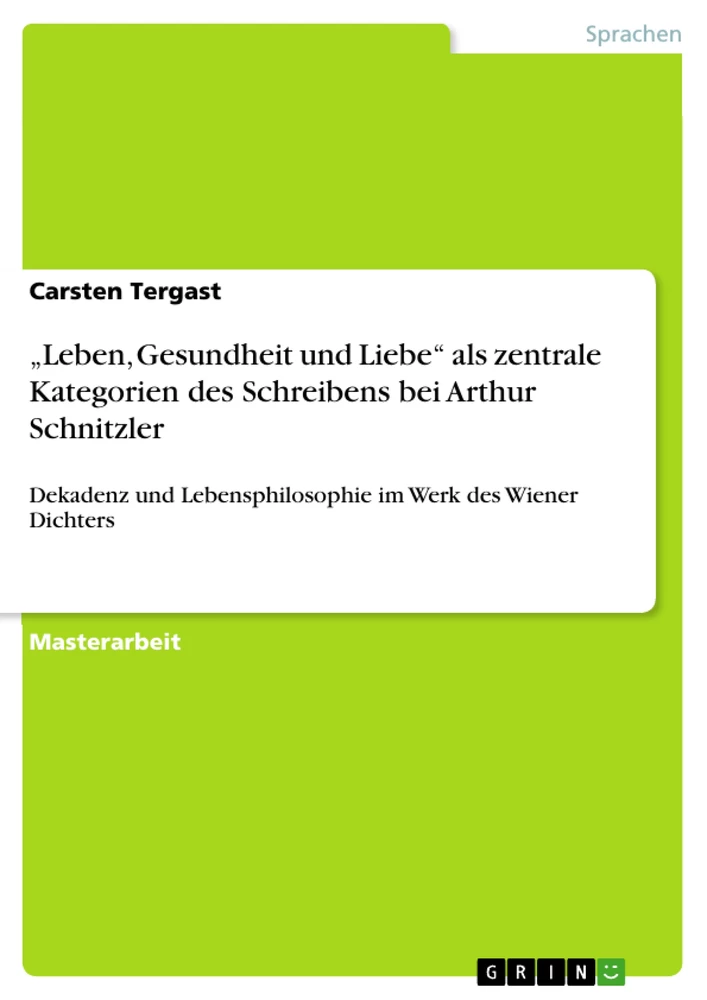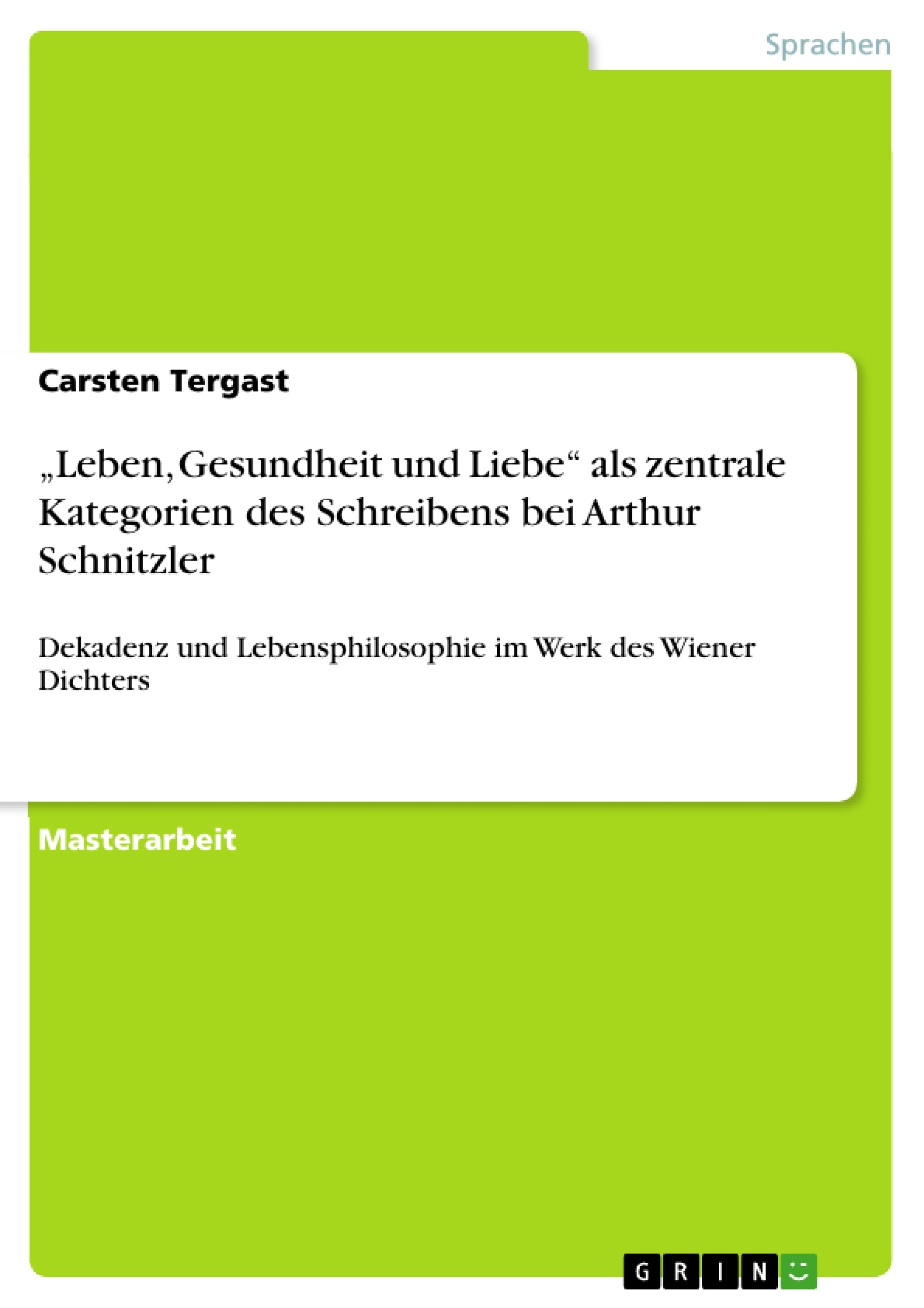Der Begriff des "Lebens" spielt um die Jahrhundertwende im Gefolge der Philosophie Kierkegaards, Nietzsches oder Simmels eine große Rolle. Auch im Werk des Wiener Autoren Arthur Schnitzler wird vielfältig interpretiert, was "Leben" ist. Die vorliegende Arbeit nimmt sich dieses Lebensbegriffs an und verbindet ihn mit den philosophischen Ansätzen der Zeit.
Inhalt
1. Einleitung
2. Dekadenz und Lebensphilosophie
2.1 Zur Entwicklung des Dekadenz-Begriffs
2.1.1 Der Dekadenz-Begriff in der literarischen Wiener Moderne
2.1.2 Motive und Themen der Dekadenzliteratur – Eine Übersicht
2.2 Zum Begriff des Lebens in der Philosophie der Jahrhundertwende
2.2.1 Anfänge einer Philosophie des Lebens
2.2.2 Arthur Schopenhauer
2.2.3 Sören Kierkegaard
2.2.4 Friedrich Nietzsche
2.3 Der zentrale Begriff des Erlebnisses
3. Der Wert des Lebens im Werk Arthur Schnitzlers
3.1 Kleiner Vorspann: Décadents in den frühen Erzählungen
3.2 Sterben
3.3 Der Schleier der Beatrice
3.4 Professor Bernhardi
4. Der „Wert des Lebens“: Die kritischere Sichtweise im Spätwerk
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Das Werk Arthur Schnitzlers ist - gemessen an den Schriften zeitgenössischer Autoren – relativ leicht lesbar und weist auf den ersten Blick keine nennenswerten hermetischen Textstrukturen auf. Dies hat auch in der literaturwissenschaftlichen Forschung verschiedentlich dazu verführt, die Texte auf einer eher oberflächlichen Ebene zu rezipieren und ihre Gedankenwelt allzuschnell in scheinbar passende Kategorien einzuordnen. So gelangte man beispielsweise zu dem Eindruck, Schnitzlers Werk bliebe „bei Deskription und nüchterner Analyse ohne Wertung und Stellungnahme.“[1] Darüber hinaus blieb lange Zeit die Wertung Hermann Bahrs wirkmächtig, der über Schnitzler schrieb:
Er ist ein großer Virtuose, aber einer kleinen Note. [...] Schnitzler darf nicht verschwenden. Er muß sparen. Er hat wenig. So will er es denn mit der zärtlichsten Sorge, mit erfinderischer Mühe, mit geduldigem Geize schleifen, bis das Geringe durch seine unermüdlichen Künste Adel und Würde verdient. [...] Er weiß immer nur einen einzigen Menschen, ja nur ein einziges Gefühl zu gestalten. [...] Der Mensch des Schnitzler ist der österreichische Lebemann. Nicht der große Viveur, der international ist und dem Pariser Muster folgt, sondern die wienerisch bürgerliche Ausgabe zu fünfhundert Gulden monatlich, mit dem Gefolge jener gemütlichen und lieben Weiblichkeit, die auf dem Weg von der Grisette zur Cocotte ist, nicht mehr das Erste, und das Zweite noch nicht. [...] Nur darf er freilich, weil sein Stoff ein weltlicher, von der Fläche der Zeit ist, Wirkungen in die Tiefe der Gefühle nicht hoffen, und von seinem feinem, aber künstlerischen Geiste mag das Wort des Voltaire von Marivaux gelten: Il sait tous les sentiers du coeur, il n’en connaît pas le grand chemin.[2]
Eine einseitige Festlegung Schnitzlers auf die immer gleichen Themen und Motive von Eros und Thanatos hat sich jedoch als wenig sinnvoll erwiesen, zumal dabei oft zu wenig Gewicht auf die mannigfaltigen Diskurse der Zeit gelegt wurde.
In dieser Arbeit soll eine differenziertere Sichtweise versucht werden. Es wird prinzipiell davon ausgegangen, daß die dominanten theoretischen Diskurse einer Epoche immer auch in literarische Texte einfließen und deren Aussagekraft somit wesentlich beeinflussen. Die Interpretation orientiert sich damit im wesentlichen an dem, was Michael Titzmann mehrfach formuliert hat, so etwa 1991:
Die gegebenen Ereignisse, die Texte, sind nun zwar in der Interpretation als komplexe semantische Systeme analysierbar, aber sie sind keine isolierten Systeme: Sie sind Systeme, die in vielfältigen Relationen zu einer (ebenfalls sehr komplexen) Umwelt, d.h. zu einer Menge anderer Systeme, stehen; diese anderen Systeme können ebenfalls durch vielfältige Relationen untereinander korreliert sein.[3]
Diese Sichtweise verweist auf system- sowie diskurstheoretische Modelle. Der Text wird nicht mehr als eindeutig in seinem vom Autor gegebenen Sinn zu erfassende Einheit gesehen, sondern muß als Produkt verschiedenster Quellen verstanden werden:
In solchem Sinn kann man von der Pluralität eines Textes sprechen, der stets aus Aussagen verschiedener Diskurse besteht und allein in seiner Existenz immer schon auf Intertextualität bzw. auf Interdiskursivität verweist.[4]
Zur Zeit der Jahrhundertwende, die in der Forschung immer wieder in die unterschiedlichsten Strömungen aufgeteilt wird und sich einem einheitlichen Epochenbegriff entzieht, drehte sich die theoretische Auseinandersetzung mit der eigenen Zeit sehr stark um einen bestimmten Begriff, nämlich den des „Lebens“.[5] Man hat dafür folgerichtig die Bezeichnung „Lebensphilosophie“ gefunden, als deren Wegbereiter Friedrich Schlegel, Arthur Schopenhauer und der in Deutschland weitgehend unbekannte Jean-Marie Guyau gelten. Ihre wesentliche theoretische Grundlegung erfuhr diese Richtung in der Folge bei Friedrich Nietzsche, Wilhelm Dilthey und Henri Bergson, während ihre volle Ausprägung sich schließlich bei Denkern wie Georg Simmel, Ludwig Klages, Theodor Lessing oder José Ortega y Gasset vollzog.[6] In dieser Arbeit werden zusätzlich zu Schopenhauer, Nietzsche und Dilthey einige Grundpositionen Sören Kierkegaards herangezogen, die den Wert des Lebens auf bestimmte Weise reflektieren. Man kann diese Reflexion über „Leben“ allgemein als einen der zentralen Diskurse der frühen Moderne auffassen.
Explizite Äußerungen Schnitzlers zum Thema Lebensphilosophie lassen sich kaum finden, weder in den Tagebüchern noch in den Briefen oder den theoretischen Schriften. Auch seine Figuren sind nie bloße Sprachrohre für diese Denkweise der Zeit. Das ist allerdings auch gar nicht nötig, um Schnitzlers Werk in diesen Zusammenhang einzuordnen:
Um eben dieses zu sein [kreativ, innovativ, originell], muß er [der Text] entweder gegebenem Wissen widersprechen oder gegebenes Wissen zu erweitern suchen. [...] (Mehr oder weniger) Vollständig kann eine Interpretation also nur bei Einbeziehung des kulturellen Wissens sein.[7]
Die Strömung der Lebensphilosophie wird in dieser Arbeit im Sinne Titzmanns als „kulturelles Wissen“ verstanden und zwar als „gruppenspezifisches Wissen“[8], welches zu den „Prämissen der Produktion, Distribution, Rezeption von Texten“[9] gehört. Daher soll hier auch gezeigt werden, daß Arthur Schnitzlers Werk sehr wohl den sozialen und historischen Hintergrund seiner Zeit reflektiert. Gerade die Werke der Hoch- und Spätphase ab ca. 1910 sind hier zu nennen und werden in dieser Arbeit auch unter diesem Aspekt betrachtet.
Darüber hinaus mag die mangelnde explizite Nennung eines Bezugs zum zeitgenössischen kulturellen Hintergrund in dem generellen Mißtrauen Schnitzlers gegenüber philosophischen Weltentwürfen begründet sein, die ihm oft als zu unpräzise und verschwommen erschienen:
‚Im Dunkeln ist gut munkeln;‘ – dieser Spruch läßt sich sehr gut auf das philosophische Gebiet übertragen; in Klarheit und Licht ist nur den wenigsten wohl und sie flüchten sich gerne dahin, wo es keine Kontrolle gibt; also dorthin, wo das einzige menschliche Verständigungsmittel, das Wort, seine Geltung verliert, vielmehr von Augenblick zu Augenblick seinen Kurs und seine Bedeutung wechselt. (BSB, 128)
Schnitzler hat sich nie offen als Anhänger irgendeiner philosophischen oder literarischen Zeitströmung zu erkennen gegeben, seine Werke sollten nicht dazu dienen, bestimmte Theorien zu beweisen: „he distrusted philosophical systems and held them to the beautiful, artistic creations.“[10] Das Schubladendenken vieler Kritiker war ihm stark zuwider. Dies ist ein Hauptgrund warum Schnitzler selbst sich einer Tätigkeit als Feuilletonist immer verweigert hat, und zwar im Gegensatz zu den meisten seiner Schriftstellerkollegen. Auch der verhältnismäßig geringe Umfang des theoretisch-essayistischen Werkes hängt mit dem Bestreben zusammen, das literarische Werk für sich sprechen zu lassen.[11] Allerdings eignen sich die Aphorismen oft, um Anhaltspunkte für Schnitzlers grundsätzliche Positionen zu finden:
Die Aphorismen sind ein wichtiger Anhaltspunkt, wenn man eine häufig für zweitrangig gehaltene Seite an Schnitzler, nämlich die philosophische oder besser: ethische, verstehen und einordnen möchte. [...] Letztlich kann man bei Schnitzler nicht so sehr von einer im engeren Sinne philosophischen Orientierung sprechen als vielmehr von einer rigoros persönlichen Weltanschauung, die uns zeigt, daß sein Werk eine ethische Dimension hat und uns eine Vorstellung sowohl von seiner Sicht auf Leben und Kunst vermittelt als auch von der Tiefe seines gesellschaftlichen und menschlichen Anliegens.[12]
Dennoch kann man auch an vielen Stellen des erzählerischen und dramatischen Werkes des Wieners festmachen, wie einflußreich der Begriff des Lebens, der gerade in der Philosophie der Jahrhundertwende eine tragende Rolle spielt, für die Handlungsweise seiner Figuren ist. Er erfährt im Werk Schnitzlers eine eigene Deutung. Seine große Wichtigkeit zeigt sich aber beispielsweise in seiner Einordnung unter die drei „Absoluten Güter“, und zwar vor „Gesundheit“ und „Liebe“ an erster Stelle (vgl. EV, 30).
Auch ist Schnitzler selbst sich darüber im klaren gewesen, daß ein Autor nie die letztgültige Deutung seiner eigenen Schriften kennen kann, wie aus dem Vorwort zu seiner Aphorismensammlung deutlich wird:
Auch zu Beiläufigkeiten bekenne ich mich, deren eigentlicher Sinn dem Leser zuweilen deutlicher werden könnte, als er mir selbst immer geworden ist. (BSB, 9)
Man hat das Werk Arthur Schnitzlers oft sehr einseitig mit der zeitgenössischen Dekadenzliteratur in Verbindung gebracht. Meist wurde dieser Begriff dabei zusätzlich ausschließlich negativ gedeutet[13] und dem Werk Schnitzlers dementsprechend unterstellt, es führe lediglich den Verfall von Moral und Sitte im Habsburgerreich ausdrücklich vor Augen, die wichtigen Figuren seien negativ konnotierte Décadents par excellence und dem Werk fehle somit „jede Spur eines Eingreifens“[14], also die Perspektivierung über passive Dekadenz hinaus. Damit scheint der Begriff der Dekadenz dem des Lebens diametral entgegenzustehen. Er bietet sich daher besonders an, um die Bedeutung des Lebens im Werk Schnitzlers herauszustellen. Bernhard Blume formuliert in seiner lange Zeit für die Schnitzler-Forschung sehr einflußreichen Dissertation:
Daß etwas zu Ende ist, spürt Schnitzler mit allen Nerven; daß etwas Neues wächst, bleibt ihm verschlossen; die Ablösung der décadence durch die Barbarei, das ist die ganze Sicht, die sich ihm bietet.[15]
Allerdings deutet Blume bereits an, welche Bedeutung der Lebensbegriff für das Werk Schnitzlers hat, wenn er von der „Lebensbejahung“ der Figuren spricht, die Blume allerdings als „eigentümlich“ und „gänzlich unnaiv“[16] empfindet und sie in der Folge als „Reaktionserscheinung“ auf das Faktum des Todes und somit als „Rückschlag“[17] interpretiert.
Diese Arbeit geht davon aus, daß gerade die dem Dekadenzbegriff inhärente Dialektik in der Strömung der Lebensphilosophie produktiv aufgegriffen wird, somit letztlich über sich selbst hinausweist und auch ein dem Schnitzler’schen Werk innewohnendes Gestaltungsprinzip ist. Nicht umsonst verweist Schnitzler durchaus explizit auf die Leitgedanken seines Schaffens: „Absolute Güter: Leben, Gesundheit, Liebe. Relative Güter: Tugend, Ehre, Geld“ (EV, 30) In dieser kleinen Notiz ruft Schnitzler seine Wertmaßstäbe auf und erkennt unter anderem das Leben als zentrales Gut an. Allerdings sind die Schwierigkeiten bei der Erlangung dieser Güter, welche im übrigen bei Schnitzlers Figuren immer wieder – zum Teil extrem – auftreten, bei Arthur Schopenhauer, einem der Vordenker der Lebensphilosophie, bereits angedeutet:
A b s o l u t e s G u t ist demnach ein Widerspruch: höchstes Gut, summum bonum, bedeutet das Selbe, nämlich eigentlich eine finale Befriedigung des Willens, nach welcher kein neues Wollen einträte, ein letztes Motiv, dessen Erreichung ein unzerstörbares Genügen des Willens gäbe. Nach unserer bisherigen Betrachtung [...] ist dergleichen nicht denkbar. (WW I/2, 450)
Gerade im Spätwerk Schnitzlers zeigt sich die Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit immer deutlicher.
Nachdem zunächst in einem theoretischen Teil die Begriffe „Dekadenz“ sowie „Lebensphilosophie“ in ihrer geschichtlichen Entwicklung und Bedeutung für die Literatur der Jahrhundertwende geklärt werden, soll im interpretatorischen Teil dieser Arbeit gezeigt werden, wie zentral auch für Schnitzler der Lebensbegriff ist und wie sich seine Deutung verändert. Hierzu sollen auch Texte des frühen Schnitzler herangezogen werden, die in der bisherigen Forschung eher marginal behandelt und ästhetisch abgewertet wurden. Um die ganze Fülle des Lebenswerks abzudecken und eine Entwicklung des Lebensbegriffs aufzeigen zu können, werden vier Texte aus verschiedenen Schaffensepochen eingehender behandelt: Sterben (1892), Der Schleier der Beatrice (1899), Professor Bernhardi (1912) sowie Therese. Chronik eines Frauenlebens (1928).
Bisherige Versuche, den Lebensbegriff der Jahrhundertwende konkret auf das Werk Arthur Schnitzlers zu beziehen, hat es nur vereinzelt gegeben. Allerdings kommt bereits 1933 Friedrich Wilhem Kaufmann zu dem Schluß, es könne „in bezug auf den höchsten Wert bei Schnitzler kein Zweifel entstehen: er ist das Leben selbst.“[18] Auf Bernhard Blumes Ansätze wurde bereits hingewiesen. Richard Müller-Freienfels promovierte 1954 über „Das Lebensgefühl in Arthur Schnitzlers Dramen“[19], spricht jedoch hier immer noch über „die tiefe Angst und Verzweiflung des Dichters [...], der jedes Vertrauen in den Sinn des Lebens verloren hatte“.[20] 1981 kam Ralph Michael Werner zu dem Ergebnis, „daß der lebensphilosophische Einfluß auf Schnitzlers literarische Produktion verhältnismäßig klein und daher nie konstitutiv gewesen“[21] sei. Bei Werner läßt sich aber eine generelle Indifferenz sowie großes Unbehagen gegenüber dem Begriff Lebensphilosophie konstatieren, wenn er diese als Basis für die „deutsch-völkische Literatur des Dritten Reiches und ihrer Vorläufer“[22] bezeichnet. Zwar lassen sich gewisse Verbindungslinien hier nicht in Abrede stellen, gerade, was den biologistisch-vitalistischen Aspekt der Lebensphilopophie anbelangt. Doch stellt Werners Sichtweise bei der Vielschichtigkeit des Begriffs meines Erachtens eine unzulässige Verkürzung dar, die durch sein methodisches Vorgehen bedingt ist und zusätzlich nicht berücksichtigt, daß der „Wert des Lebens“ nicht unbedingt identisch mit dem direkten Einfluß der Lebensphilosophie sein muß. Ernst Offermanns stellt immerhin ebenfalls 1981 bezüglich Schnitzlers Drama Der Ruf des Lebens nebenbei fest, das Stück sei „im ganzen merklich vom Geiste zeitgenössischer Lebensphilosophie und jugendstilhafter Attitüde mitgeprägt.“[23]
Erst in neuerer Zeit widmete sich Wolfgang Lukas den „epochalen Lebenskrisen“ und vor allem „ihrer Lösung im Werk Arthur Schnitzlers“[24] und bereitete damit eine Basis für eine positive Neubewertung des Lebensbegriffs bei Schnitzler. Von besonderem Interesse für die Interpretationen in dieser Arbeit ist dabei die von Lukas getroffene Unterscheidung der Figuren in A- und B-Typen. Lukas geht dabei davon aus, daß die Personen in Schnitzlers Texten fast immer in zwei „disjunkte Klassen“[25] aufteilbar sind und damit sowohl eine „ ontologische “ als auch eine „ typologische Klassifikation“[26] manifestiert, da beide Klassen sowohl am Einzelwesen nachweisbar als auch allgemein typisierbar sind. Somit kommt Lukas zu seiner Einteilung:
Die Klasse der Normalbürger – sie seinen als ‚A-Figuren‘ bezeichnet – wird der Klasse der vom bürgerlichen Lebensmodell Abweichenden – sie seinen als ‚B-Figuren‘ bezeichnet – gegenübergestellt. Damit liegt eine der elementarsten semantischen Oppositionen nicht nur des gesamten Schnitzlerschen Œuvres, sondern auch der Epoche zugrunde, man kann sie als die Basisopposition der dargestellten Welten schlechthin bezeichnen: ‚ (bürgerliche) Normalität‘ vs. ‚Abweichung‘.[27]
Die B-Figuren erscheinen dabei grundsätzlich als „ein Fremdes“[28], von dem die bürgerlichen A-Figuren sich abheben möchten. Was Leben bedeutet, ist dabei je nach Klasse durchaus unterschiedlich:
[Es] findet sich in den Texten der Terminus der ‚Welt‘, so in rekurrenten Formulierungen wie ‚eine Welt für sich‘, ‚eine andere, fremde Welt‘, ‚Welt ohne Gesetz‘ etc. Die Texte unterscheiden also eine regelrechte ‚A-Welt‘ und eine ‚B-Welt‘, denen zwei verschiedene Lebensmodelle zugeordnet werden.[29]
Lukas führt in der Folge die unterschiedlichen „semantischen Räume“[30] beider Figurenklassen an, um die Wesensunterschiede zu verdeutlichen. Auf diese Einteilung der Figuren Schnitzlers wird im Rahmen dieser Arbeit gelegentlich zurückgegriffen, um bestimmte Verhaltensweisen besser interpretieren zu können.
In anderen Arbeiten wird höchstens am Rande auf den Lebensbegriff bei Schnitzler eingegangen, da dieser bei ihm im Gegensatz zu anderen Dichtern erst aus den Tiefenschichten der Texte freigelegt werden muß.
2. Dekadenz und Lebensphilosophie
Beide Begriffe scheinen sich vollkommen zu widersprechen, und doch bilden sie ein für die Zeit der Jahrhundertwende zentrales Begriffspaar, denn bei beiden steht die Interpretation von „Leben“ im Mittelpunkt. Man versucht heute, die denkerischen Fundamente jener Zeit mit den verschiedensten Bezeichnungen zu erfassen, um ihrer geistigen Uneinheitlichkeit gerecht zu werden. Erst zusammengenommen ergeben all diese Bezeichnungen eine Art von Gesamtbild. Diese Grundhaltung der Jahrhundertwende hat Robert Musil sehr deutlich formuliert:
Es wurde der Übermensch geliebt, und es wurde der Untermensch geliebt; es wurden die Gesundheit und die Sonne angebetet, und es wurde die Zärtlichkeit brustkranker Mädchen angebetet; [...] man war gläubig und skeptisch, naturalistisch und preziös, robust und morbid; [...] Dies waren freilich Widersprüche und höchst verschiedene Schlachtrufe, aber sie hatten einen gemeinsamen Atem; würde man jene Zeit zerlegt haben, so würde ein Unsinn herausgekommen sein wie ein eckiger Kreis, der aus hölzernem Eisen bestehen will, aber in Wirklichkeit war alles zu einem schimmernden Sinn verschmolzen.[31]
Mit Lebensphilosophie ließe sich spontan als erstes die Epochenbezeichnung des Jugendstils assoziieren, gilt doch dieser als besonders vitalitätsbejahend mit seinem Hang zum Ornamentalen und Überschwenglichen. So stellt beispielsweise Adalbert Schlinkmann diesen Zusammenhang ausführlich dar.[32] Der Begriff der Dekadenz dagegen ist nach wie vor grundsätzlich negativ konnotiert, Verfall und Untergang gelten als ihre Grundpfeiler. Eine etwas differenziertere Darstellung des Dekadenz-Begriffes soll im folgenden Kapitel versucht werden.
Der innere Zusammenhang von Lebensphilosophie und Dekadenz muß also zunächst verdeutlicht werden. Das dialektische Spannungsverhältnis, welches diesen beiden Positionen innewohnt, ist allerdings durchaus geeignet, das besondere Lebensgefühl um die Jahrhundertwende zu erhellen. Eine Tendenz ist ohne die andere kaum denkbar, denn ihr gemeinsamer Ausgangspunkt ist die Suche nach einer Theorie des Lebens. Die Dekadenzströmung bringt Erkenntnisse hervor, die den Blick vieler Philosophen auf das „Leben“ geschärft haben. Andererseits sind die Erkenntnisse der Lebensphilosophie im Hinblick auf den Wert des Lebens auch dazu geeignet, sich von einseitig negativ-dekadenten Verhaltensweisen zu emanzipieren.
Dieses spezifische Lebensgefühl der Jahrhundertwende kommt auch im Werk Arthur Schnitzlers immer wieder zum Ausdruck, läßt sich aber nicht einseitig auf eine Position festlegen. Allzu häufig wurden Schnitzlers Figuren einseitig als hoffnungslose Décadents interpretiert – zumal unter fragwürdiger Zuhilfenahme von biographischen Aspekten, etwa gewissen Schilderungen in Schnitzlers Autobiographie „Jugend in Wien“ oder der Tatsache, daß Schnitzler seine heute vergessenen Jugendgedichte oft mit dem Pseudonym Anatol unterzeichnete, was dazu führte, ihn mit dem gleichnamigen Protagonisten des Einakter-Zyklus‘ gleichzusetzen. Erst bei genauerem Lesen der Texte und unter Berücksichtigung der dominierenden zeitgenössischen Denkmodelle wird deutlich, daß Schnitzlers Gedankenwelt zwar immer seine großen Themen zugrunde liegen, diese jedoch vor allem als Fundament für tiefere Weltdeutung dienen. Nichts anderes ist gemeint, wenn Schnitzler schreibt:
Und klagt Ihr wieder Eure krit’sche Not,
Ich wüßte nur von Lieb‘ und Spiel und Tod
Das wohlvertraute Lied Euch vorzusingen –
So seid getrost: in diesen ew’gen drei’n
Ist alle Wahrheit und ihr Spiegelschein
Und Sinn und Seel von allen Erdendingen. (BSB, 26)
Allzu leicht scheint es, dem Autor vorzuwerfen, sein schriftstellerisches Talent erschöpfe sich in der bloßen Darstellung des in den Versen angesprochenen Themenkreises. Liebe, Spiel und Tod evozieren ihrerseits Handlungs- und Reaktionsweisen der Figuren, die vor dem geistesgeschichtlichen Hintergrund der Epoche ihre volle Bedeutung erlangen.
So ist es also sinnvoll, Erscheinungen wie Dekadenz und Lebensphilosophie nicht nur isoliert zu betrachten, sondern aus der Dialektik ihres inneren Spannungsverhältnisses neue Einsichten in die so heterogene Epoche der Jahrhundertwende zu erlangen. Dekadenz kann nicht ohne den ihr innewohnenden Aspekt der Lebensbejahung gesehen werden, genauso wie lebensphilosophische Betrachtungen manchmal die Unmöglichkeit erweisen, dem wirklichen Wert des Lebens gerecht zu werden.
2.1 Zur Entwicklung des Dekadenz-Begriffs
Das Wort hat keinen besonders guten Klang, sondern erweckt – vor allem bei weniger Gebildeten – unerfreuliche Assoziationen von physischer Degeneration, Niedergang ganzer Geschlechter und Völker, Sittenlosigkeit, biologischer und militärisch-politischer Schwäche.[33]
Diese Bemerkung Erwin Koppens trifft die Vorstellung, die die meisten Menschen mit dem Begriff Dekadenz verbinden. Viele Phänomene der heutigen Welt erscheinen dem spätbürgerlichen Bewußtsein als dekadent im Sinne von „abartig“, „krank“ und zum Untergang moralischer Setzungen führend. Analogien zum historischen Entstehen des Begriffs der Dekadenz sind unverkennbar. Die hochentwickelte Zivilisation des alten Rom ist diejenige, deren unaufhaltsamer Untergang erstmals im Zusammenhang mit dekadenten Erscheinungen gebracht wurde. In der Verschwörung des Catilina schildert Sallust, wie die positiven Errungenschaften einer großen Kultur ihren eigenen Untergang heraufbeschwören können:
Als aber durch Tätigkeit und Gerechtigkeit der Staat sich vergrößert hatte, [...] da begann das Schicksal seine Tücke zu zeigen und alles durcheinanderzubringen. Denselben Männern [...] wurden Ruhe und Reichtum, sonst wünschenswerte Güter, zur Last und zum Verhängnis. [...] als dann aber die Fäulnis wie eine ansteckende Seuche um sich griff, da wandelte sich das ganze Volk, und aus der gerechtesten und besten Regierung wurde eine grausame und unerträgliche.[34]
Diese Erscheinungen sind vor allem in zwei Werken beschrieben, die den Dekadenzbegriff lange Zeit geprägt haben. Bereits 1734 verfaßte Charles de Montesquieu ein Werk mit dem Titel Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence. Mit diesem Werk setzt sich der Begriff der „Décadence“ in Frankreich im allgemeinen Sprachgebrauch durch. Ebenfalls im 18. Jahrhundert, nämlich von 1776-1788, erschien die Studie des englischen Historikers Edward Gibbon (1737-1794) mit dem Titel The history of the decline and fall of the Roman Empire. Von sehr viel größerer inhaltlicher Bedeutung für die Entwicklung des Dekadenzbegriffs ist allerdings die Abhandlung von Jean-Jacques Rousseau mit dem Titel Discours si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs, auch wenn in ihr der Begriff „Décadence“ nicht explizit genannt wird. Rousseaus Denkmodell geht davon aus, daß der Fortschritt auf den Gebieten der Wissenschaften und Künste notwendig Dekadenzerscheinungen nach sich ziehe. Dieser Aspekt des Décadence-Begriffs blieb lange Zeit wirkmächtig, bis hinein in die Kritik am positivistischen Wissenschaftsideal des 19. Jahrhunderts.
1834 verfaßte der französische Literarhistoriker Désiré Nisard seine Etudes de mœurs et de critique sur les poètes latins de la décadence, in denen er die zeitgenössische französische Romantik mit dem Décadencebegriff in – negative – Verbindung bringt, wenn auch mehr in formaler Hinsicht: Inhaltlose Sprachformeln und sinnlose Detailverliebtheit werden ihm zu Kennzeichen des Literaturverfalls. Direkt aufgegriffen wurde dieser Vorwurf kurze Zeit später von Charles Nodier, der in seinem Essay Du fantastique en littérature allerdings die Notwendigkeit einer dekadenten Literatur verteidigt und den Begriff des Décadents explizit auf sich anwendet. Damit ist in der Geschichte des Begriffs ein Wendepunkt eingetreten, denn diese Diskussion steigerte sich im folgenden weiter, bis Charles Baudelaire 1867 die Notes nouvelles sur Edgar Allen Poe als Vorwort zu seiner Übersetzung der Erzählungen Poes verfaßte. Die notes beginnen mit den – auch typographisch abgesetzten – Worten: „Littérature de décadence!“[35] Der Begriff „Décadence“ löst sich mit Baudelaire von seiner negativen Konnotation. Wichtiger als Verfall und Untergang werden jetzt etwa Verfeinerung der Genüsse und absolutes Preisen der Schönheit, wichtig ist vor allem auch die Entsprechung von Inhalt und Form. Ornamentale Elemente in der Sprache werden propagiert. Allem, was dem bürgerlichen Bewußtsein als fortschrittsfeindlich und verkommen erscheint, wird eine ästhetische Seite abgewonnen, das Häßliche wird plötzlich kraft der dichterischen Sprache schön. Berühmtestes Beispiel dafür sind sicherlich Baudelaires Fleurs du mal, die die Ästhetik des Häßlichen feiern wie kaum ein anderes Werk vorher. Der ausgeprägte positivistische Fortschrittsglaube des 19. Jahrhunderts wird ad absurdum geführt:
Damit [mit der Verneinung des Fortschrittglaubens] hat Baudelaire vorweggenommen, was die programmatische Basis der Décadence-Literatur der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts sein wird: die Proklamation der Décadence als ästhetisches Gegenideal zum Glauben an den zivilisatorischen Fortschritt.[36]
So beschreibt Baudelaire beispielsweise im Bild der „soleil agonisant“ den Reichtum der sensuellen Eindrücke, die der Dekadenz-Dichter dem Untergang der Sonne abgewann. Licht und Farben werden in ihrer sinnlichen Wirkung faßbar, jeder schnöde Realismus wird von der Literatur ferngehalten:
Ce soleil qui, il y a quelques heures, écrasait toute chose de sa lumière droite et blanche, va bientôt inonder l’horizon occidental de couleurs variées. Dans les jeux de ce soleil agonisant, certains esprits poétiques trouveront des délices nouvelles ils y découvriront des colonnades éblouissantes, des cascades de métal fondu, des paradis de feu, une splendeur triste, la volupté de regret, toutes les magies du rêve, tous les souvenirs de l’opium. Et le coucher de soleil leur apparaîtra en effet comme la merveilleuse allégorie d’une âme chargée de vie, qui descend derrière l’horizon avec une magnifique provision de pensées et de rêves.[37]
Noch weiter ausgeführt wird dieser Décadence-Begriff in den Notices, die Théophile Gautier als Einleitung zu einer Ausgabe der Fleurs du mal abfaßte. Gautier zählt dezidiert auf, was zum dekadenten Stil gehört und benutzt in diesem Zusammenhang auch bereits den Terminus „Symbolismus“, der sich auch auf die eben zitierten Baudelaire-Passage sehr gut anwenden läßt. Diese vor allem in ihrer spezifisch französischen Ausrichtung zu Weltruhm gelangte Strömung ist in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung allerdings von der Décadencebewegung abzusetzen, wie Koppen betont:
Symbolismus und Décadence sind zwar in der französischen Literaturgeschichte zwei so eng benachbarte Phänomene, daß man nicht von dem einen handeln kann, ohne das andere wenigstens im Auge zu behalten. Dennoch bezieht sich der Terminus ‚Décadence‘ auf eine grundsätzlich andere semantische Ebene als die Bezeichnung ‚Symbolismus‘: bezieht sich diese vorwiegend auf sprachliche und poetologische Erscheinungen, die sich in Stil und Form eines literarischen Werks manifestieren, so umreißt Décadence eine Haltung dem Leben und der Gesellschaft gegenüber, deren literarische Phänomene weniger in der Sprache als in bestimmten gehaltlichen Charakteristika (Motiven, Charakteren usw.) in Erscheinung treten.[38]
Der Symbolismus ist als eine „poésie pure“ zu verstehen, die Dichtung völlig aus ihrem sozialen Zusammenhang herauslöst und sich damit bewußt von einer „poésie engagée“ distanziert, welche explizit politisch-gesellschaftliche Tendenzliteratur sein will. An dieser Stelle seien mit Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé und Paul Verlaine nur die Hauptvertreter des französischen Symbolismus genannt, dem in der deutschen Literatur Rainer Maria Rilke und Stefan George sowie der junge Hugo von Hofmannsthal am nächsten kommen.
Zum Inbegriff der französischen Décadence wird schließlich der Roman A rebours von Joris-Karl Huysmans. Der Protagonist dieses Buches, der Herzog des Esseintes, flieht vor der als feindlich empfundenen banalen Außenwelt auf seinen Landsitz, wo er sich in purer ästhetizistischer Haltung rauschhaften Genüssen aller Art hingibt und sich, mit einem Wort Hofmannsthals, „seine Welt in die Welt hineinbaut“[39]. Zur Theorie der Décadence trägt vor allem Paul Bourget bei, der in seinen Essais de psychologie contemporaine unter anderem einen Abschnitt explizit Théorie de la décadence betitelt und deutlich auf den Verlust sozialen Denkens beim dekadenten Menschen hinweist:
Si l’énergie des cellules [gemeint sind die einzelnen Zellen des (Staats-)körpers, die das gesamte Gebilde funktionieren lassen] devient indépendante, les organismes qui composent l’organisme total cessent pareillement de subordonner leur énergie a l’énergie totale, et l’anarchie qui s’établit constitue la décadence de l’ensemble.[40]
Der dekadente Ich-Kult wird wesentlich von Maurice Barrès Romantrilogie Le culte de moi bestimmt, die Hugo von Hofmannsthal in der „Modernen Rundschau“ rezensiert und dabei ausdrücklich die psychologischen Implikationen betont:
Es ist die Systematik des heutigen Lebens, die Ethik der modernen Nerven. [...] Der einsame Mensch, dessen Monolog wir lesen, schaut in sich und will seine Seele erkennen, ganz erkennen vom kleinsten bis zum größten. Er will sie erkennen, bis er sie besitzt, um sich ein Leben der Herrlichkeit zu gründen, Herr seines Ich und Wissender seines Empfindens.[41]
Der Begriff der Dekadenzliteratur läßt sich auf alle Nationalliteraturen jener Zeit anwenden. In England wird Oscar Wildes The picture of Dorian Gray zum programmatischen Buch der Dekadenz, in Italien prägt Gabriele D’Annunzios Il piacere den italienischen „decadentismo“. Sehr produktiv sind zu dieser Zeit auch die skandinavischen Dichter. Zu nennen sind hier vor allem Jens-Peter Jacobsen mit seinem Roman Niels Lyhne, Hermann Bang (z.B. Das weiße Haus) oder auch Arne Garborg mit dem bezeichnenden Romantitel Trætte maend (dt.: Müde Seelen).
2.1.1 Der Dekadenz-Begriff in der literarischen Wiener Moderne
In den Umkreis der Wiener Moderne kam der Décadence-Begriff vor allem durch die Vermittlung Hermann Bahrs, des großen Mentors der Jung-Wiener Autoren, mit dem auch Arthur Schnitzler Zeit seines Lebens eine Art Haßliebe verband.[42] Bahr war Ende der 80er-Jahre nach Paris gereist und bekam nun dort einen tiefen Einblick in die zeitgenössische französische Literatur. Neben einer grundsätzlichen Neubewertung des Naturalismus, den Bahr bis dahin vorbehaltlos propagiert hatte[43], kam er jetzt auch erstmals in Berührung mit der französischen Décadence-Literatur eines Joris-Karl Huysmans, eines Paul Bourget oder eines Maurice Barrès. Mit diesen neuen Lektüreerfahrungen war für Bahr der Zeitpunkt gekommen, sich vom Naturalismus abzusetzen, ihn produktiv zu überwinden, wie er es schließlich in seiner programmatischen Schrift Die Überwindung des Naturalismus von 1891 formulierte. Bahr gilt in der literarischen Moderne als geradezu zwanghafter Erneuerer:
Als der Naturalismus überwunden ist, geht es darum, den Symbolismus, die Neuromantik, die Mystik der Nerven oder wie immer er das zu nennen pflegte, ihrerseits zu überwinden, um zum Impressionismus zu gelangen; und alsbald [...] wird der Impressionismus verlassen und zugunsten des Expressionismus überwunden. Das nun hat in seinem Rigorismus keine Parallele mehr in der zeitgenössischen Literaturkritik.[44]
Diese Haltung Bahrs hat viel Kritik hervorgerufen, ist jedoch bezeichnend für die innere Einstellung seiner Zeit. In der Person Bahrs tritt sie allerdings in Reinform auf, worüber dieser sich selbst durchaus bewußt war:
Wenn Du [gemeint ist Bahrs Vater] in Deinem letzten Briefe meinst, meine Anschauungen und politischen und sozialen Wünsche würden, realisiert, mich sehr bald enttäuschen und mich ebenso zum Gegner haben wie die Gegenwart, so ist das nicht nur vollständig richtig, sondern sogar die eigentliche Quintessenz meiner Anschauung. Ich bin ein lebhafter Anhänger der gegenwärtig sich vorbereitenden sozialen Revolution, aber ich bleibe dieser Anhänger nur, solang sie unterdrückt ist und vergeblich nach Sieg ringt. An dem Tage, an dem sie diesen Sieg erringt, stehe ich mich allen meinen Sympathien ebensosehr auf der Seite ihrer Gegner, wie ich heute diese Gegner mit Haß verfolge. Mein Prinzip ist im Grunde nichts anderes als die Hegelsche Dialektik oder das ewige, unsterbliche pauta sei des dunklen Herakleitos. Alles wird in der Welt ohne Unterlaß, und wer einmal Glied dieser Welt, erfüllt seine Aufgabe nur, indem er an diesem ewigen Werden teilnimmt und es nach seinen Kräften unterstützt ... nichts Beharrendes, nur keine Dauer, nur kein Gleichbleiben! Fluß, Bewegung, Veränderung, Umsturz ohne Unterlaß: denn jedes Neue ist besser, schon weil es jünger ist als das alte.[45]
Bemerkenswert ist an dieser Stelle die Ähnlichkeit der Bahr’schen Terminologie mit bestimmten Gedanken der Lebensphilosophie, so vor allem der Vorstellung von einem steten Fluß des Lebens im Sinne des Heraklitischen pantha rei. Auch hieran läßt sich ersehen, wie stark grundsätzlich das Gedankengut einer Zeit durch die vorherrschenden Diskurse geprägt ist und daß die Annahme einer ständigen impliziten interdiskursiven Beeinflussung keineswegs abwegig ist.
1890 erschien Bahrs Essay-Sammlung Studien zur Kritik der Moderne. In diesem Band befindet sich unter anderem ein Die Décadence betitelter Aufsatz, in dem Bahr versucht, die grundsätzlichen Merkmale einer Literatur der Dekadenz herauszuarbeiten. Von einer „Hingabe an das Nervöse“, einer „Liebe des Künstlichen“ und einer „fieberischen Sucht nach dem Mystischen“[46] ist dort die Rede. Die neue Kunst der Dekadenz ist nach Bahr eine „Nervenkunst“:
Ich glaube also, daß der Naturalismus überwunden werden wird durch eine nervöse Romantik: noch lieber möchte ich sagen: durch eine Mystik der Nerven. Dann freilich wäre der Naturalismus nicht bloß ein Korrektiv der philosophischen Verbildung. Er wäre dann geradezu die Entbindung der Moderne: Denn bloß in dieser dreißigjährigen Reibung der Seele am Wirklichen konnte der Virtuose im Nervösen werden.[47]
Bahr betont die Sehnsucht nach Stimmungen, welche die dekadenten Dichter treibt, er prägt das Bild vom ästhetizistischen Künstler, der die rauhe Wirklichkeit nicht ertragen kann und in eine Welt der künstlichen Genüsse, der rauschhaften Übersteigerung flieht.
Der große Einfluß, den Bahrs Schriften ausübten, hat wesentlich mit dazu beigetragen, daß die Literatur Jung-Wiens lange Zeit als deutschsprachige Dekadenzliteratur schlechthin angesehen wurde. Diese Sichtweise hat sich mittlerweile als eindimensional herausgestellt, auch wenn neben dem Werk Schnitzlers vor allem bei Hugo von Hofmannsthal Dekadenz und Ästhetizismus Grundkonstanten des Frühwerks sind. Verkörpert werden sie etwa durch die Figur des Andrea in Hofmannsthals lyrischem Einakter Gestern, der sein Leben ganz auf den Genuß des Augenblicks auslegt und das ‚Gestern‘ verneint:
Laß dir des Heute wechselnde Gewalten, / Genuß und Qualen, durch die Seele rauschen,/ Vergiß das Unverständliche, das war:/ Das Gestern lügt und nur das Heut ist wahr!/ Laß dich von jedem Augenblicke treiben,/ Das ist der Weg, dir selber treu zu bleiben;/ Der Stimmung folg, die deiner niemals harrt,/Gib dich ihr hin, so wirst du dich bewahren,/ von Ausgelebtem drohen dir Gefahren:/ Und Lüge wird die Wahrheit, die erstarrt![48]
Ein grandioses Beispiel für den Kult der Stimmungen und Nerven ist auch der vom jungen Hofmannsthal unter seinem Pseudonym Loris geschriebene Prolog zu Schnitzlers Anatol, der eine leichte, schwebende Stimmung beschwört, die sich vollkommen im Ästhetischen verliert. Sowohl in weiteren lyrischen Dramen, wie dem Tod des Tizian als auch in den Gedichten der Jugendjahre lassen sich weitere Belege für die ästhetizistische Haltung des jungen Hofmannsthal finden.
Darüber hinaus gibt es unter den Autoren der Wiener Moderne fast keinen, der nicht mit irgendeinem Werk der Dekadenzliteratur zugerechnet werden kann. Berühmte Beispiele dafür sind Richard Beer-Hofmanns Der Tod Georgs, Leopold Andrians Der Garten der Erkenntnis oder auch Felix Dörmanns Lyriksammlung Neurotica. Die literarische Qualität ihrer Schriften ist allerdings stark unterschiedlich. Dörmann etwa bleibt einem oberflächlichen Dekadenzbegriff verhaftet. So gilt etwa sein Gedicht „Was ich liebe“ als
prototypischer Ausdruck des dekadenten Lebensgefühls [...], wie es sich so unverfälscht, ungebrochen und unkritisch bei keinem Dichter der Wiener Moderne wiederfindet.[49]
2.1.2 Motive und Themen der Dekadenzliteratur – Eine Übersicht
Im vorangegangenen Kapitel wurde der Dekadenzbegriff vor allem anhand konkreter Werke erhellt, die charakteristisch sind und begriffsbildend gewirkt haben. Hier soll nun ergänzend eine kurze Übersicht über die wichtigsten inhaltlichen Merkmale gegeben werden. Dabei werden die Motive und Charaktere etwas ausführlicher dargestellt, die für Arthur Schnitzlers Werk von Bedeutung sind.
Wie Erwin Koppen anmerkt, resultieren die Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Symbolismus und Dekadenz vor allem aus der Tatsache, daß zu viel Wert auf stilistisch-formale Elemente gelegt wurde.[50] Diese müssen jedoch als wesentlich lediglich für den Symbolismus betrachtet werden, da dieser sie sich als poetologisches Programm zu Grunde legt und sich in seinem Selbstverständnis über sie definiert.
Dekadenz dagegen stellt, wie Koppen anmerkt,
eine Haltung dem Leben und der Gesellschaft gegenüber [dar], dessen literarische Phänomene weniger in der Sprache als in bestimmten gehaltlichen Charakteristika (Motiven, Charakteren usw.) in Erscheinung treten.[51]
Der ausgeprägte Haß gegenüber den Erscheinungen der industriellen Revolution im Laufe des 19. Jahrhunderts, der durch sie entstehenden Vermassung und dem menschenfeindlichen technischen Fortschritt sind Merkmale der in künstlichen Eigenwelten existierenden Dekadenzliteratur. Der Begriff der Künstlichkeit ist im Zusammenhang mit Dekadenzliteratur ganz besonders wichtig, das läßt sich auch an Texten Schnitzlers nachweisen. Künstlich sind die Gegenwelten, die von den dekadenten Charakteren entworfen werden. Huysmans‘ A rebours kann hier einmal mehr als paradigmatisches Beispiel dienen: Des Esseintes‘ Lebensentwurf ist der allgemeinen lebensweltlichen Wirklichkeit seiner Zeitgenossen so weit entrückt, daß es keinen Weg zurück zu geben scheint. Der künstliche Weltentwurf des Décadents versteht sich als bewußte Abgrenzung von dem, was in der bürgerlichen Welt als Fortschritt verstanden wurde, nämlich der nüchterne, technokratische, gleichsam vom gefühlten Menschsein entfremdende Fortschritt. Koppen sieht die Dekadenzliteratur in diesem Sinne in einer Traditionslinie mit anderen antibürgerlichen Tendenzen am Ende des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts: „sie [die Dekadenzliteratur] stünde also zwischen früher französischer Bohème, Mailänder Scapigliatura, Schwabing, Existenzialistenkeller, Beat und Hip.“[52] In der Künstlichkeit fühlt sich der dekadente Mensch weder dem unkontrollierten Willen der Natur ausgesetzt, noch einem banalen technischen Fortschrittsglauben, sondern kann das ästhetische Dasein bis ins Extrem steigern. So ist beispielsweise auch der Frühling eine den Décadents verhaßte Jahreszeit, da er als Symbol für die wiedererwachende Natur gilt. Darin liegt natürlich auch ein äußerst lebensfeindliches Element, denn die Natur erwacht ja gerade im Frühling zu neuem Leben. Hier entfernt sich die dekadente Haltung ganz offensichtlich vom Leben, sie bricht bewußt mit der Tradition, die die keimende Natur des Frühlings als Symbol der Hoffnung auffaßte. Baudelaire formuliert die Ablehnung der Natur in einem Brief so:
Ich werde niemals glauben, daß die Seele der Götter in den Pflanzen wohnt, und selbst, wenn sie dort wohnen sollte, kümmerte mich das wenig, und ich würde meine eigene für ein sehr viel höheres Gut halten als jene der geheiligten Gemüse. Ich war sogar immer der Ansicht, daß die Natur, in ihrem Blühen, ihrem Sicherneuern etwas Trauriges, Hartes, Grausames an sich hat, fast etwas Schamloses.[53]
Die Ablehnung alles Naturhaften geht sogar so weit, daß der Zeugungsakt, als dem Hervorbringen neuen natürlichen Lebens dienend, radikal abgelehnt wird.[54]
Eine zentrale Rolle im Rahmen der Dekadenz-Motivik spielen erotische Motive. Erotik findet in der Dekadenzliteratur vornehmlich flüchtig und als Augenblicksseligkeit statt. Sie dient rein dem Genuß, der Befriedigung oberflächlich sexueller Bedürfnisse. Jegliche Moralgesetze verlieren ihre Gültigkeit, sie werden der Sucht des Décadents nach immer stärkeren Reizen geopfert. Gerade dieser Punkt hat im Zusammenhang mit dem Werk Arthur Schnitzlers für viele Mißverständnisse gesorgt. Die häufige Darstellung erotischer Motive bei Schnitzler ist zwar teilweise Zeichen der Dekadenz, trägt jedoch auf Grund der Darstellungsweise den Keim der Dekadenzkritik immer schon in sich. Mit der verstärkten Verwendung erotischer Motive geht auch die Verwendung des Typus der Kurtisane einher. Diese steht sinnbildlich für die freie, vom Zwecke der Fortpflanzung entbundene Erotik. Otto Weininger ging sogar so weit, alle Frauen in zwei Grundtypen aufzuteilen: die Mutter und die Dirne.[55] Weininger verweist hier deutlich darauf, wo der Unterschied zwischen beiden Typen zu suchen sei: „Die Mutter steht ganz unter dem Gattungszweck; die Prostituierte steht außerhalb desselben.“[56] Die Kurtisane also bedient genau die Bedürfnisse des Décadents nach Liebe ohne Verantwortung und Konsequenzen. Sie ist in der dekadenten Literatur ein positiv bewerteter Typus. Es ist dem Mann, der sich ihrer bedient, durchaus möglich, sich in diese Frau zu verlieben, gerade auf Grund der Tatsache, daß sie echte, ungetrübte Leidenschaft vermittelt. Christian Buddenbrook in Thomas Manns Die Buddenbrooks ist ein typischer Fall des nervenkranken Décadents, der sich mit Kokotten einläßt und schließlich sogar eine davon, Aline Puvogel, heiratet. Ihr Pendant findet die positive literarische Darstellung der Kurtisane in der Malerei, man denke an so berühmte Bilder wie Manets Nana, die auch in Verbindung zur gleichnamigen Titelheldin des Romans von Emile Zola steht. Zola, der große Naturalist, ist im übrigen in vielen seiner Werke motivisch durchaus in der Nähe der französischen Décadence angesiedelt und hat seine Einstellung 1866 auch deutlich formuliert:
Mon goût, si l’on veut, est dépravé; j’aime les ragoûts littéraires fortement épicés, les œuvres de décadence où une sorte de sensibilité maladive remplace la santé plantureuse des époques classiques. Je suis de mon âge.[57]
Zwei gerne verwendete Frauentypen der Dekadenz hängen mit der spezifischen Sichtweise der Erotik zusammen: die „femme fatale“ und die „femme fragile“. Beide Typen finden sich in der „femme enfant“ vereinigt wie Schnitzler sie in der Figur der Beatrice Nardi gestaltet hat (vgl. Kap. 3.3). In der das rauschhafte Leben symbolisierenden „femme fatale“ hat sich dabei etwas Elementares, auf reiner Sinnlichkeit Beruhendes erhalten, nach dem sich der Mann in der technisierten Fortschrittswelt sehnt. Sie symbolisiert die ursprüngliche Macht der Natürlichkeit und hat dabei sogar etwas Tierisches an sich. Im Prolog zu Frank Wedekinds Lulu-Tragödie Erdgeist wird diese Sichtweise der Frau am Beispiel der Lulu ganz deutlich, wenn der Tierbändiger sie als „unsre Schlange“ ankündigt:
Sie ward geschaffen, Unheil anzustiften, / Zu locken, zu verführen, zu vergiften - / Zu morden, ohne daß es einer spürt / [...] Du hast kein Recht, uns durch Miaun und Fauchen / Die Urgestalt des Weibes zu verstauchen, / [...] Du sollst – drum sprech‘ ich heute sehr ausführlich - / Natürlich sprechen und nicht unnatürlich![58]
Auch hier führt die Sichtweise Weiningers wieder in diese Richtung, der von der „Wesenlosigkeit“[59] der Frau spricht, deren einzige Funktion darin bestehe, den Gegenpol zur männlichen Göttlichkeit zu bilden:
Der S i n n des Weibes ist es also, N i c h t – S i n n zu sein. Es repräsentiert das N i c h t s, den Gegenpol der Gottheit, die a n d e r e M ö g l i c h k e i t im Menschen.[60]
Auch zum Mythos der „femme fatale“ ist wieder der Querverweis zum Werk Zolas angebracht, dessen Bezüge zur Décadence kaum unterschätzt werden können. Seine Figur der Nana ist genau jene männervernichtende ursprüngliche Naturgewalt, wie sie auch Lulu repräsentiert; eine Tatsache, die man sogar aus beider Namen ableiten könnte, die aus etwas wie einem „naiven Urlaut“[61] bestehen.
Der Verweis auf Schnitzler liegt beim Motiv der Erotik nah, die Thematisierung von dekadenter Erotik – man denke nur an den Anatol –, zieht sich bei ihm durch das Gesamtwerk, viele seiner Figuren sind lust- und triebbestimmt, was diese immer wieder in ausweglose Situationen bringt.
Ein Motiv der Décadence, welches auch für die in dieser Arbeit thematisierte Dialektik von Dekadenz und Lebensphilosophie von entscheidender Bedeutung ist, ist das Motiv des „Wissens um Verlorenes“[62]. Angesprochen wird damit die Tatsache, daß im Erkennen und Darstellen dekadenter Zustände das Wissen um den positiven Zustand immer impliziert ist. Wenn Rasch feststellt, die Autoren der Décadence wüßten, daß die Werte der „Gesundheit, Lebenskraft, Tatkraft“ für „die eigene Zeit verloren“[63] sind, ist darin gleichzeitig auch die Erkenntnis enthalten, daß es gelte, diese Werte für die Zukunft als normativ wiederherzustellen bzw. ihre Geltung als erstrebenswert erscheinen zu lassen. Der Décadent selbst ist zu schwach, um die Anstrengung zu vollbringen, seinen Zustand zu überwinden, daher verfällt er der Ästhetik des Häßlichen. Er sieht im Verfall der Schönheit ihren ganzen Glanz und geht in diesem Gefühl auf. Das Vergangene verleiht in diesem Fall dem Gegenwärtigen seine Schönheit. An diesem Punkt zeigt sich deutlich das Ineinanderverschmelzen von Lebensverneinung und –bejahung in der Dekadenz. Jede Darstellung von Verfall und Untergang - scheine sie zunächst auch noch so kritiklos - trägt immer die Möglichkeit des Gegenteils in sich.
2.2 Zum Begriff des Lebens in der Philosophie
Es ist nicht die Gerechtigkeit, die hier zu Gericht sitzt; es ist noch weniger die Gnade, die hier das Urteil verkündet: sondern das Leben allein, jene dunkle, treibende, unersättlich sich selbst begehrende Macht.
[Friedrich Nietzsche]
Leben ist das Grundwort der Epoche, ihr Zentralbegriff, vielleicht noch ausschließlicher geltend, als der Begriff der Vernunft für die Aufklärungszeit oder der Begriff Natur für das spätere 18. Jahrhundert.[64]
Diese Feststellung Wolfdietrich Raschs, die dem Leben einen so immens hohen Stellenwert zuweist, erscheint umso erstaunlicher, da sehr viel öfter die Zeit der Jahrhundertwende mit negativ konnotierten Begriffen belegt wurde. Dekadenz (in der einseitig negativen Bedeutung des Wortes), Todessehnsucht, Untergangsstimmung, Zerfall des Individuums, Flucht in den Ästhetizismus oder nihilistische Sinnverneinung, all dies gilt als Kennzeichen der Dichtung und Philosophie der Jahrhundertwende und entwirft insgesamt ein eher düsteres Bild jener Zeit.
Die Schwierigkeiten, die hier auftreten, mögen etwa darin begründet sein, daß „Leben“ ein eher unscharfer und sehr allgemeiner Begriff ist und es einer genaueren Bestimmung bedarf, welche Bedeutung ihm philosophiegeschichtlich zukommt. Es existiert keine philosophische Schule, die eine einheitliche Definition des Lebensbegriffes in die Philosophiegeschichte eingebracht hätte. Man hat es hier oft nur mit einem Teilaspekt der philosophischen Theorien verschiedener großer Denker zu tun. Bei all diesen Theorien steht der Begriff des Lebens derart im Mittelpunkt der Betrachtung, daß man dafür den Begriff „Lebensphilosophie“ gefunden hat. Auch dieser ist zunächst durchaus problematisch, ist er doch heute auch in der Umgangssprache tief verankert. Möchte jemand seine grundsätzlichen Überzeugungen mitteilen, spricht er dementsprechend leicht von seiner „Lebensphilosophie“. Auch konstatiert Otto Friedrich Bollnow eine „gewisse gedankliche Unbestimmtheit“[65] bezüglich des Begriffs „Lebensphilosophie“, die diese zugunsten der terminologisch schärferen und zudem den Seinsbegriff in den Mittelpunkt stellenden Existenzphilosophie der Heidegger-Schule in den Hintergrund gerückt habe. Der Neukantianer Heinrich Rickert, einer der schärfsten Kritiker der Lebensphilosophie, sieht diese als reine Modephilosophie, die an ihrer begrifflichen Unbestimmtheit kranke. Nach Rickert muß philosophisches Denken eine systematische Grundlage besitzen: „Die Philosophie braucht Prinzipien, die gliedern und gestalten.“[66] Der Lebensphilosophie wirft Rickert dann auch vor allem ihre „Prinzipienlosigkeit“ vor. Allerdings hat schon Nietzsche dieser Neigung zur Systembildung eine Absage erteilt: „Ich mißtraue allen Systematikern und gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit.“ (GAG, 84)
Wenn in dieser Arbeit von Lebensphilosophie gesprochen wird, ist eine geistige Haltung gemeint, die den Begriff des Lebens als ihren zentralen Bezugspunkt nimmt und Denken sowie Handeln an ihm ausrichtet. Es wird daher auch nicht darum gehen, künstlich einen Bezug Arthur Schnitzlers zu den Positionen der Lebensphilosophie zu konstruieren. Gezeigt wird vielmehr die spezifische Interpretation des Lebensbegriffs bei Schnitzler, die aber von der zeitgenössischen Lebensphilosophie als „kulturelles Wissen“ im Sinne Titzmanns (vgl. Kap. 1) durchaus beeinflußt ist.
Wie zentral dieser Begriff um die Jahrhundertwende war, mag sich auch daran ablesen lassen, daß er nicht auf Dichtung und Philosophie beschränkt blieb. Auch ein berühmter Architekt wie Otto Wagner, der ebenfalls der Wiener Moderne zugerechnet wird, formulierte 1895 im Vorwort seines berühmtesten Architekturlehrbuchs Die Baukunst dieser Zeit:
Ein Gedanke beseelt die ganze Schrift, nämlich der, dass die Basis der heute vorherrschenden Anschauungen über die Baukunst verschoben werden und die Erkenntnis durchgreifen muß, daß der einzige Ausgangspunkt unseres künstlerischen Schaffens nur das moderne Leben sein kann.[67]
Das späte 19. Jahrhundert gilt als Zeitalter der großen naturwissenschaftlichen Entdeckungen, wissenschaftliches Arbeiten stand im Zeichen des Positivismus‘. Man glaubte, die vielfältigen Erscheinungen der Welt durch Sammeln von Fakten erklären und damit vielleicht auch bis in die letzten Geheimnisse vordringen zu können.
Auch Arthur Schnitzler war mit dieser Grundtendenz seiner Zeit in ständiger Berührung, hatte er doch eine medizinische Ausbildung genossen, die nur auf strengster Vermittlung von gesicherten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen konnte. Immer wieder wurde daher nachzuweisen versucht, daß Schnitzler als Dichter einen lediglich nüchtern-rationalen Standpunkt einnehme und seine Figuren zu medizinisch-psychologischen Studienobjekten degradiere. Dieses Urteil wurde bereits zu Lebzeiten des Dichters von Josef Körner formuliert:
Er [Schnitzler] ersinnt eine Anzahl von Figuren, die ihm den ‚Fall‘ gleichsam vorspielen, und so erhalten jene nur eine sekundäre Bedeutung. [...] Ihm ist es nicht um die individuelle Ausgestaltung seiner erdichteten Personen zu tun, - sie interessieren ihn nur so weit, als er seinen ‚Fall‘ an ihnen studieren kann, - er sagt von ihnen nur so viel, als für das Verständnis des Falles unbedingt nötig ist. Arthur Schnitzler, Mediziner von Beruf, steht zu den Gestalten seiner Dichtung wie der Arzt zu seinen Patienten, als welcher für seine Anamnesen ja auch nicht vollständiger Biographien bedarf.[68]
Dieses Urteil hält sich seitdem hartnäckig, so daß noch 1996 Dirk von Boetticher von der
Bedeutung seiner [Schnitzlers] medizinischen Herkunft nicht nur für die Themenwahl, sondern auch für seine ‚Weltanschauung‘ und künstlerische Haltung im ganzen[69]
sprechen kann.
Es läßt sich nicht bestreiten, daß der medizinische Aspekt eine wesentliche Rolle in Schnitzlers Werk spielt, allein konstitutiv ist er jedoch nicht. So ist auch verschiedentlich betont worden, daß eindeutige Zuordnungen bei Schnitzler zu kurz greifen:
Wenn Schnitzler wiederholt bedauert, daß weder der Lehrplan noch die häusliche Erziehung auf das Sehen – und Schauenlernen angelegt waren, dann ist damit die Vorherrschaft des bloß quantifizierenden Begriffs über die Anschauung, des Gesetzes über das lebendige Detail angedeutet.[70]
Auch Geißler betont, „die Nachahmung der Experimentierhaltung bekomm[e] im Kunstwerk [...] eine andere Intention als bei den Naturwissenschaften.“[71]
Der folgende Abschnitt soll zunächst einen kurzen Abriß dessen geben, was philosophiegeschichtlich in den Kontext der Lebensphilosophie einzuordnen ist. Diese Übersicht ist allerdings nicht als komplette Geschichte der Lebensphilosophie zu verstehen, sondern soll bereits auf diejenigen Aspekte hinführen, die im Hinblick auf lebensphilosophische Ansätze bei Schnitzler interessant sein könnten. Dazu gehört auch die zentrale Kategorie des Erlebnisses, die im Anschluß an die historische Begriffsherleitung dargestellt wird.
2.2.1. Anfänge einer Philosophie des Lebens
Die Aufklärung hatte das Gewicht ganz auf die Vernunftbegabtheit des Menschen gelegt. Gefühle und Stimmungen wurden in den Hintergrund gedrängt, der Glaube, die Erscheinungen der Welt allein mit Hilfe des Verstandes erklären zu können, verweist bereits auf die positivistischen Tendenzen des 19. Jahrhunderts. Im Zusammenleben der Menschen führte diese Sichtweise zu einer immer starrer werdenden Moralordnung. Dagegen wendete sich der Sturm und Drang. Gefühl wurde groß geschrieben, die Bezeichnung „Erlebnisdichtung“ verweist zudem mit ihrem zentralen Begriff des Erlebnisses schon in dieser Zeit auf lebensphilosophische Tendenzen. (vgl. Kap. 2.2.2) Belege hierfür finden sich beispielsweise bei Herder[72], der bereits in den Briefen zur Beförderung der Humanität vom „Alleben“[73] sprach, welches die übergeordnete Einheit des Lebens symbolisiere.
Auch Goethes Begriff von „Polarität und Steigerung“ (HA 13, 48) gehört in diesen Zusammenhang. Gegensatzpaare wie Systole und Diastole bezeichnen bei Goethe die Einheit des Lebens. Es gehören immer beide Seiten zum Leben, sie sind nur Teile eines allumfassenden Ur-Lebens.
Wichtig für die Jahrhundertwende ist die im Sturm und Drang entstehende antirationalistische Tendenz des Lebensbegriffs. Leben wurde verstanden als Betonung von Gefühl und Empfindung, nicht im sentimentalen Sinne einer Empfindsamkeitsdichtung, die bloße Gefühlsschwärmerei propagiert, sondern in Richtung auf Werther’schen Gefühlsrausch, der die Unbedingtheit des Gefühls in den Vordergrund rückt. Auch die enge Verquickung von Dichtung und Philosophie, die sich an dieser Stelle bereits andeutet, findet sich im Fin de siècle wieder; Nietzsche bildet hier das Extrem, da er beides in einer Person zu vereinigen wußte.
Wie bei so vielen Phänomenen der geistigen Haltung der Jahrhundertwende sind wichtige Ansätze auch hinsichtlich des Lebensbegriffs in der Romantik zu finden. Im Wintersemester 1800/01 hielt Friedrich Schlegel an der Universität Jena eine Vorlesung mit dem Titel Über Transzendentalphilosophie. Diese nur aus Nachschriften bekannte Vorlesung ist deshalb interessant, weil in ihr zum ersten Mal explizit der Begriff einer „Lebensphilosophie“ gebraucht wurde. Schlegels Bedeutung hinsichtlich der Lebensphilosophie liegt hauptsächlich in der Begriffsentwicklung, wie sie etwa in dem Vorlesungszyklus über die „Philosophie des Lebens“[74] aus den Wiener Jahren stattfindet. Schlegels Anspruch besteht in einem grundsätzlichen Neuanfang der Philosophie, da er den Idealismus in einer Sackgasse sieht. „Leben“ dient Schlegel dabei als der zentrale Bezugspunkt allen Philosophierens, jedoch nicht in einem vitalistischen Sinn, sondern als „geistiges inneres Leben zwischen Himmel und Erde“[75], das die „eigentliche Region der Philosophie“[76] darstelle. Sie verweist auf das „höchste Leben“[77] und versteht sich als „wahre Gottesphilosophie“[78].
Auch greift Schlegel – vor allem in seinem Roman Lucinde - das Verhältnis der Geschlechter auf, ein durchaus typisches Thema der Lebensphilosophie und nicht zuletzt eines der zentralen Themen im Werk Schnitzlers, wenn auch dort in anderer Ausprägung.
Der entscheidende Unterschied romantischer Philosophie vom Leben im Vergleich zur Lebensphilosophie der Jahrhundertwende liegt dabei im Glauben an die Existenz eines Gottes, der Symbol des überindividuellen Lebens ist, das die Absolutheit der Begriffe Leben und Tod relativiert.
Für die Argumentationsweise lebensphilosophischer Denker ist auch die Entwicklung dezidiert dialektischen Denkens durch Hegel von einer gewissen Bedeutung. Zwar läßt sich Hegel nicht ohne weiteres in eine Traditionslinie lebensphilosophischer Modelle setzen, doch ist gerade die Bildung von Gegensatzpaaren und das Denken in Polaritäten ein sehr wesentliches Merkmal der Lebensphilosophie, sie ist somit im Ansatz dem Hegel‘schen Denken durchaus verpflichtet. Auch bei Schnitzler ist besonders in den Aphorismen und essayistischen Versuchen wie beispielsweise Der Geist im Wort und der Geist in der Tat immer wieder eine dialektische Denkweise zu beobachten, die er selbst durchaus als Belastung empfand; so spricht er im Tagebuch von seiner „Neigung zur Dialektik, die nicht nur ein künstlerischer, die einer meiner Wesensfehler ist.“ (Tgb., 13.IX.1923)
2.2.2 Arthur Schopenhauer
Der erste inhaltlich für die Lebensphilosophie der Jahrhundertwende wirklich bedeutende Denker ist Arthur Schopenhauer. In seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung erscheint mit dem „Willen zum Leben“ einer der Ur-Gedanken aller künftigen Lebensphilosophie. Nach Schopenhauer ist der „Wille zum Leben“ das Urprinzip menschlicher Existenz. Noch bevor der Mensch anfängt, geistig tätig zu werden, existiert in ihm bereits der sich rein körperlich äußernde Lebenswille. Der Mensch atmet, ißt, trinkt, schläft, liebt usw., d.h. er führt eine Menge vorbewußter, jedoch zielgerichteter Tätigkeiten aus, sein Leib ist die Objektivation des Willens zum Leben. Die Welt als Vorstellung ist erst der zweite Schritt, denn die Welt, wie der Mensch sie in seiner Vorstellung erkennt, erscheint erst infolge des Willens zum Leben. Die Vorstellung wiederum zeigt dem Willen sein Ziel:
Der Wille, welcher rein an sich betrachtet erkenntnislos und nur ein blinder, unaufhaltsamer Drang ist, wie wir ihn noch in der unorganischen und vegetabilischen Natur und ihren Gesetzen wie auch im vegetativen Teil unseres eigenen Lebens erscheinen sehn, erhält durch die hinzugetretene, zu seinem Dienst entwickelte Welt der Vorstellung die Erkenntnis von seinem Wollen und von dem, was es sei, das er will, daß es nämlich nichts anderes sei als diese Welt, das Leben, gerade so, wie es dasteht. (WW I/2, 347)
Die Dimension des Lebensbegriffs in der Philosophie Schopenhauers läßt sich gut erkennen. Auch die Erfahrung des Todes erscheint in einem anderen Licht, denn der Wille zum Leben ist ein zeitloses, überindividuelles Prinzip, das mit dem medizinischen Tod des menschlichen Körpers nichts zu tun hat. „Tod ist ja nicht Tod, ist nur eine Phase sich fortgebärenden, unersättlichen Lebens“[79], mit dieser Erkenntnis wird auch jegliche metaphysische Spekulation über ein Leben nach dem Tode obsolet, denn das einzelne Individuum verliert emminent an Wichtigkeit im großen Spiel des Lebens.
Angesichts der Häufigkeit des Todesmotivs im Werk Arthur Schnitzlers sind diese Erkenntnisse nicht ohne Bedeutung für diese Arbeit. Sie werfen ein anderes Licht auf all die Figuren, denen eine Verfallenheit an den Tod nachsagt wird. Auch die Vorstellung vom Willen als „Ding an sich“, dem gegenüber dem rationalen Denken der Primat eingeräumt wird, ist anhand der Triebhaftigkeit der meisten Figuren leicht als eine implizite Grundkonstante in Schnitzlers Werk zu sehen. Der Schopenhauer’sche Wille ist nicht als freier Wille des selbstbestimmten Subjekts im Sinne Kants zu verstehen, sondern als unabhängige, absolute Erscheinung des Lebens. Diese Ansätze lassen sich unschwer mit den psychologischen Erkenntnissen bezüglich der Triebhaftigkeit des Menschen um die Jahrhundertwende in Beziehung setzen; „Wille“ und „Trieb“ sind in ihrer Grundannahme ähnliche Begriffe. Stärkste Äußerung des Willens zum Leben ist nach Schopenhauer der Geschlechtstrieb, der darauf ausgerichtet ist, durch die Zeugung von Nachkommen das Leben als Prinzip über das individuelle Leben hinaus zu erhalten. Schopenhauer bezieht damit Frontalstellung zu Kant und Hegel und wird zum Theoretiker eines modernen Irrationalismus.
Was Schopenhauer zum eigentlichen Begründer der Lebensphilosophie macht, ist das Loslösen des Lebens von metaphysischen Bezugspunkten. Es ist das ganz diesseitige Leben mit seinem durch den Willen hervorgerufenen Leid, welches im Mittelpunkt des Interesses steht. Dieser Gedanke unterscheidet Schopenhauer beispielsweise emminent von Friedrich Schlegel und dessen „Philosophie des Lebens“ als „wahrer Gottesphilosophie“ (vgl. S. 28). Der „Wille zum Leben“ bezieht sich vollständig auf die konkreten Lebensäußerungen des Menschen.
Das Leid wird dabei durch das sogenannte „principio individuationis“ erzeugt; dadurch, daß in allen Menschen ein irrationaler Wille steckt, der sich anhand des Intellektes viele verschiedene Objektivationen sucht, verliert die Welt ihre ursprüngliche Einheit. Das ständig weiterstrebende Wollen, das nie einem Endpunkt findet, erfüllt den Menschen entweder mit Schmerz oder mit Langeweile. Schmerz tritt dann ein, wenn sich die Objektivationen des Willens nicht realisieren lassen, der Mensch also konkrete materielle Not erfährt. Die Abwesenheit dieser materiellen Not jedoch löst die Langeweile aus, da der immer noch vorhandene Wille quasi ins Leere läuft und so die Nichtigkeit des Daseins spürbar macht. Leicht läßt sich auch hier wieder eine Verbindung zu den dekadenten Lebemännern des Schnitzler’schen Werkes herstellen, bei denen die Langeweile sich in den verschiedensten Verhaltensweisen äußert.
Der Mensch befindet sich demnach in einer Art Kreislauf. Das ständige Wollen erzeugt Schmerz, aus dem wieder neues Wollen hervorgeht, um den Schmerz zu überwinden. Der aus der Überwindung resultierende Genuß allerdings erzeugt wieder neues Wollen, hat darüber hinaus nicht die Unmittelbarkeit der Schmerzerfahrung, ist also gegenüber dieser negativ zu sehen.
Es ist mithin die Grunderfahrung des Schopenhauer’schen Pessimismus‘, daß der Wille zum Leben letztendlich nur negative Auswirkung hat. Davon ausgehend gelangt er zu seiner Forderung nach der Verneinung des Willens zum Leben. Er entwickelt diese Forderung anhand seiner Mitleidstheorie. Die Bejahung des Willens zum Leben ist nach Schopenhauer ein egoistisches Prinzip. Jedes einzelne Individuum hat Angst vor dem Ende seiner physischen Existenz durch den Tod. Schopenhauer führt diese Angst ad absurdum:
Das, was er [der Tod] ist, das zeitliche Ende der einzelnen zeitlichen Erscheinung. [...] was wir im Tode fürchten, ist in der That der Untergang des Individuums, als welcher er sich unverhohlen kund giebt, und da das Individuum der Wille zum Leben selbst in einer einzelnen Objektivation ist, sträubt sich sein ganzes Wesen gegen den Tod. – Wo nun solchermaßen das Gefühl uns hülflos Preis giebt, kann jedoch die Vernunft eintreten und die widrigen Eindrücke desselben großentheils überwinden, indem sie uns auf einen höhern Standpunkt stellt, wo wir statt des Einzelnen nunmehr das Ganze im Auge haben. (WW I/2, 357)
„Das Ganze im Auge haben“, diese Forderung kann nicht eingelöst werden, solange das Individuum seine Aufmerksamkeit auf sein eigenes Leiden fokussiert. Indem der Einzelne aber über sich selbst hinausgeht und sein Augenmerk auf das Leiden seiner Mitmenschen richtet, hat er die Möglichkeit, eine neue Leiderfahrung hervorzurufen, nämlich die des Mitleidens. Der Mensch erkennt auf diese Weise, daß auf der ganzen Welt die stete Bejahung des Willens zum Leben überall nur Leid hervorruft. Da durch die Öffnung zum Ganzen hin die Relevanz der Individualität ohnehin geschwächt ist, kann der Mensch auch erkennen, daß die ständige Bejahung des Willens zum Leben eine negative Erscheinung ist. Er gelangt somit zu der Überzeugung, daß das wahre Glück in der Entsagung liegt, mithin in der Verneinung des Willens zum Leben.
Als Vorstufe dazu steht bei Schopenhauer der kontemplative Kunstgenuß, insbesondere der Musikgenuß als Objektivation des reinen Willens. Die Kunst ist die einzige Sphäre, in der das Individuum sich des Willens entheben kann und in reiner Anschauung aufgeht. Dieses Phänomen ist allerdings auf den Augenblick des konkreten Kunstgenusses beschränkt.
Die Fähigkeit zum Mitleiden ist hingegen die sittliche und dauerhafte Möglichkeit, sich vom Willen zu lösen. Der Unterschied zur christlichen Mitleidsidee liegt dabei in der Erkenntnis des Schopenhauer’schen Menschen von der „schicksalhaften Kameradschaftlichkeit der absurden Leidenssituation menschlich-weltlichen Daseins überhaupt.“[80]
Viele Grundpositionen der Lebensphilosophie zur Jahrhundertwende sind im Werk Arthur Schopenhauers bereits angelegt, so daß mit Recht in einem Einführungsbändchen der Zeit bemerkt werden konnte: „Fast jeder tiefere Geist unseres Zeitalters ist durch ihn hindurchgegangen.“[81] Als Beleg für die seiner Zeit vorauseilende Gedankenwelt kann man auch die zeitgenössische Rezeption Schopenhauers anführen, die ihn – vor allem im Vergleich zu seinem Erzfeind Hegel – stark in den Hintergrund rückte. Sein Ruhm, dessen er selbst sich immer sicher war, begann sich erst in den letzten Lebensjahren allmählich abzuzeichnen und fand dann mit den zunehmend antipositivistischen Tendenzen des ausgehenden 19. Jahrhunderts einen Höhepunkt. Wie stark prägend dabei der Gedanke des Lebens war, geht auch schon aus der Tatsache hervor, daß Schopenhauer den Beginn der Philosophie mit dem Gedanken an den Tod ansetzte:
Hingegen ist die hieraus entspringende philosophische Verwunderung [der Urgrund der Philosophie nach Aristoteles] im Einzelnen durch höhere Entwicklung der Intelligenz bedingt, überhaupt jedoch nicht durch diese allein; sondern ohne Zweifel ist es das Wissen um den Tod, und neben diesem die Betrachtung des Leidens und der Noth des Lebens, was den stärksten Anstoß zum philosophischen Besinnen und zu metaphysischen Auslegungen der Welt giebt. (WW II/1, 187)
Das negierende Prinzip Tod als Grund des Nachdenkens über das Leben, diesen Ansatz hat die Dichtung der Jahrhundertwende in vielfältiger Auslegung produktiv aufgegriffen und aus der jeweils spezifischen Sichtweise ihrer Autoren gedeutet. Das Todesmotiv im Werk Arthur Schnitzlers in Hinsicht auf die Deutung des Lebensbegriffs wird im zweiten Teil dieser Arbeit Teil der Textinterpretationen sein.
2.2.3 Sören Kierkegaard
Sören Kierkegaard gilt allgemein als einer der wesentlichen Wegbereiter der Existenzphilosophie des 20. Jahrhunderts. Angesichts des engen Zusammenhanges zwischen Existenz- und Lebensphilosophie gibt in seinem Gedankengebäude jedoch gewisse Bausteine, die ihn im Rahmen dieser Arbeit für lebensphilosophische Ansätze ebenso interessant machen.
Schon vom ersten Werk an, seiner Dissertation mit dem Titel Über den Begriff der Ironie mit ständiger Rücksicht auf Sokrates, steht bei Kierkegaard das individuelle Verhalten des Subjektes gegenüber der Wirklichkeit und damit dem Leben im Mittelpunkt. Mittels Ironie kann sich der Mensch über die Diskrepanz zwischen Idee und Wirklichkeit hinwegsetzen und eine sehr subjektive Haltung konstituieren. In dieser subjektiven Haltung liegt jedoch gleichzeitig auch die Gefahr der Ironie, sie isoliert den Einzelnen und stößt ihn ins Nichts:
Kehren wir nun aber zurück zu der [...] allgemeinen Kennzeichnung der Ironie, als der unendlichen absoluten Negativität, so ist mit ihr zur Genüge angedeutet, daß die Ironie sich nunmehr nicht mehr länger wider diese oder jene einzelne Erscheinung kehrt, wider ein einzelnes Daseiendes, sondern daß das gesamte Dasein dem ironischen Subjekt fremd und dieses wiederum dem Dasein fremd geworden ist, daß das ironische Subjekt selber, indem die Wirklichkeit für es ihre Giltigkeit verloren hat, in gewissem Maße zu etwas Unwirklichem geworden ist. (GW 31, 263)
Entscheidend im Hinblick auf die Positionen der Dekadenz und der Lebensphilosophie, die von den Figuren Arthur Schnitzlers in den hier zu besprechenden Werken eingenommen werden, ist die Unterscheidung verschiedener Lebensstadien in Entweder – Oder. Den Ausgangspunkt der Betrachtung bildet die sogenannte „Ästhetische Existenz“. Ihre Charakteristika lassen sich im Rollenverhalten des Décadent zum Teil wiederfinden. So gibt sich der Ästhetiker der Unmittelbarkeit des Genusses hin:
Don Juan ist nun, wenn ich so sagen darf, die Inkarnation (Einfleischung) des Fleisches oder die Begeistung des Fleisches aus des Fleisches eignem Geist. (GW 1, 94)
Diesen Genuß kann der Ästhetiker als Stimmungsmensch nur im Augenblick und in einem rein sinnlich geprägten Liebesbegriff finden. Kierkegaard verdeutlicht das am Beispiel von Mozarts Don Juan. Dieser verkörpert den Typus des Verführers, der im Unterschied zum seelisch geprägten Liebesbegriff der Griechen reine Sinnlichkeit lebt:
Seine Liebe ist nicht seelisch, sondern sinnlich, und sinnliche Liebe ist nach seinen Begriffen nicht treu sondern schlechthin treulos, sie liebt nicht eine sondern alle, will heißen, sie verführt alle. Sie ist nämlich allein im Augenblick da, aber der Augenblick ist, begrifflich gedacht eine Summe von Augenblicken, und damit haben wir den Verführer. (GW 1, 100)
Der Verführer lebt somit einen absoluten Subjektivismus, er hat kein echtes Verhältnis zu seinem sozialen Umfeld und zur Geschichtlichkeit seiner eigenen Existenz, seine Maxime lautet: „Genieße, schwätze nicht!“ (GW 1, ebd.)
Nach Kierkegaard gibt es jedoch einen Punkt, an dem der Ästhetiker sich der Unzulänglichkeit seines Daseins bewußt werden kann, diesen Punkt bezeichnet er als „Verzweiflung“. Mit dem Erreichen des Zustandes der Verzweiflung tritt der Mensch von der „ästhetischen“ in die „ethische Existenz“ über, die Verzweiflung zwingt ihn geradezu dazu[82], sie ist im Werk Kierkegaards eine der basalen Grenzerfahrungen des menschlichen Lebens, die zum besseren Leben führen. Der Ethiker erkennt seine Eingebundenheit in die Allgemeinheit und kann auf dieser Grundlage seine individuelle Existenz besser verwirklichen. Im Sinne einer Philosophie des Lebens hat der Ethiker somit einen deutlich engeren Kontakt zum wahren Leben als der Ästhetiker, der den Zusammenhang des Lebens nie erfahren wird, wie der Ethiker „B“ dem Ästhetiker „A“ im zweiten Teil von Entweder – Oder vorhält: „Dein Leben [das des Ästhetikers] wird aufgehen in lauter Anläufen zum Leben.“ (GW 2/3, 7)
Auch wenn es Kierkegaard vorwiegend darum geht, dem Leser zu zeigen, daß dieser eine eindeutige Wahl zwischen ästhetischer und ethischer Existenz zu treffen hat, läßt sich nicht verkennen, daß die ethische Existenz als höherwertig angesehen wird:
Despite Kierkegaard’s explicit claim that there is ‚no didacticism‘ in Either/Or, it is arguable that he does not really confine himself to presenting two rival viewpoints, leaving the question of which is finally to be preferred entirely to the reader. For one thing, the ethicist is given the second, and therefore the last, word. For another, we are given the impression that B has, in some fundamental sense, seen through A’s attitude; he grasps its motivation and is thereby enabled to criticize it in a way that undermines it.[83]
Kierkegaards Ziel ist es also, eine indifferente Haltung gegenüber dem Leben zu vermeiden. Nur wer eine solche von ihm anheimgestellte Wahl trifft, ist gezwungen, sich intensiv mit seiner Lebensführung auseinanderzusetzen und zu einer Entscheidung zu kommen. Nach Kierkegaard kann es im Leben eben kein „sowohl als auch“ sondern immer nur ein „entweder – oder“ geben. Die Höherwertigkeit des Ethischen zeigt sich dabei auch darin, daß Kierkegaard es mit der Wahl schlechthin identifiziert:
Mein Entweder/Oder bezeichnet zuallernächst nicht die Wahl zwischen Gut und Böse, es bezeichnet die Wahl, mit der man Gut und Böse wählt oder Gut und Böse abtut. Die Frage geht hier darum, unter welchen Bestimmungen man das ganze Dasein betrachten und selber leben will. Daß man das Gute wählt, wenn man Gut und Böse wählt, ist freilich wahr, jedoch es zeigt sich erst hinterdrein; denn das Aesthetische ist nicht das Böse, sondern die Indifferenz, und deshalb habe ich ja gesagt, daß das Ethische die Wahl gründet. [...] Wer das Ethische wählt, wählt das Gute [...] Hier siehst Du abermals, wie wichtig es ist, daß da gewählt werde, und daß es nicht so sehr auf die Überlegung ankommt als vielmehr auf die Taufe des Willens, welche diesen in das Ethische aufnimmt. (GW 2/3, 180 )
Der Mensch ist also gezwungen, die Wahl zwischen zwei Lebensformen zu treffen, will er nicht in einem Graubereich verbleiben, in dem das Leben nur zu ahnen ist. Es wird sich in dieser Arbeit zeigen, daß Schnitzlers Figuren nicht selten an dieser Indifferenz leiden, welche Kennzeichen des Ästhetischen ist.
Eine weitere Schrift Kierkegaards, die Relevanz im Hinblick auf lebensphilosophische Bestimmungen besitzt, ist Die Wiederholung. Ein Versuch in der experimentierenden Psychologie von 1843. Kierkegaard versucht hier, den Begriff der Wiederholung in seinem Wert für das Leben zu bestimmen. Die Wiederholung zielt zunächst auf eine Absage an den ästhetischen Menschen, der seine Bestimmung immer nur im Augenblick findet. Gleichzeitig darf Wiederholung aber auch nicht als Monotonie verstanden werden:
Mit der Frage, ob Erfahrungen, Erlebnisse, Situationen, Handlungen, Beziehungen und Ereignisse ihrem Inhalt nach wiederholt werden können, entscheidet sich, ob ihnen eine Form von Dauer, damit von Wesentlichkeit verliehen werden kann, die nicht der Flüchtigkeit zufälliger Einmaligkeit unterliegt, die bestenfalls erinnert, nicht wiederholt werden könnte, aber auch nicht die mechanische Form einer nur äußeren Gleichheit routinierbarer Verhaltensweisen, also die Form von Gewohnheiten annimmt.[84]
Die Wiederholung im Sinne Kierkegaards muß dazu geeignet sein, den Fluß des Lebens an verschiedenen Stellen zu markieren und somit im ständigen Wechselspiel des Lebens ein Moment von Dauer hineinzubringen:
Die Wiederholung ist die neue Kategorie, welche entdeckt werden muß. Wenn man etwas weiß von der neueren Philosophie und der griechischen nicht ganz und gar unkundig ist, so wird man leicht sehen, daß eben diese Kategorie das Verhältnis zwischen den Eleaten und Heraklit erklärt, und daß die Wiederholung eigentlich das ist, was man irrtümlich die Vermittlung genannt hat. [...] Wenn man die Kategorie der Erinnerung oder der Wiederholung nicht besitzt, so löst das ganze Leben sich auf in leeren und inhaltlosen Lärm. (GW 5/6, 21f..)
Diese Erkenntnis, daß wahres Leben sich aus der Ergänzung von „Dauer und Wechsel“ konstituiert, liegt schon Goethes gleichnamigem Gedicht zu Grunde (vgl.: HA 1, 247f.) und auch Hofmannsthal formuliert dies prägnant in einem Brief an Richard Strauss über seine Oper Ariadne auf Naxos:
Verwandlung ist Leben des Lebens, ist das eigentliche Mysterium der schöpfenden Natur; Beharren ist Erstarren und Tod. Wer leben will, der muß über sich selber hinwegkommen, muß sich verwandeln: er muß vergessen. Und dennoch ist ans Beharren, ans Nichtvergessen, an die Treue alle menschliche Würde geknüpft. Dies ist einer von den abgrundtiefen Widersprüchen, über denen das Dasein aufgebaut ist, wie der delphische Tempel über seinem bodenlosen Erdspalt.[85]
Die Wiederholung hat somit etwas mit der Würde des menschlichen Lebens zu tun. Der Idealzustand besteht darin, den Ausgleich zwischen der Intensität einzelner erlebter Momente und den dauerhaften Werten sozialen Zusammenlebens zu finden.
2.2.4 Friedrich Nietzsche
Als weiterhin bedeutender Wegbereiter der Lebensphilosophie gilt Friedrich Nietzsche, der – stark von Schopenhauer beeinflußt, wie vor allem die dritte der Unzeitgemäßen Betrachtungen (Schopenhauer als Erzieher) zeigt – zu eigenen Theorien gelangt und das Leben als „jene dunkle, treibende, unersättlich sich selbst begehrende Macht“ (UB, 124) interpretiert.
Insbesondere die zweite Unzeitgemäße Betrachtung (Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben) formuliert zunächst generelle lebensphilosophische Einsichten Nietzsches. In seiner Unterscheidung von „monumentalischer“, „antiquarischer“ sowie „kritischer“ (UB, 112) Geschichtsbetrachtung nennt er die Bedingungen, damit Geschichte dem Menschen, also dem Leben nutzbar gemacht werden kann. Dieser Nutzen besteht nach Nietzsche in einer ästhetisierenden Geschichtsschreibung, da nur diese die grausame Faktizität historischer Ereignisse für den Menschen sinnvoll machen könne, indem der übergeordnete Zusammenhang der Fakten gestaltet wird:
In dieser Weise die Geschichte objektiv zu denken, ist die stille Arbeit des Dramatikers; nämlich alles aneinander denken, das Vereinzelte zum Ganzen weben: überall mit der Voraussetzung, daß eine Einheit des Planes in die Dinge gelegt werden müsse, wenn sie nicht darinnen sei. So überspinnt der Mensch die Vergangenheit und bändigt sie, so äußert sich sein Kunsttrieb – nicht aber sein Wahrheits-, sein Gerechtigkeitstrieb. Objektivität und Gerechtigkeit haben nichts miteinander zu tun. (UB, 147)
Ganz deutlich sieht man an dieser Stelle auch die Verquickung von Kunst und Philosophie, indem der Philosoph Nietzsche die Ästhetisierung der Geschichte durch den Dichter fordert. Das beinhaltet natürlich die Forderung nach einem Dienst der Dichtung am Leben, eine Forderung, der sich jeder Dichter nicht nur zur Zeit Nietzsches zu stellen hatte.
Die eigentliche lebensphilosophische Phase Nietzsches, die sich vor allem mit Also sprach Zarathustra manifestiert, wird durch erkenntnistheoretische Einsichten vorbereitet. In dieser Phase der Beschäftigung mit positivistischen Methoden, in der auch die Weiterentwicklung des künstlerischen Menschen im wissenschaftlichen propagiert wird, gewinnt er die Überzeugung vom Primat des Handelns gegenüber dem Erkennen. Durch den ihm innewohnenden Willen erscheinen dem Menschen die Gegenstände der äußeren Welt schon so wie sie sind. Die entscheidende Ebene wird dadurch die des Handelns. Hierin liegt die Abkehr Nietzsches vom Idealismus, wie er sie im fünften Buch der Fröhlichen Wissenschaft formuliert hat:
Ehemals hatten die Philosophen Furcht vor den Sinnen [...] Wir sind heute allesamt Sensualisten, wir Gegenwärtigen und Zukünftigen in der Philosophie, nicht der Theorie nach, aber in der Praxis, der Praktik. [...] ‚Wachs in den Ohren‘ war damals beinahe Bedingung des Philosophierens; ein echter Philosoph hörte das Leben [sic!] nicht mehr, insofern Leben Musik ist, er leugnete die Musik des Lebens, - es ist ein alter Philosophenaberglaube, daß alle Musik Sirenenmusik ist. [...] In summa: aller philosophische Idealismus war bisher etwas wie eine Krankheit. (FW, 288f.)
Nietzsche gelangt damit zu einem pragmatischen Primat des Handelns, der schließlich auf den Willen zur Macht hinauslaufen wird. In diesem Punkt liegt gleichzeitig die entscheidende Abkehr von Schopenhauer, dessen auf der Verneinung des Willens zum Leben basierende Mitleidstheorie Nietzsche ablehnte. Hier geht es um die entschiedene Bejahung dieses Willens durch den „Übermenschen“, der den letzten Schritt in der Entwicklung des Menschen darstellt und somit Leben in höchstem Sinn repräsentiert:
Und das ist der große Mittag, da der Mensch auf der Mitte seiner Bahn steht zwischen Tier und Übermensch und seinen Weg zum Abende als seine höchste Hoffnung feiert: denn es ist der Weg zu einem neuen Morgen. Alsda wird sich der Untergehende selber segnen, daß er ein Hinübergehender sei; und die Sonne seiner Erkenntnis wird ihm im Mittage stehn. „Tot sind alle Götter: nun wollen wir, daß der Übermensch lebe“ – dies sei einst am großen Mittage unser letzter Wille! (Z, 84)
[...]
[1] Fritsche, Alfred: Dekadenz im Werk Arthur Schnitzlers. Frankfurt/M.: Lang 1974. S. 9.
[2] Bahr, Hermann: Das junge Österreich. In: Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910. Hg. v. Gotthart Wunberg unter Mitarbeit von Johannes J. Braakenburg. Stuttgart: Reclam 1981. S. 297f.. Im folgenden zitiert als „Wunberg/Braakenburg“.
[3] Titzmann, Michael: Skizze einer integrativen Literaturgeschichte und ihres Ortes in einer Systematik der Literaturwissenschaft. In: Modelle des literarischen Strukturwandels. Hg. v. Michael Titzmann. Tübingen: Niemeyer 1991. S. 395-438. hier: S. 401.
[4] Fohrmann, Jürgen und Harro Müller: Einleitung. Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. In: Dis-kurstheorien und Literaturwissenschaft. Hg. v. Jürgen Fohrmann und Harro Müller. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1988. S. 16.
[5] Diese Auseinandersetzung ist durchaus nicht beendet. Erst jüngst stellte der "SPIEGEL" fest: "So sind gerade in der hoch individualisierten deutschen Wissensgesellschaft plötzlich die einfachsten, ersten Fragen wieder gefragt: Wozu sind wir überhaupt hier? Brauchen wir Tugenden, und welche? Gibt es das Glück? Hat das Leben einen Sinn?" (Saltzwedel, Johannes: Wiederkehr der Kinderfragen. In: DER SPIEGEL 8/2000.)
[6] vgl.: Albert, Karl: Lebensphilosophie. Von den Anfängen bei Nietzsche bis zu ihrer Kritik bei Lukács. Freiburg: Alber 1995.
[7] Titzmann: a.a.O. S. 402.
[8] vgl. Titzmann: a.a.O. S. 402f.. Kulturelles Wissen ist nach Titzmann „die Menge aller Propositionen, die die Mitglieder eines kulturellen Systems für wahr halten.“ Gruppenspezifisch ist es in diesem Falle, weil es sich auf „Wissenselemente, die nur die Mitglieder einer oder mehrerer Gruppen teilen“ bezieht und andere Elemente ausgrenzt.
[9] Titzmann: a.a.O. S. 404.
[10] Reichert, Herbert W.: Nietzsche and Schnitzler. In: Studies in Arthur Schnitzler. Ed. b. Herbert W. Reichert and Herman Salinger. New York: AMS Press 1966. S. 95-108. hier: S. 96.
[11] Hierin manifestiert sich u.a. einer der wesentlichen Unterschiede Schnitzlers zu berühmten Kollegen wie Hugo von Hofmannsthal oder Thomas Mann, die immer wieder versuchten, das Verständnis ihrer literarischen Werke durch Erläuterungen zu lenken.
[12] Farese, Giuseppe: Arthur Schnitzler. Ein Leben in Wien. 1862-1931. München: C.H.Beck 1999.
[13] Zur Interpretation des Begriffs „Décadence/Dekadenz“ und seiner positiven Deutung im Sinne einer „Ästhetik des Häßlichen“ vgl. Kapitel 2.1.
[14] Fritsche: a.a.O. S. 9.
[15] Blume, Bernhard: Das nihilistische Weltbild Arthur Schnitzlers. Stuttgart: Knöller 1936. S. 12.
[16] Blume: a.a.O. S. 18.
[17] Blume: a.a.O. S. 20.
[18] Kaufmann, Wilhelm Friedrich: Zur Frage der Wertung in Schnitzlers Werk. In: PMLA 48/1933. S. 209-219. hier: S. 211.
[19] Müller-Freienfels, Richard: Das Lebensgefühl in Arthur Schnitzlers Dramen. Diss. Masch. Frankfurt/M. 1954.
[20] Müller-Freienfels: a.a.O. S. 6.
[21] Werner, Ralph Michael: Impressionismus als literarhistorischer Begriff. Untersuchung am Beispiel Arthur Schnitzlers. Frankfurt/M.: Lang 1981. S. 159.
[22] Werner: a.a.O. S. 173.
[23] Offermanns, Ernst L.: Geschichte und Drama bei Arthur Schnitzler. In: Arthur Schnitzler in neuer Sicht. Hg. v. Hartmut Scheible. München: Fink 1981. S. 34-53. hier: S. 42.
[24] Lukas, Wolfgang: Das Selbst und das Fremde. Epochale Lebenskrisen und ihre Lösung im Werk Arthur Schnitzlers. München: Fink 1996.
[25] Lukas: a.a.O.. S. 21.
[26] Lukas: a.a.O.. S. 21.
[27] Lukas: a.a.O.. S. 22.
[28] Lukas: a.a.O.. S. 22.
[29] Lukas: a.a.O.. S. 22.
[30] Lukas: a.a.O.. S. 24.
[31] Musil, Robert: Der Mann ohne Eigenschaften. Roman. Erstes und zweites Buch. Hg. v. Adolf Frisé. Neu durchgesehene und verbesserte Ausgabe 1978. Reinbek: Rowohlt 1999. S. 55.
[32] Schlinkmann, Adalbert: „Einheit“ und „Entwicklung“. Die Bildwelt des literarischen Jugendstils und die Kunsttheorien der Jahrhundertwende. Masch. Dis.. Bamberg 1974.
[33] Koppen, Erwin: Dekadenter Wagnerismus. Studien zur europäischen Literatur des Fin de siècle. Berlin u.a.: de Gruyter 1973. S. 2.
[34] Sallust: Werke und Schriften. Lateinisch-Deutsch. Hg. v. Wilhelm Schöne. 4. unveränderte Auflage. Stuttgart: Heimeran 1969. S. 21f..
[35] Baudelaire, Charles: Notes nouvelles sur Edgar Poe. In: Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Poe. Hg. v. Jacques Crépet. Paris: Connard 1933.
[36] Koppen: a.a.O. S. 29.
[37] Baudelaire, Charles: Œuvres complètes. zit. n.: Rasch, Wolfdietrich: Die literarische Décadence um 1900. München: C.H.Beck 1986. S. 25. Im folgenden als „Décadence“ zitiert.
[38] Koppen: a.a.O.. S. 46.
[39] vgl.: Hofmannsthals Brief an Richard Beer-Hofmann vom 15.5.1895. In: Hugo von Hofmannsthal/Richard Beer-Hofmann: Briefwechsel. Hg. v. Eugene Weber. Frankfurt/M.: S. Fischer 1972. S. 47.
[40] Bourget, Paul: Essais de psychologie contemporaine. Études littéraires. Édition établie et préfacée par André Guyaux. Paris: Gallimard 1993. S. 14.
[41] Hofmannsthal, Hugo von: Maurice Barrès. In: ders.: Reden und Aufsätze I. 1891-1913. (Gesammelte Werke 8). Frankfurt/M.: Fischer 1979. S. 118-126. hier: S. 119f..
[42] So ist Bahr beispielsweise der Einzige von Schnitzlers näheren Bekannten, mit dem er sich duzte; eine Tatsache allerdings, die er später selbst häufig als störend empfand.
[43] Diese Tatsache läßt sich auch an Bahrs eigenen literarischen Versuchen nachweisen, die zwar heute literarisch als bedeutungslos eingestuft werden, in ihrer Gestaltung aber eine ganz klare Verbindung zum europäischen Naturalismus eines Ibsen oder Zola aufweisen. Vgl. etwa Bahrs Drama Die neuen Menschen von 1887, bei dem schon der Titel programmatisch im naturalistischen Sinn ist.
[44] Wunberg, Gotthard: Deutscher Naturalismus und Österreichische Moderne. zit. n.: Lorenz, Dagmar: Wiener Moderne. Stuttgart: Metzler 1995. S. 41f..
[45] Bahr, Hermann: Brief an seinen Vater vom 14. März 1887. zit. n.: Jugend in Wien. Literatur um 1900. Ausstellungskatalog des Schiller-Nationalmuseums. Kösel: München 1974. S. 77.
[46] Bahr, Hermann: Die Décadence. In: Wunberg/Braakenburg. S. 231.
[47] Bahr, Hermann: Die Überwindung des Naturalismus. In: Wunberg/Braakenburg. S. 202.
[48] Hofmannsthal, Hugo von: Gestern. In: ders.: Gedichte. Dramen I. Frankfurt/M.: Fischer 1979. S. 218.
[49] Rieckmann, Jens: Aufbruch in die Moderne. Die Anfänge des jungen Wien. Österreichische Literatur und Kritik im Fin de siècle. 2. durchgesehene Auflage. Frankfurt/M.: Athenäum 1986. S. 112.
[50] vgl.: Koppen: a.a.O. S. 63ff.. Zu nennen sind hier vor allem: Musikalität, Evokationstechnik, Nuance und Hermetismus.
[51] Koppen: a.a.O. S. 46.
[52] Koppen: a.a.O. S. 66.
[53] Baudelaire, Charles: Brief an Ferdinand Desnoyer 1855. In: Sämtliche Werke. Bd. 3. München 1975. S. 405.
[54] vgl.: Rasch: Décadence. S. 51f..
[55] vgl.: Weininger, Otto: Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung. Achtzehnte, unveränderte Auflage. Wien: Braumüller 1919.
Hierin vor allem das Kapitel „Mutterschaft und Prostitution“, S. 273-306.
[56] Weininger: a.a.O. S. 287.
[57] Zola, Emile: Mes haines. Causeries littéraires et artistiques. Genf: Slatkine Reprints 1979. S. 67f..
[58] Wedekind, Frank: Lulu. Erdgeist. Die Büchse der Pandora. Stuttgart: Reclam 1989. S. 9.
[59] Weininger: a.a.O. S. 390.
[60] Weininger: a.a.O. S. 394.
[61] Rasch: Décadence. S. 83.
[62] vgl.: Rasch: Décadence. S. 110ff..
[63] Rasch: Décadence. S. 110.
[64] Rasch, Wolfdietrich: Aspekte der deutschen Literatur um 1900. In: ders.: Zur deutschen Literatur seit der Jahrhundertwende. Gesammelte Aufsätze. Stuttgart: Metzler 1967. S. 1-48. hier: S. 17.
[65] Bollnow, Otto Friedrich: Die Lebensphilosophie. Berlin u.a.: Springer 1958. S. 1.
[66] Rickert, Heinrich: Die Philosophie des Lebens. Darstellung und Kritik der philosophischen Modeströmungen unserer Zeit. Tübingen 1920. S. 61.
[67] Wagner, Otto: Die Baukunst dieser Zeit. Dem Baukunstjünger ein Führer auf diesem Gebiet. Wien 4. Auflage 1914. zit. n.: Schorske, Carl E.: Die Ringstraße, ihre Kritiker und die Idee der modernen Stadt. In: ders.: Wien. Geist und Gesellschaft im Fin de Siècle. 2. Auflage. München: Piper 1997. S. 70.
[68] Körner, Josef: Arthur Schnitzlers Gestalten und Probleme. Wien: Amalthea 1921. S. 20.
[69] Boetticher, Dirk von: „Meine Werke sind lauter Diagnosen“. Über die ärztliche Dimension im Werk Arthur Schnitzlers. Heidelberg. Diss. Masch. 1996. S. 5.
[70] Scheible, Hartmut: Arthur Schnitzler mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. 10. Auflage. Reinbek: Rowohlt1996. S. 19.
[71] Geißler, Rolf: Experiment und Erkenntnis. Überlegungen zum geistesgeschichtlichen Ort des Schnitzlerschen Erzählens. In: MAL 19/1(1986). S. 49-62. hier: S. 55.
[72] vgl. dazu Herders Gedicht „Strom des Lebens“, welches in pantheistischer Wendung Heraklits „pantha rei“ zitiert:
Fließe, des Lebens Strom! Du gehst in Wellen vorüber,
Wo mit wechselnder Höh‘ eine die andre begräbt.
Mühe folget der Mühe; doch, kenn‘ ich süßere Freuden,
Als besiegte Gefahr, oder vollendete Müh‘?
Leben ist Lebens Lohn; Gefühl sein ewiger Kampfpreis.
Fließe, wogiger Strom! nirgend ein stehender Sumpf.
Herder, Johann Gottfried von: Gedichte. Zweiter Theil. Hg. v. Johann Georg Müller. In: ders.: Sämmtliche Werke. Zur schönen Literatur und Kunst. Vierter Theil. Stuttgart: Cotta 1827. S. 27.
[73] Herder, Johann Gottfried: Briefe zur Beförderung der Humanität. Frankfurt/M.: Deutscher Klassiker Verlag 1991.
[74] vgl.: Schlegel, Friedrich: Philosophie des Lebens. In fünfzehn Vorlesungen gehalten zu Wien im Jahre 1827. In: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Zehnter Band. Erste Abteilung. Kritische Neuausgabe. Hg. v. Ernst Behler u.a.. München u.a.: Schöningh 1969. S. 1-288.
[75] Schlegel: a.a.O.. S. 4.
[76] Schlegel: a.a.O.. S. 4.
[77] Schlegel: a.a.O.. S. 167.
[78] Schlegel: a.a.O.. S. 168.
[79] Schneider, Reinhold: Arthur Schopenhauer. In: Schopenhauer. Auswahl und Einleitung von Reinhold Schneider. Frankfurt/M. : Fischer 1956. S. 17.
[80] Diemer, Alwin: Schopenhauer und die moderne Existenzphilosophie. In: Schopenhauer-Jahrbuch 43(1962). S. 27-41. hier: S. 36f.
[81] Richert, Hans: Schopenhauer. Seine Persönlichkeit, seine Lehre, seine Bedeutung. Vierte Auflage. Leipzig: Teubner 1920. S. 6.
[82] vgl.: Lowrie, Walter: Das Leben Sören Kierkegaards. Düsseldorf: Diederichs 1955. S. 135.
[83] Gardiner, Patrick: Kierkegaard. New York: Oxford University Press 1988. S. 43.
[84] Liessmann, Konrad Paul: Kierkegaard zur Einführung. Hamburg: Junius 1993. S. 70.
[85] Hofmannsthal, Hugo von: Ariadne (1912). Aus einem Brief an Richard Strauss. In: ders.: Dramen V. Operndichtungen. Frankfurt/M.: Fischer 1979. S. 297.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Leben“ im Werk von Arthur Schnitzler?
„Leben“ wird bei Schnitzler als eines der drei „Absoluten Güter“ (neben Gesundheit und Liebe) definiert und im Kontext der zeitgenössischen Lebensphilosophie interpretiert.
Wie beeinflusste die Philosophie von Nietzsche und Schopenhauer Schnitzler?
Ihre Ansätze zur Lebensphilosophie und Dekadenz flossen als „kulturelles Wissen“ in Schnitzlers Texte ein, auch wenn er sich nie explizit zu einem philosophischen System bekannte.
Was versteht man unter dem Begriff „Dekadenz“ in der Wiener Moderne?
Dekadenz beschreibt ein Lebensgefühl des Verfalls und der Überverfeinerung, das Schnitzler oft durch seine Figuren (z. B. den „österreichischen Lebemann“) kritisch darstellt.
Welche Rolle spielen Eros und Thanatos bei Schnitzler?
Die Themen Liebe (Eros) und Tod (Thanatos) sind zentrale Motive, die Schnitzler nutzt, um die Tiefe menschlicher Gefühle und gesellschaftliche Diskurse zu analysieren.
Warum sind Schnitzlers Aphorismen für die Forschung wichtig?
Die Aphorismen bieten Einblicke in seine ethische Dimension und persönliche Weltanschauung, die in seinen literarischen Werken oft eher indirekt vermittelt wird.
- Quote paper
- Carsten Tergast (Author), 2000, „Leben, Gesundheit und Liebe“ als zentrale Kategorien des Schreibens bei Arthur Schnitzler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200790