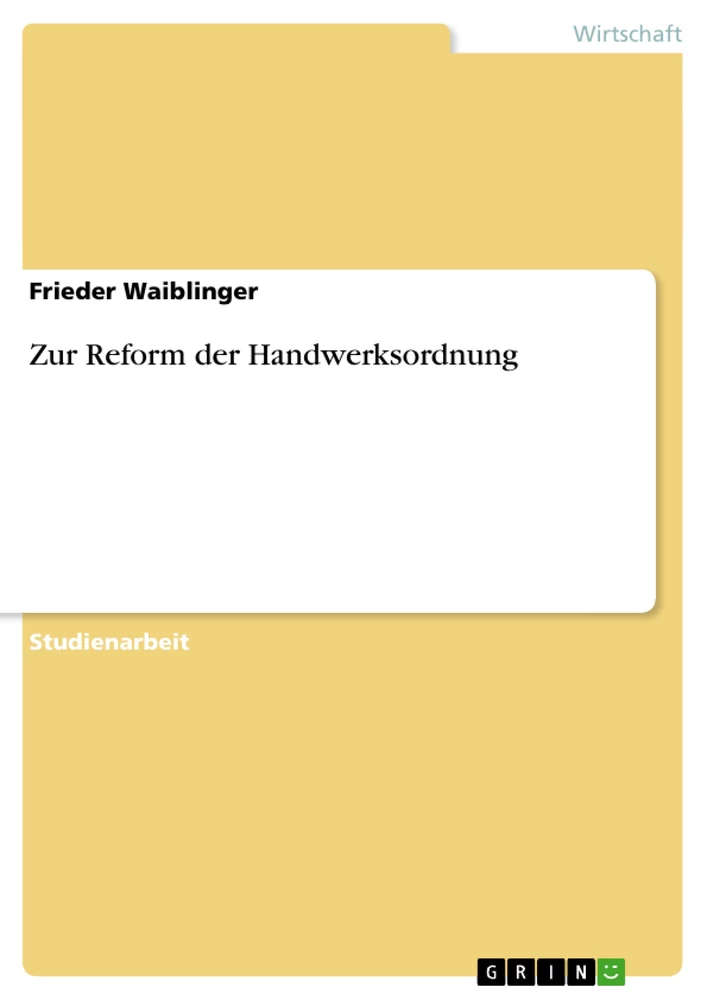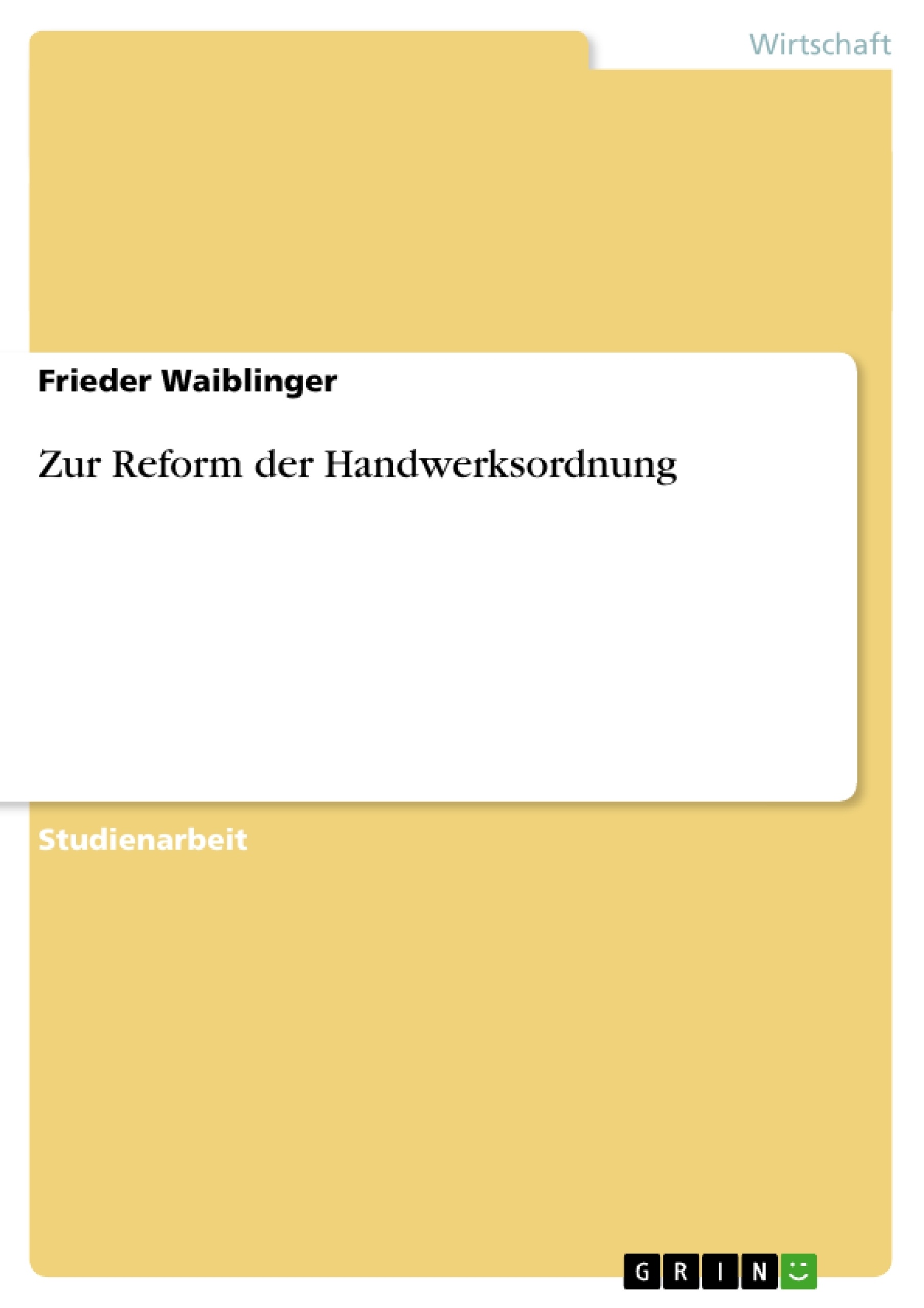Der Befähigungsnachweis im Handwerk entstand zu einem Zeitpunkt, als das Handwerksgewerbe über den Bedarf eines Dorfes hinaus produzierte und Fremden bspw. in Form eines Meisterstücks als Garantie für Qualitätsarbeit diente. Im Jahre 1908 wurde dann die Meisterprüfung Voraussetzung, um Lehrlinge ausbilden zu dürfen (Kleiner Befähigungsnachweis), ab 1935 auch um einen Handwerksbetrieb zu führen (Großer Befähigungsnachweis). Charakteristisch in der Handwerksgesetzgebung ist die Inkont inuität zwischen Gewerbefreiheit und Beschränkung des Marktzugangs 1, die sich mit der angestrebten Reform der rot-grünen Koalition weiter fortsetzt.2 Zentrale Änderungen am „Gesetz zur Ordnung des Handwerks“ („Handwerksordnung“), das 1953 unter Ludwig Erhard eingeführt und später mehrfach novelliert wurde, sind, daß zukünftig nur noch für 29 statt zuvor 94 Handwerksgewerbe der Große Befähigungsnachweis („Meistertitel“) für das selbständige Führen eines Handwerksgewerbes benötigt wird und die Regulierung auf die wesentlichen Tätigkeiten des Handwerks beschränkt werden soll. Begründet wird die Reformierung der HwO u.a. durch sinkende Unterschiede zwischen Handwerk und Industrie, die insbesondere auf die technische Entwicklung zurückzuführen sind3 und durch die Regulierungsdichte, die, wie Helmut Schmidt, Bundeskanzler a.D., ausführt, „nur einer der Gründe für unsere hohe Arbeitslosigkeit [ist], aber ... ein wichtiger Grund.“4 Der ZDH führt jedoch Argumente gegen eine Reform an, weil u.a. der Wegfall von mehr als 60.000 Lehrstellen befürchtet wird.5 Ein qualifiziertes Urteil über die Reform kann erst nach einer eingehenden Analyse6 gefällt werden, die sich an zwei Leitfragen orientiert:7 liegt aus normativer Sicht ein Marktversagenstatbestand vor und ggf. in welchem Verhältnis stehen einem möglichen Nutzen der Regulierung Wohlfahrtseinbußen gegenüber?8 Wie sehen eine mögliche Deregulierung und die dadurch bewirkten Folgen aus?
Zu Beginn der Arbeit wird der Handwerksbegriff definiert und der Anwendungsbereich der HwO in der gültigen Fassung aufgezeigt. Im Anschluß wird versucht, den Untersuchungsgegenstand einzugrenzen. Anhand der Argumente der Befürworter der Regulierung werden angebotsseitige, nachfrageseitige und marktseitige Branchenbesonderheiten untersucht und den Kosten der Regulierung gegenüber gestellt.9 Ein Zwischenfazit soll die Ergebnisse der Analyse aufgreifen und eine Beantwortung der ersten Frage zulassen, ob eine Regulierung notwendig ist...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Problemstellung
- Definition des Handwerksbegriffs und Anwendungsbereich der HwO
- Erfordernis einer De-/ Regulierung im Handwerk?
- Einschränkung des Untersuchungsgegenstandes
- Branchenbesonderheiten als Begründung der Regulierung
- Angebotsseitige Branchenbesonderheiten
- Nachfrageseitige Branchenbesonderheiten
- Marktseitige Branchenbesonderheiten
- Kosten der Regulierung
- Volkswirtschaftliche Kosten
- Betriebswirtschaftliche Kosten
- Zwischenfazit
- Auswirkungen einer Deregulierung
- Auswirkungen auf das Angebot
- Auswirkungen auf die Nachfrage
- Auswirkungen auf die Ausbildungsleistung
- Die Reform der HwO
- Zentrale Reformpunkte
- Die Folgen der Reform
- Auswirkungen auf Angebot und Preise
- Auswirkungen auf die Ausbildungsleistung
- Bewertung der Reformbemühungen der Bundesregierung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Reform der Handwerksordnung im Kontext der Deregulierungsdebatte. Ziel ist es, die Notwendigkeit und Auswirkungen einer De-/Regulierung im Handwerk anhand der spezifischen Branchenbesonderheiten zu analysieren. Dabei werden die Auswirkungen der Reform auf Angebot, Nachfrage und Ausbildungsleistung beleuchtet.
- Definition des Handwerksbegriffs und Anwendungsbereich der Handwerksordnung
- Branchenbesonderheiten im Handwerk als Argument für Regulierung
- Kosten der Regulierung und Deregulierung im Handwerk
- Auswirkungen der Reform der Handwerksordnung auf Angebot, Nachfrage und Ausbildung
- Bewertung der Reformbemühungen der Bundesregierung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert den Handwerksbegriff und den Anwendungsbereich der Handwerksordnung. Kapitel 2 untersucht die Notwendigkeit einer De-/Regulierung im Handwerk, indem es die spezifischen Branchenbesonderheiten analysiert und die Kosten der Regulierung beleuchtet. Im dritten Kapitel werden die Auswirkungen einer Deregulierung auf Angebot, Nachfrage und Ausbildungsleistung im Handwerk untersucht. Schließlich werden im vierten Kapitel die zentralen Reformpunkte der Handwerksordnung und deren Folgen für Angebot, Preise und Ausbildungsleistung betrachtet.
Schlüsselwörter
Handwerksordnung, Deregulierung, Regulierung, Branchenbesonderheiten, Angebot, Nachfrage, Ausbildungsleistung, Reform, Kosten der Regulierung, Meisterpflicht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der Reform der Handwerksordnung?
Die zentrale Änderung ist, dass die Meisterpflicht (Großer Befähigungsnachweis) von 94 auf 29 Handwerksberufe reduziert wurde, um den Marktzugang zu erleichtern.
Was ist der „Große Befähigungsnachweis“?
Dies ist die gesetzliche Voraussetzung des Meistertitels, um einen Handwerksbetrieb selbstständig führen zu dürfen.
Warum wurde die Handwerksordnung dereguliert?
Begründet wurde dies durch die technische Angleichung von Handwerk und Industrie sowie durch das Ziel, Arbeitslosigkeit durch den Abbau von Markteintrittsbarrieren zu senken.
Welche Befürchtungen äußern Handwerksverbände wie der ZDH?
Kritiker befürchten einen massiven Rückgang der Ausbildungsleistung (Wegfall von bis zu 60.000 Lehrstellen) und einen Verlust an handwerklicher Qualität.
Welche Auswirkungen hat die Reform auf die Preise?
Durch den Wegfall der Meisterpflicht in vielen Gewerken steigt der Wettbewerb, was potenziell zu sinkenden Preisen für Verbraucher führen kann, aber auch den Druck auf etablierte Betriebe erhöht.
Liegt im Handwerk ein Marktversagen vor, das Regulierung rechtfertigt?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage aus normativer Sicht, indem sie Nutzen und Kosten der Regulierung gegenüberstellt, um die Notwendigkeit des Meisterzwangs zu bewerten.
- Arbeit zitieren
- Frieder Waiblinger (Autor:in), 2003, Zur Reform der Handwerksordnung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20081