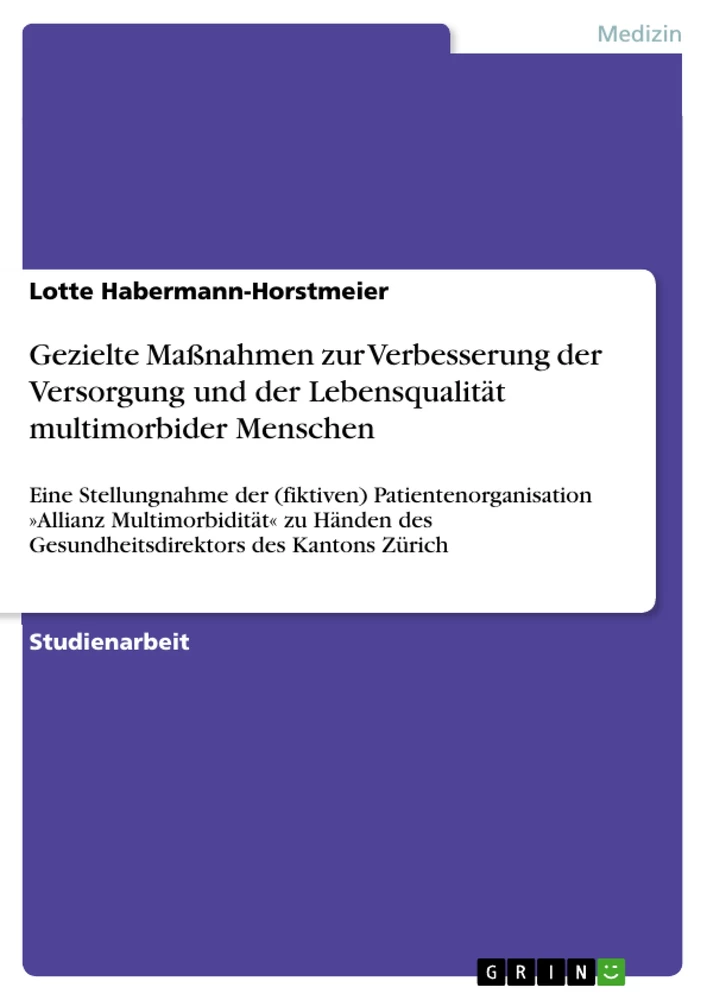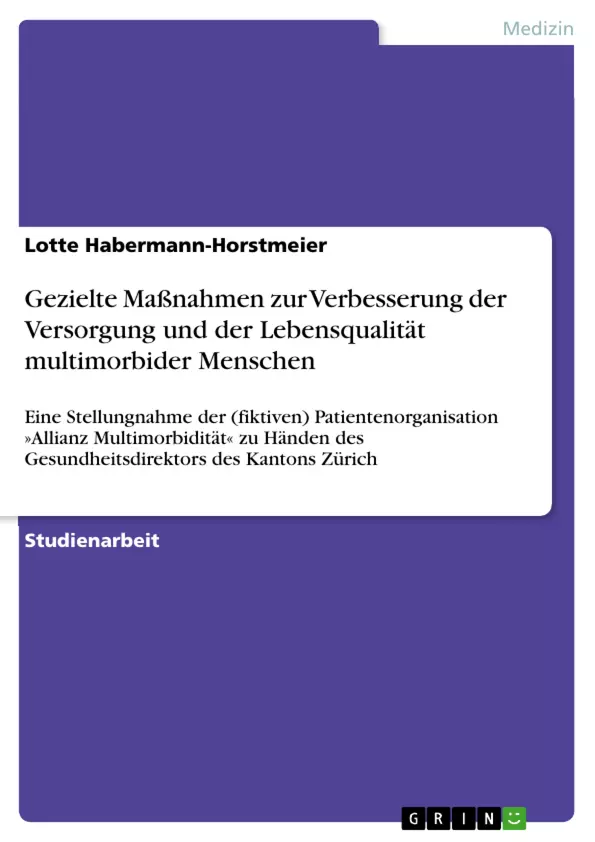In den letzten Jahrzehnten kam es in der Schweiz – wie auch in den anderen westlichen Industrienationen – zu einem deutlichen Anstieg der Zahl chronischer Krankheiten. Die meisten dieser Erkrankungen kommen mit zunehmendem Alter häufiger vor. Aufgrund der demo-grafischen Entwicklung werden solche Erkrankungen in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Aus der individuellen Sicht der PatientInnen sind es meist die nachhaltigen psychosozialen Veränderungen und Einschränkungen der individuellen Lebensführung (z.B. in Form von Selbstversorgungsdefiziten), die für sie im Vordergrund stehen. In vielen Fällen kommt es im Verlauf der Erkrankung zu einem dauer-haften Pflege- und Hilfebedarf. Die vorliegende Arbeit zeigt anhand einer Stellungnahme der fiktiven Patientenorganisation "Allianz Multimorbidität" die sich daraus ergebenden Problemen im Hinblick auf die Versorgung und Lebensqualität multimorbider Menschen auf und nennt Lösungansätze.
Inhaltsverzeichnis
- I. Ausgangslage und Problembeschreibung
- II. Fragestellungen und Lösungsansätze
- III. Abwägung der Argumente und Schlussstatement
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Stellungnahme der fiktiven Patientenorganisation „Allianz Multimorbidität“ zielt darauf ab, die Versorgung und Lebensqualität multimorbider Menschen in der Schweiz zu verbessern. Sie analysiert aktuelle Probleme im Umgang mit Multimorbidität und schlägt konkrete Lösungsansätze vor.
- Zunehmende Multimorbidität in der alternden Bevölkerung
- Probleme im Management und in der Behandlung von Multimorbidität
- Fehlende Koordination von Gesundheitsleistungen bei multimorbiden Patienten
- Bedarf an intensivierter Forschung im Bereich Multimorbidität
- Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen und Autonomie multimorbider Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Ausgangslage und Problembeschreibung: Dieses Kapitel beschreibt den Anstieg chronischer Krankheiten und Multimorbidität in der Schweiz und anderen westlichen Industrienationen. Es erläutert die Charakteristika chronischer Krankheiten nach Bandura et al. (2006), insbesondere das kontinuierliche Auftreten von Symptomen, den hohen Betreuungsbedarf und die erheblichen Veränderungen in den Lebensbereichen der Betroffenen. Der Fokus liegt auf den psychosozialen Auswirkungen und den daraus resultierenden Herausforderungen für die Betroffenen und deren Angehörige, insbesondere den langfristigen Pflege- und Hilfebedarf. Das Kapitel verdeutlicht die starke Korrelation zwischen Alter, Geschlecht, Multimorbidität und der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, und verweist auf demografische Entwicklungen, die zu einem weiteren Anstieg der Erkrankungen führen werden.
II. Fragestellungen und Lösungsansätze: Dieses Kapitel beleuchtet die aus Sicht der Patienten bestehenden Probleme bei der Versorgung multimorbider Menschen. Es kritisiert das mangelhafte Management und die unzureichende Behandlung der Multimorbidität sowie die fehlende Koordination der verschiedenen Fachpersonen. Die daraus resultierende Multimedikation und das Risiko von unerwünschten Nebenwirkungen werden hervorgehoben. Der Mangel an Forschung im Bereich Multimorbidität, insbesondere die fehlenden evidenzbasierten Leitlinien und epidemiologischen Daten, werden als weitere zentrale Herausforderungen dargestellt. Das Kapitel formuliert konkrete Forderungen der „Allianz Multimorbidität“, darunter die Einführung eines Case Managements, die Intensivierung der Pflegeforschung und die Entwicklung evidenzbasierter Leitlinien.
Schlüsselwörter
Multimorbidität, Chronische Krankheiten, Gesundheitsversorgung, Lebensqualität, Case Management, Pflegeforschung, Epidemiologie, Biomedizinische Forschung, Multimedikation, Evidenzbasierte Leitlinien, Gesundheitsressourcen, Autonomie im Alter.
Häufig gestellte Fragen zur Stellungnahme der Allianz Multimorbidität
Was ist der Hauptfokus dieser Stellungnahme?
Die Stellungnahme der fiktiven Patientenorganisation „Allianz Multimorbidität“ konzentriert sich auf die Verbesserung der Versorgung und Lebensqualität multimorbider Menschen in der Schweiz. Sie analysiert bestehende Probleme im Umgang mit Multimorbidität und schlägt konkrete Lösungsansätze vor.
Welche Probleme im Zusammenhang mit Multimorbidität werden angesprochen?
Die Stellungnahme beleuchtet verschiedene Herausforderungen: die zunehmende Multimorbidität in der alternden Bevölkerung, Probleme im Management und der Behandlung von Multimorbidität, fehlende Koordination von Gesundheitsleistungen, den Bedarf an intensivierter Forschung und die Notwendigkeit, die gesundheitlichen Ressourcen und Autonomie multimorbider Menschen zu stärken. Insbesondere werden das mangelhafte Management, unzureichende Behandlung, fehlende Koordination verschiedener Fachpersonen, Multimedikation mit dem Risiko von Nebenwirkungen und der Mangel an evidenzbasierten Leitlinien und epidemiologischen Daten kritisiert.
Welche Kapitel umfasst die Stellungnahme?
Die Stellungnahme gliedert sich in drei Kapitel: I. Ausgangslage und Problembeschreibung; II. Fragestellungen und Lösungsansätze; III. Abwägung der Argumente und Schlussstatement (letzteres ist im bereitgestellten Auszug nicht enthalten).
Was wird im Kapitel „Ausgangslage und Problembeschreibung“ behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den Anstieg chronischer Krankheiten und Multimorbidität in der Schweiz und anderen westlichen Industrienationen. Es erläutert die Charakteristika chronischer Krankheiten nach Bandura et al. (2006), die psychosozialen Auswirkungen und die Herausforderungen für Betroffene und Angehörige. Es verdeutlicht die Korrelation zwischen Alter, Geschlecht, Multimorbidität und der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und verweist auf zukünftige demografische Entwicklungen.
Was sind die zentralen Punkte im Kapitel „Fragestellungen und Lösungsansätze“?
Dieses Kapitel beleuchtet aus Patientensicht bestehende Probleme bei der Versorgung multimorbider Menschen. Es kritisiert das mangelhafte Management und die unzureichende Behandlung, die fehlende Koordination der Fachpersonen, Multimedikation und das Risiko von Nebenwirkungen sowie den Mangel an Forschung und evidenzbasierten Leitlinien. Es formuliert konkrete Forderungen der „Allianz Multimorbidität“, wie die Einführung eines Case Managements, die Intensivierung der Pflegeforschung und die Entwicklung evidenzbasierter Leitlinien.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Stellungnahme?
Schlüsselwörter sind: Multimorbidität, Chronische Krankheiten, Gesundheitsversorgung, Lebensqualität, Case Management, Pflegeforschung, Epidemiologie, Biomedizinische Forschung, Multimedikation, Evidenzbasierte Leitlinien, Gesundheitsressourcen, Autonomie im Alter.
- Quote paper
- Dr. med. Lotte Habermann-Horstmeier (Author), 2012, Gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung und der Lebensqualität multimorbider Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201003