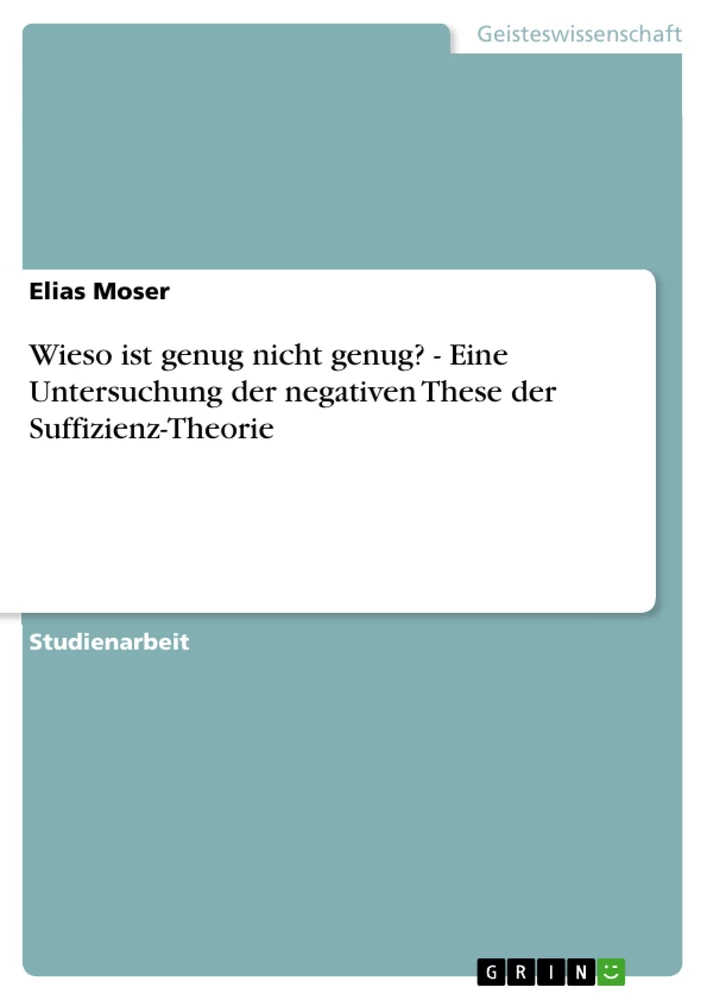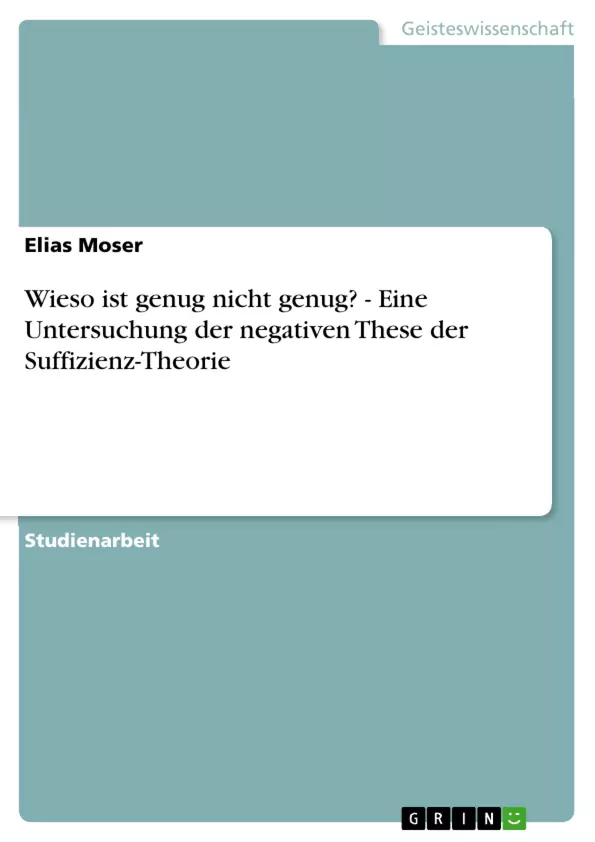Die Suffizienztheorie ist eine inhärent kritische Theorie der Verteilungsgerechtigkeit. Ihr Kern besteht in den Aussagen, dass erstens Gleichverteilung in gewissen Fällen moralisch falsch ist und zweitens das einzige Ziel einer Umverteilung darin besteht, dass möglichst alle Personen ausreichend versorgt sind. Erstere Aussage wird als "negative These" ansgesehen und besteht in einer Kritik an sämtlichen Verteilungstheorien.
In diesem Essay werden die Argumente untersucht, welche die negative These stützen sollen. Ich komme zum Schluss, dass der Anspruch der These zu hoch ist. Dennoch können die Argumente Schwachstellen einer egalitaristischen Theorie aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Suffizienz: Zwei Thesen
- Positive These
- Negative These
- 3. Überblick und Einordnung
- Egalitarismus
- Theorie der Priorität
- 4. Die Negative These
- Neid
- Komparative Vorteile der Suffizienz-Theorie
- 5. Fall-Implikationen
- Extreme Knappheit
- Ineffizienz
- Levelling-Down
- Beverly-Hills-case
- 6. Konklusion
- Negative und positive These
- Definition der Grenzen des Egalitarismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die negative These der Suffizienz-Theorie, die besagt, dass jenseits eines kritischen Grenzwertes der ausreichenden Versorgung keine anderen Verteilungsnormen gültig sind. Ziel ist es, die Argumente für diese These zu analysieren und deren Implikationen zu diskutieren.
- Die positive These der Suffizienz-Theorie und ihre Definition von "genügend".
- Kritik an der Suffizienz-Theorie im Vergleich zu egalitaristischen Theorien und der Prioritätstheorie.
- Analyse der Fall-Implikationen der negativen These (Extreme Knappheit, Ineffizienz, Levelling-Down).
- Untersuchung der Grenzen des Egalitarismus im Kontext der Suffizienz-Theorie.
- Die Rolle des Neids und komparativer Vorteile in der Argumentation der Suffizienz-Theorie.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik der moralischen Rechtfertigung von staatlicher Umverteilung von Einkommen und Gütern ein. Sie stellt die Suffizienz-Theorie als einen möglichen Ansatz vor, der besagt, dass alle Personen ausreichend mit Gütern ausgestattet sein sollen, und wirft die Frage auf, ob dies die einzig gültige Verteilungsnorm ist. Die Einleitung legt den Grundstein für die folgende detaillierte Untersuchung der Suffizienz-Theorie und ihrer impliziten moralischen und gesellschaftlichen Konsequenzen.
2. Suffizienz: Zwei Thesen: Dieses Kapitel differenziert die Suffizienz-Theorie in zwei zentrale Thesen: die positive These, die sich auf einen kritischen Grenzwert ausreichender Versorgung konzentriert, und die negative These, die die Ungültigkeit anderer Verteilungsnormen jenseits dieses Grenzwertes behauptet. Es legt den Fokus auf die begriffliche Klärung und die Herausarbeitung der zentralen Argumentationslinien beider Thesen, die im weiteren Verlauf der Arbeit vertieft werden.
3. Überblick und Einordnung: Der dritte Abschnitt stellt die Suffizienz-Theorie in den Kontext bestehender ethischer und politischer Theorien. Es werden insbesondere der Egalitarismus und die Theorie der Priorität für schlechter gestellte Personen als Gegenpositionen diskutiert und ihre wesentlichen Unterschiede und Übereinstimmungen mit der Suffizienz-Theorie herausgearbeitet. Dies dient der Einordnung der Suffizienz-Theorie innerhalb des breiteren Feldes der Verteilungstheorien.
4. Die Negative These: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die detaillierte Analyse der negativen These der Suffizienz-Theorie. Es untersucht die Argumente für die Ausschließlichkeit dieser Norm und setzt sie in Beziehung zu konkurrierenden Theorien. Ein wichtiger Aspekt ist die Diskussion der Rolle von Neid und die Herausstellung der komparativen Vorteile der Suffizienz-Theorie gegenüber anderen Ansätzen.
5. Fall-Implikationen: Dieser Abschnitt untersucht die Konsequenzen der Anwendung der Suffizienz-Theorie in verschiedenen Szenarien, wie z.B. extreme Knappheit, Ineffizienz und "Levelling-Down". Es wird analysiert, wie die Theorie in diesen Fällen auf die moralischen Intuitionen zutrifft und welche Probleme sich aus ihrer Anwendung ergeben. Der Beverly-Hills-Fall dient als konkretes Beispiel zur Illustration der theoretischen Überlegungen.
Schlüsselwörter
Suffizienz-Theorie, positive These, negative These, Egalitarismus, Prioritätstheorie, Verteilungsnormen, kritischer Grenzwert, Gerechtigkeit, Umverteilung, Fall-Implikationen, Neid, komparative Vorteile.
Häufig gestellte Fragen zur Suffizienz-Theorie
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die negative These der Suffizienz-Theorie. Diese These besagt, dass jenseits eines kritischen Grenzwertes ausreichender Versorgung keine anderen Verteilungsnormen mehr gültig sind. Die Arbeit untersucht die Argumente für diese These und diskutiert deren Implikationen.
Welche Thesen der Suffizienz-Theorie werden behandelt?
Die Arbeit behandelt sowohl die positive als auch die negative These der Suffizienz-Theorie. Die positive These definiert einen kritischen Grenzwert ausreichender Versorgung. Die negative These besagt, dass über diesem Grenzwert hinaus andere Verteilungsnormen irrelevant werden.
Wie wird die Suffizienz-Theorie in den Kontext anderer Theorien eingeordnet?
Die Suffizienz-Theorie wird im Vergleich zu egalitaristischen Theorien und der Prioritätstheorie betrachtet. Die Arbeit untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen diesen Ansätzen.
Welche Fall-Implikationen der negativen These werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert die Implikationen der negativen These in verschiedenen Szenarien, darunter extreme Knappheit, Ineffizienz und "Levelling-Down" (Herabsetzung des Wohlstands der Bessergestellten). Der "Beverly-Hills-Fall" dient als konkretes Beispiel.
Welche Rolle spielen Neid und komparative Vorteile in der Argumentation?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Neid und komparativen Vorteilen in der Argumentation der Suffizienz-Theorie und wie diese Faktoren die Gültigkeit der negativen These beeinflussen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Argumente für die negative These der Suffizienz-Theorie zu analysieren und deren Implikationen zu diskutieren, um die Grenzen des Egalitarismus im Kontext der Suffizienz-Theorie zu definieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, den beiden Thesen der Suffizienz-Theorie, einem Überblick und Einordnung in bestehende Theorien, einer detaillierten Analyse der negativen These, den Fall-Implikationen und einer abschließenden Konklusion.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind Suffizienz-Theorie, positive These, negative These, Egalitarismus, Prioritätstheorie, Verteilungsnormen, kritischer Grenzwert, Gerechtigkeit, Umverteilung, Fall-Implikationen, Neid und komparative Vorteile.
Wie wird die positive These der Suffizienz-Theorie definiert?
Die positive These der Suffizienz-Theorie definiert einen kritischen Grenzwert ausreichender Versorgung. Die Arbeit untersucht, wie dieser Grenzwert definiert wird und welche Bedeutung er für die gesamte Theorie hat.
Wie wird die Kritik an der Suffizienz-Theorie im Vergleich zu anderen Theorien dargestellt?
Die Arbeit kritisiert die Suffizienz-Theorie im Vergleich zu egalitaristischen Theorien und der Prioritätstheorie, um ihre Stärken und Schwächen im Kontext der Verteilungsgerechtigkeit herauszuarbeiten.
- Arbeit zitieren
- MA Political and Economic Philosophy Elias Moser (Autor:in), 2011, Wieso ist genug nicht genug? - Eine Untersuchung der negativen These der Suffizienz-Theorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201044