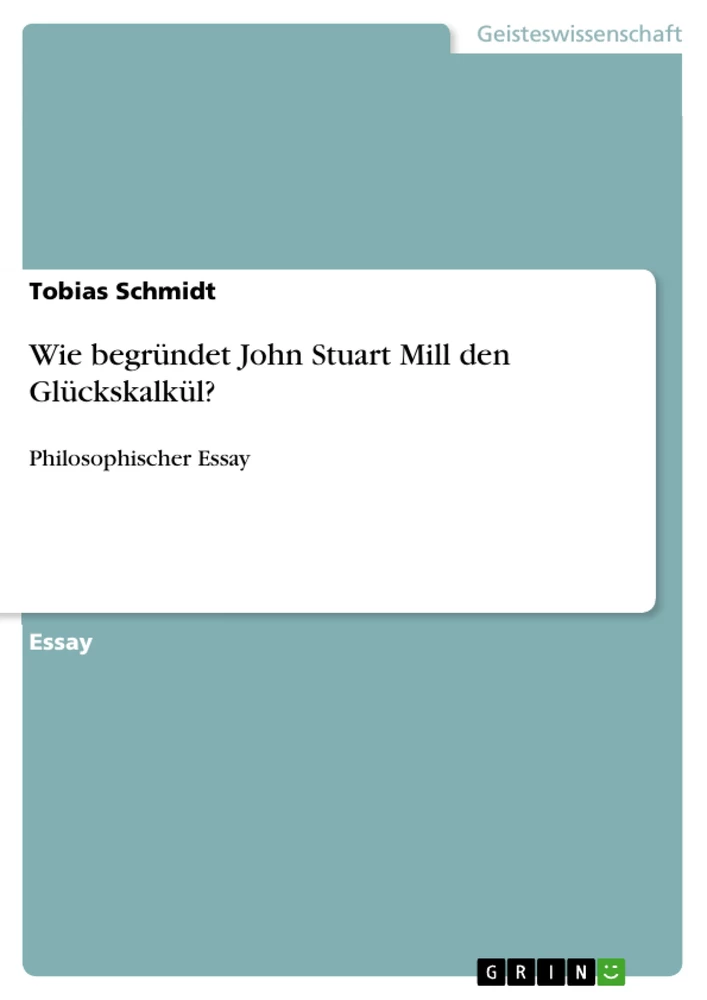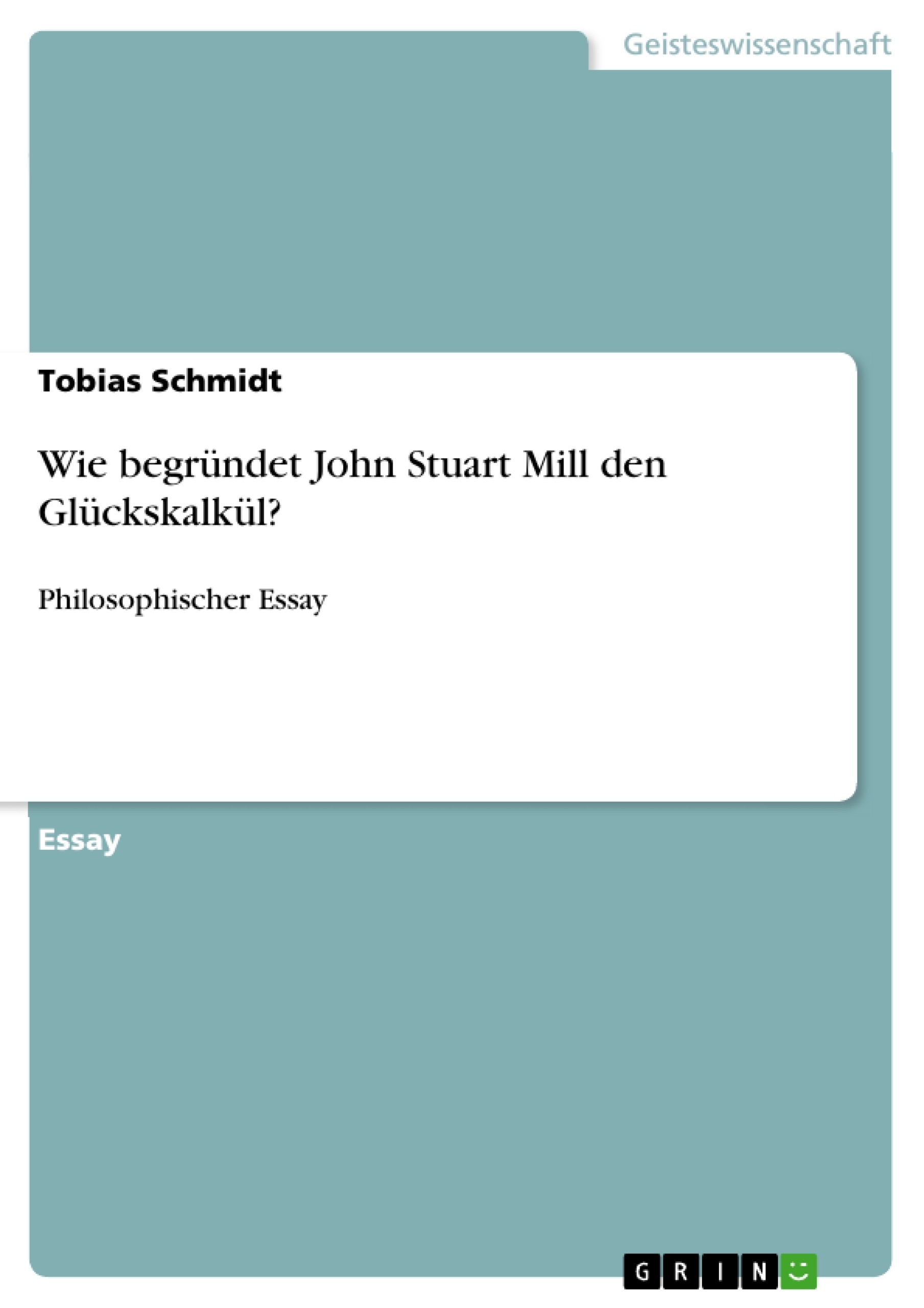Einleitung
1. Das Nützlichkeitsprinzip
2. Der Mill’sche Utilitarismus
3. Die Begründung des Glückkalküls
4. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. DasNützlichkeitsprinzip
2. DerMill’scheUtilitarismus
3. Die Begründung des Glückkalküls
4. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Einleitung
„ (...) Der Mensch strebt nicht nach Glück; nur der Engländer tut das.”[1]
Mit diesem Satz meint Friedrich Nietzsche natürlich nicht den Engländer an sich, sondern er zielt auf die Vertreter des Utilitarismus, die beiden Engländer Jeremy Bentham (1748-1832) und John Stuart Mill (1806 - 1873). Dabei scheint es, als läge er gegenwärtig falsch, denn der Begriff des „Glücks“ scheint omnipräsent: Eine Suchanfrage bei Google ergab in 0,11 Sekunden mehr als 25.400.000 Ergebnisse[2]. In fast allen Lebensbereichen finden wir Produkte die uns zu unserem Glück verhelfen sollen: Sei es Glückstee, Glücksratgeber, Glückpillen, Glücksschokolade, usw. - an einer Heidelberger Schule wird gar das Unterrichtsfach „Glück“ gelehrt und der Himalaja-Staat Bhutan hat die Maximierung des „Bruttonationalglücks" als oberstes Staatsziel ausgegeben. Doch zurück zum Utilitarismus. John Stuart Mill hat in seinem Werk „Utilitarianism" den von Jeremy Bentham entlehnten „Glückskalkül" weiterentwickelt und neu begründet. Dieser Begründung soll im Folgenden auf den Grund gegangen werden.
Um die Frage nach der Begründung beantworten zu können ist es sinnvoll, den Versuch zu unternehmen, den Utilitarismus zunächst in seinen Grundzügen, und im Anschluss, nämlich wie ihn John Stuart Mill beschrieben hat, darzustellen.
1. DasNützlichkeitsprinzip
Das „Nützlichkeitsprinzip", wie die anerkannte deutsche Übersetzung für „Utilitarianism" lautet, lässt sich im Wesentlichen durch drei Merkmale beschreiben. Erstens sind für die Beurteilung einer Handlung ausschließlich die Konsequenzen derselben von Relevanz. Entscheidungen werden also von absehbaren Folgen abhängig gemacht. Zweitens sind die Folgen danach zu bewerten, wie viele Menschen durch eine Handlung Glück erfahren. Drittens sind Handlungen zu bevorzugen, durch die das Glück möglichst vieler Menschen befördert wird. Wir müssen Glück in diesem Zusammenhang immer mit dem Nutzen gleichsetzen. Jeremy Bentham, der als erster eine utilitaristische Ethik ausarbeitete, spricht vom „(...JGlück der größten Zahl“ - “(...Jgreatest happiness of the greatest numberf...)“[3]. Seine Definition berücksichtigt ausschließlich den rein quantitativen Aspekt der Glücksmaximierung. Mill geht einen Schritt weiter.
2. DerMill'scheUtilitarismus
“It is better to be a human being dissatisfied than pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied.“[4]
Diese beiden Schlüsselsätze sind die, mit Recht, wohl meist zitierten Sätze im Zusammenhang mit dem von John Stuart Mill vertretenem Utilitarismus. Der wesentliche Unterschied zu Benthams Ansatz, der von seinen Zeitgenossen auch als sogenannte „Schweineethik" kritisiert wurde, ist, dass Mill dem Streben nach dem Glück, der Lust, eine qualitative Komponente hinzufügt. Unterscheidet der Bentham’sche Ansatz qualitativ nicht zwischen der Lust die man beispielweise bei der Befriedung seiner Grundbedürfnisse wie der Nahrungsaufnahme empfindet, und der, die man erfährt, wenn man einer geistigen Tätigkeit, wie zum Beispiel das erfolgreiche Schreiben eines Essays, nachgeht, so tut Mill das sehr wohl: „“Human beings have faculties more elevated than the animal appetites, and when once made conscious oft them, do not regard anything as happiness which does not include their gratification.“[5] Gleichzeitig differenziert er dabei aber auch zwischen Menschen, die sich mit höherer, beziehungsweise niederer Lust zufrieden geben. “And if the fool, or the pig, is of a different opinion, it is because they only know their own side oft he question. The other party tot he comparison knows both sides.“[6] Es gibt also nach Mill, im Bezug auf den Bentham’schen Ansatz Menschen, die dem Schwein näher sind als andere.
Halten wir also fest: Das letztendliche Ziel menschlichen Handelns ist die Glücksmaximierung, wobei Mill zwischen qualitativ höheren und niederen Glückszuständen unterscheidet. Wie sich Mill dieses Glückskalkül erschließt, soll im folgenden Abschnitt dargestellt werden.
[...]
[1] Nietzsche, Friedrich: Götzendämmerung. Apple EBook #7203, Sprüche 12
[2] Google Suchanfrage „Glück" am 02.01.2012
[3] Bentham, Jeremy: A Fragment on Government, Preface, S.93
[4] Mill, John Stuart: Utilitarianism, Chapter II, S. 32
[5] Mill, John Stuart: Utilitarianism, Chapter II, S.27
[6] Mill, John Stuart: Utilitarianism, Chapter II, S. 32
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Nützlichkeitsprinzip im Utilitarismus?
Handlungen werden nach ihren Konsequenzen bewertet; Ziel ist das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl von Menschen.
Wie unterscheidet sich Mill von Bentham?
Während Bentham Glück rein quantitativ maß, fügte Mill eine qualitative Komponente hinzu („Lieber ein unzufriedener Sokrates als ein zufriedenes Schwein“).
Was versteht Mill unter "höherer" und "niederer" Lust?
Geistige Tätigkeiten und moralische Gefühle gelten als qualitativ höherwertiges Glück im Vergleich zu rein körperlichen Triebbefriedigungen.
Wie begründet Mill seinen Glückskalkül?
Er argumentiert, dass Menschen, die beide Arten von Lust kennen, die geistige Lust aufgrund ihrer höheren Qualität bevorzugen würden.
Warum wurde Benthams Utilitarismus als "Schweineethik" kritisiert?
Kritiker warfen ihm vor, dass seine Lehre keinen Unterschied zwischen menschlichen Freuden und denen von Tieren mache.
- Quote paper
- Tobias Schmidt (Author), 2012, Wie begründet John Stuart Mill den Glückskalkül?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201103