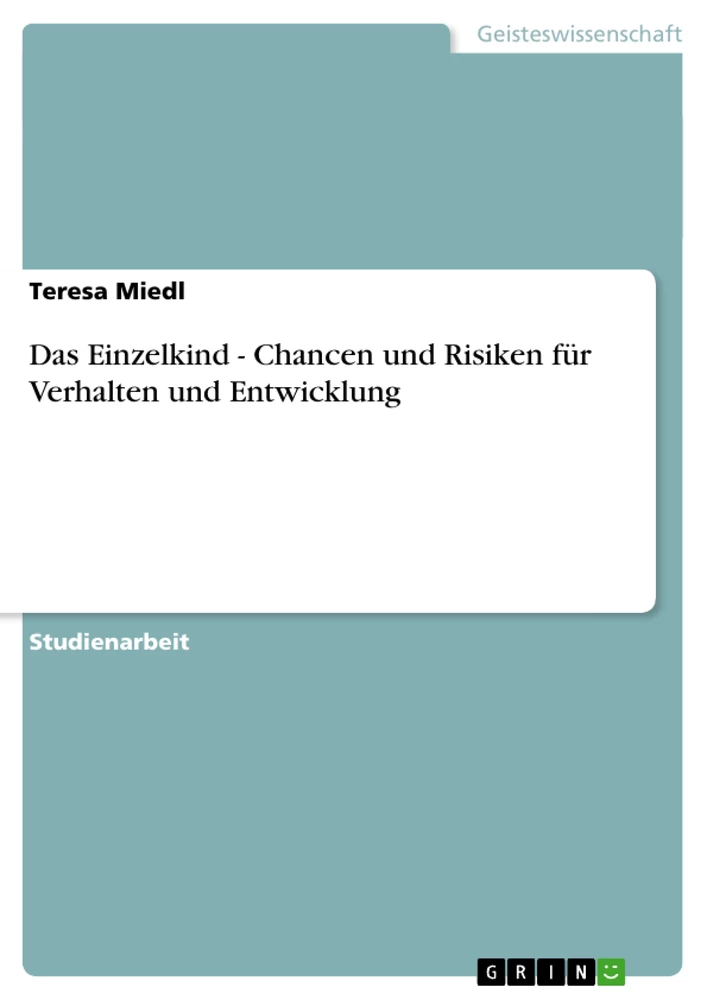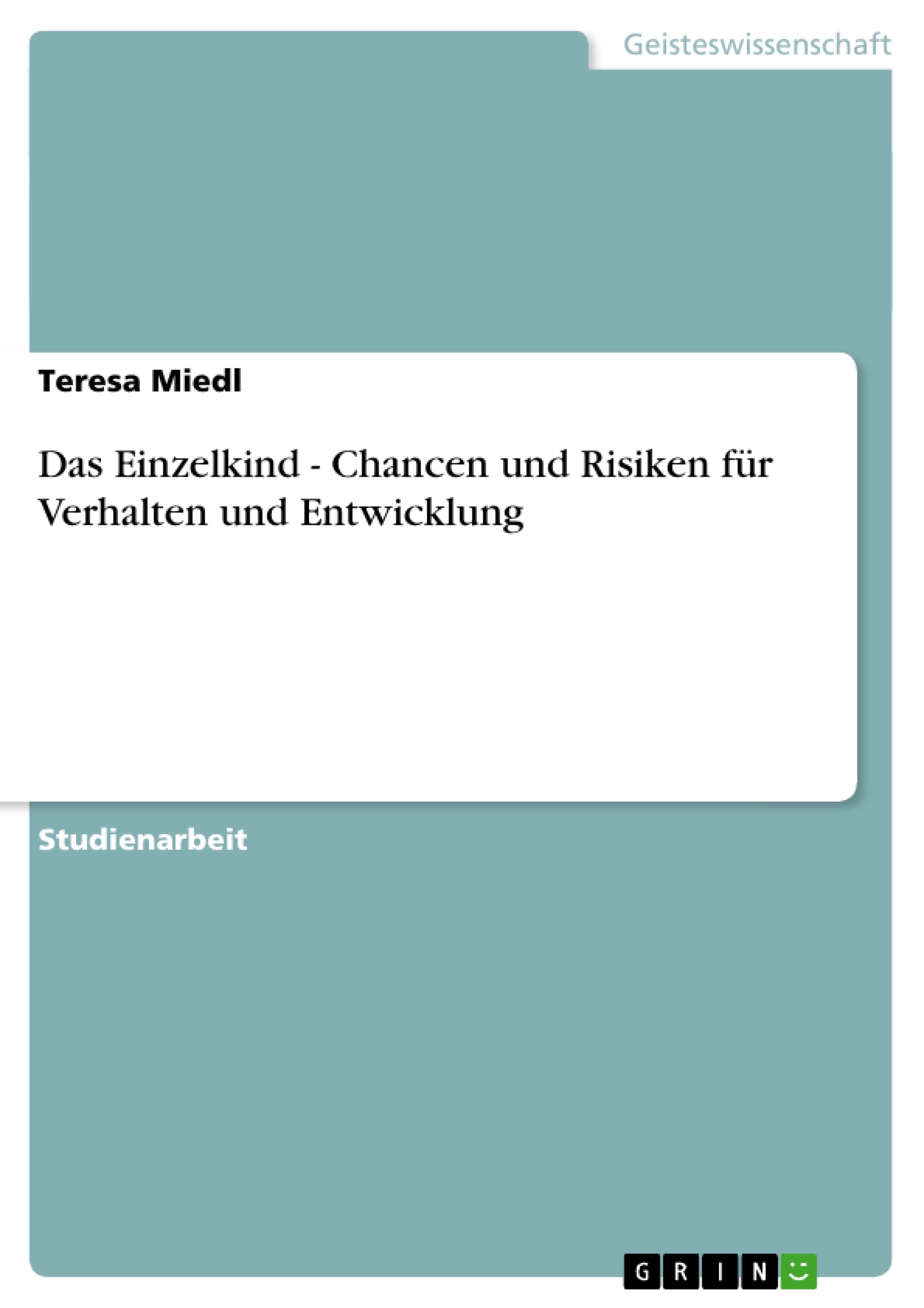„Stirbt Deutschland aus?“… „Umkehrung der Bevölkerungspyramide“… „Familien werden immer kleiner“… Diese und ähnliche Nachrichten wandern nun schon seit einigen Jahren durch Medien und Presse.
Familienpolitik ist ein essentieller Bestandteil der täglichen politischen Arbeit geworden, dem es nach wie vor neuer Lösungen und Ideen bedarf.
„Der Anteil der Kinder an der Gesamtbevölkerung sinkt kontinuierlich: 1970 zählte das Statistische Bundesamt noch 14,1 Mill. Kinder (unter 15 Jahren), 1987 nur noch 8,9 Mill., ein Absinken von 23,2% auf 14,6% (gemessen an der Zahl der Einwohner), […]“ (Winkel, 1991, S.16).
Neueren Angaben zufolge liegt der „Anteil der Einzelkinder bei etwa 31 Prozent, etwa 46 Prozent sind Teil eines Geschwisterpaares, und etwa 23 Prozent leben mit mehreren Geschwistern zusammen.“ (Lenz & Tillmann, 1997, S.12) Lenz und Tillmann weisen allerdings ausdrücklich darauf hin, diese Daten nicht als endgültig zu werten. Es handele sich bei den oben genannten Zahlen lediglich um eine Momentaufnahme, da es nicht ausgeschlossen ist, dass Einzelkinder ebenfalls Geschwister bekommen.
Der Trend scheint trotz allem eindeutig in Richtung Einzelkind zu gehen. Das zumindest würde die Vielzahl der Leute vermuten.
Denn waren es um 1900 fast vier Kinder pro Ehe, so hat sich der Anteil der Kinder bis in die 80er Jahre mehr als halbiert - auf etwa 1,3 Kinder pro Ehe. (Lenz & Tillmann, 1997, S.12)
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung
- 2 Entwicklung der Familiensituation
- 2.1 Kurzer Epochenüberblick
- 2.2 Wertewandel und Geburtenrückgang
- 3 Chancen und Risiken für das Verhalten des Einzelkindes
- 3.1 Risikofaktoren
- 3.2.1 Probleme der Dreierkonstellation
- 3.2.2 Einzelkindtypische Erziehungsfehler
- 3.3 Chancen für das Einzelkind
- 3.3.1 Vergleich mit Geschwisterkindern
- 3.3.2 Besondere Möglichkeiten
- 4 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Chancen und Risiken für die Entwicklung und das Verhalten von Einzelkindern vor dem Hintergrund des demografischen Wandels in Deutschland. Sie beleuchtet die historischen Entwicklungen der Familiensituation und analysiert die Faktoren, die zum Geburtenrückgang und zum Anstieg der Einzelkinderzahlen beigetragen haben. Das Ziel ist es, ein objektives Bild von Einzelkindern zu zeichnen und gängige Vorurteile zu widerlegen.
- Historisches Verständnis des demografischen Wandels und des Wertewandels in Familien
- Analyse der Risikofaktoren für die Entwicklung von Einzelkindern
- Untersuchung der Chancen und besonderen Möglichkeiten für Einzelkinder
- Bewertung der Auswirkungen der Dreierkonstellation (Eltern und Kind)
- Vergleich der Entwicklung von Einzelkindern mit der Entwicklung von Kindern mit Geschwistern
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemstellung: Die Arbeit beginnt mit der Darstellung des demografischen Wandels in Deutschland, charakterisiert durch sinkende Geburtenraten und einen steigenden Anteil von Einzelkindern. Sie führt in die Problematik ein und stellt die Forschungsfrage nach den Chancen und Risiken für die Entwicklung von Einzelkindern. Die Einleitung verweist auf den weit verbreiteten Vorurteilen gegenüber Einzelkindern und betont die Notwendigkeit einer objektiven Betrachtungsweise.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Chancen und Risiken für Einzelkinder
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Chancen und Risiken für die Entwicklung und das Verhalten von Einzelkindern in Deutschland vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Sie analysiert historische Entwicklungen der Familiensituation, den Geburtenrückgang und den Anstieg der Einzelkinderzahlen, um ein objektives Bild von Einzelkindern zu zeichnen und gängige Vorurteile zu widerlegen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den historischen Wandel der Familiensituation in Deutschland, den Einfluss von Industrialisierung, medizinischem Fortschritt und Verhütungsmethoden auf die Geburtenrate, den Wertewandel in Familien, die Risikofaktoren für die Entwicklung von Einzelkindern, die Chancen und besonderen Möglichkeiten für Einzelkinder, die Auswirkungen der Dreierkonstellation (Eltern und Kind) und einen Vergleich der Entwicklung von Einzelkindern mit der Entwicklung von Kindern mit Geschwistern.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 beschreibt die Problemstellung und die Forschungsfrage. Kapitel 2 beleuchtet die historische Entwicklung der Familiensituation in Deutschland. Kapitel 3 analysiert Chancen und Risiken für Einzelkinder, einschließlich Risikofaktoren, Chancen und einen Vergleich mit Kindern mit Geschwistern. Kapitel 4 bietet einen Ausblick.
Welche konkreten Aspekte der Entwicklung von Einzelkindern werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet sowohl die Risikofaktoren für die Entwicklung von Einzelkindern (z.B. erzieherische Fehler, Probleme der Dreierkonstellation) als auch die Chancen und besonderen Möglichkeiten (z.B. individuelle Förderung, mehr Aufmerksamkeit der Eltern). Ein Vergleich mit der Entwicklung von Kindern mit Geschwistern wird ebenfalls durchgeführt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes und objektives Bild der Entwicklung von Einzelkindern zu liefern und weit verbreitete Vorurteile zu widerlegen. Die Arbeit will ein differenziertes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen fördern, die mit dem Aufwachsen als Einzelkind verbunden sind.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Analyse des demografischen Wandels und der historischen Entwicklung der Familiensituation in Deutschland. Sie analysiert die Faktoren, die zum Geburtenrückgang und zum Anstieg der Einzelkinderzahlen beigetragen haben. Die verwendeten Methoden sind deskriptiv und analytisch, basierend auf wissenschaftlicher Literatur und Daten.
- Citation du texte
- Teresa Miedl (Auteur), 2002, Das Einzelkind - Chancen und Risiken für Verhalten und Entwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20114