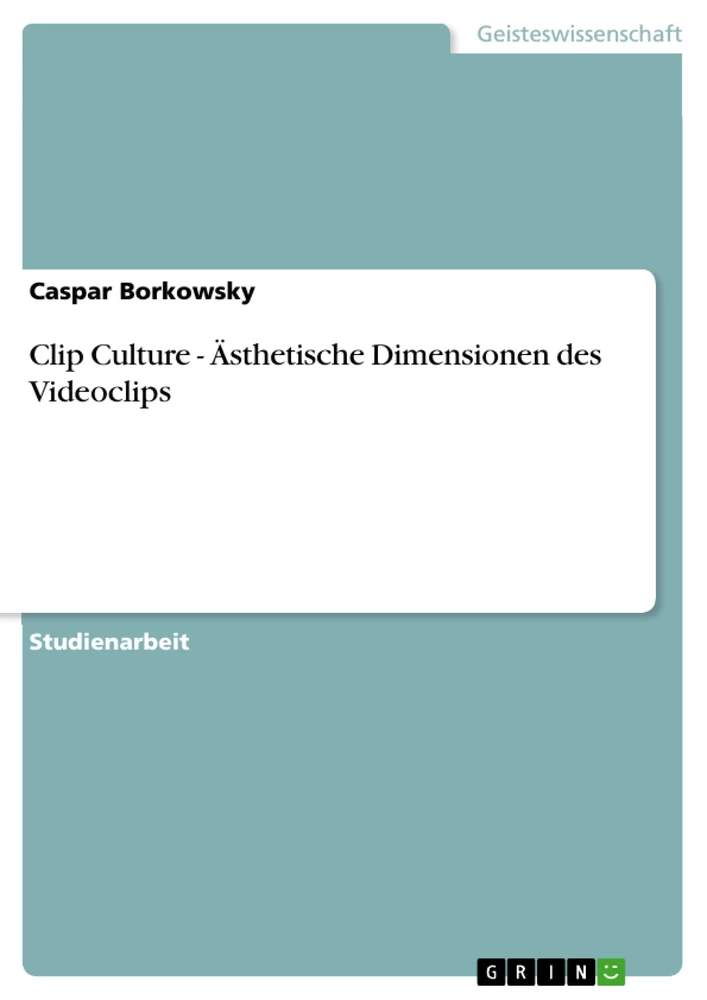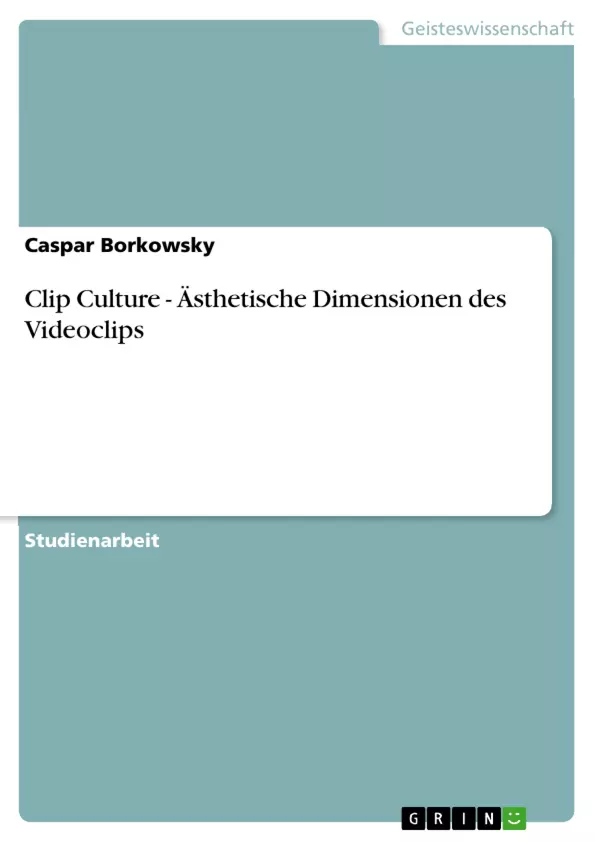Die abendländische Philosophie stellt sich den Menschen gerne als das genuin wahrheitsliebenden Wesen vor, lässt dabei aber außer Acht, dass er es gleichzeitig zu lieben scheint, getäuscht zu werden. Die häufige Verwendung mystischer Assoziations- und Deutungsmuster deutet daraufhin, dass sich Videoclips als eine adäquate Form der Vernunftkritik anbieten wollen. Um den Gedanken des täuschungsliebenden Menschen zu erweitern, soll hier an Blaise Pascal erinnert werden, der vorschlug, das Leben als eine stabile Illusion zu verstehen.
Das menschliche Verhalten ist im allgemeinen trugbefangen und getäuscht, wir begnügen uns nicht mit unserer reinen Existenz und versuchen als mehr zu erscheinen als wir eigentlich sind. In Videoclips ist diese Thematik eine der häufigsten, phantastische und "übermenschliche" Welten in Hülle und Fülle offenbaren den dringenden Wunsch des Menschen, über sein reales Sein hinauszuwachsen. Auf den Medienrezipienten angewandt könnte man behaupten: Der Betrachter hat die Wahrheit, aber sie ist nicht dort, wo er sich die Wahrheit eigentlich immer denkt. Welche Wahrheit hat hier der Betrachter? Als Annäherung soll die Vermutung dienen, dass die Wahrheit hier in Form einer Realität medialer Wirklichkeit erscheint(!). Hier offenbart sich eine zwiespältige Problematik: Denn wenn es so etwas wie Medienwirklichkeit der elektronischen Bilder geben soll, kann sie nur aus einer Fusion von Wirklichem und Möglichen bestehen, und damit wird das Realitätsprinzip im traditionellen Sinne außer Kraft gesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Ästhetik der Oberfläche
- Die Wahrheit und ihr Schein
- Die Simulation und ihre Folgen
- Clip Culture als neue Form der Bildlichkeit
- Clip „The Child“ von Alex Gopher
- Symbolische Ordnung und Chaos
- Ästhetik des Verschwindens und Wiederkehrens
- Videoclips und die Postmoderne
- Der Verzicht auf Interpretation
- Die Auflösung der klassischen Bildlichkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der ästhetischen Dimension des Videoclips und untersucht, wie er als ein exemplarisches Phänomen einer Ästhetik der Oberfläche betrachtet werden kann. Sie fragt nach der Rolle des Scheins und der Simulation in der Videokultur und analysiert die Bedeutung des Videoclips für die postmoderne Bildlichkeit.
- Ästhetik der Oberfläche und Schein
- Simulation und Hyperrealität
- Verhältnis von Wirklichkeit und medialer Wirklichkeit
- Symbolische Ordnung und Chaos
- Postmoderne Bildlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Ästhetik der Oberfläche
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, wie viel Wahrheit der Mensch ertragen kann und wie die Sehnsucht nach Illusion und Täuschung in der Ästhetik des Videoclips zum Ausdruck kommt. Anhand von Nietzsche und Pascal wird die These aufgestellt, dass der Mensch in Videoclips einen Wunsch nach dem Überschreiten seines realen Seins artikuliert.
Clip Culture als neue Form der Bildlichkeit
Der Clip „The Child“ von Alex Gopher wird als Beispiel dafür herangezogen, wie Videoclips durch ihren simplen Darstellungsmodus die Welt als Text lesbar machen können. Im Weiteren werden die Konzepte der symbolischen Ordnung und des Chaos im Kontext von Videoclips untersucht, wobei Lacans Blicktheorie und Nietzsches Idee des Chaos als befruchtender Faktor im Vordergrund stehen.
Videoclips und die Postmoderne
Die Arbeit beleuchtet, wie die neuen Bilder der Videoclips in klassischen Kategorien der Bildlichkeit nicht mehr fassbar sind und zu einem Verlassen der platonischen Stellung zwingen. Hier werden die Ideen von Baudrillard, Kittler und Fiske zur postmoderne Bildlichkeit und deren Auswirkungen auf die Rezeption von Videoclips diskutiert.
Schlüsselwörter
Videoclip, Ästhetik, Oberfläche, Schein, Simulation, Hyperrealität, Symbolische Ordnung, Chaos, Postmoderne, Bildlichkeit, Medienwirklichkeit, Rezeption, Kulturkritik
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Clip Culture“?
Es bezeichnet eine Medienkultur, die durch die Ästhetik kurzer Videoclips geprägt ist, in denen Simulation und Oberfläche eine zentrale Rolle spielen.
Wie verhalten sich Realität und mediale Wirklichkeit im Videoclip?
Videoclips erschaffen eine Fusion aus Wirklichem und Möglichem, wodurch das traditionelle Realitätsprinzip zugunsten einer medialen Hyperrealität außer Kraft gesetzt wird.
Warum lieben Menschen die „Täuschung“ im Clip?
In Anlehnung an Pascal und Nietzsche wird argumentiert, dass Menschen den Wunsch haben, über ihr reales Sein hinauszuwachsen, was Videoclips durch phantastische Welten ermöglichen.
Was analysiert die Arbeit am Clip „The Child“ von Alex Gopher?
Der Clip dient als Beispiel für eine neue Bildlichkeit, in der die Welt als lesbarer Text dargestellt wird und symbolische Ordnung auf visuelles Chaos trifft.
Welchen Einfluss hat die Postmoderne auf Videoclips?
Die Postmoderne zeigt sich im Verzicht auf klassische Interpretation und in der Auflösung fester Bildkategorien zugunsten von Simulation und Affekt.
- Quote paper
- Caspar Borkowsky (Author), 2001, Clip Culture - Ästhetische Dimensionen des Videoclips, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2012