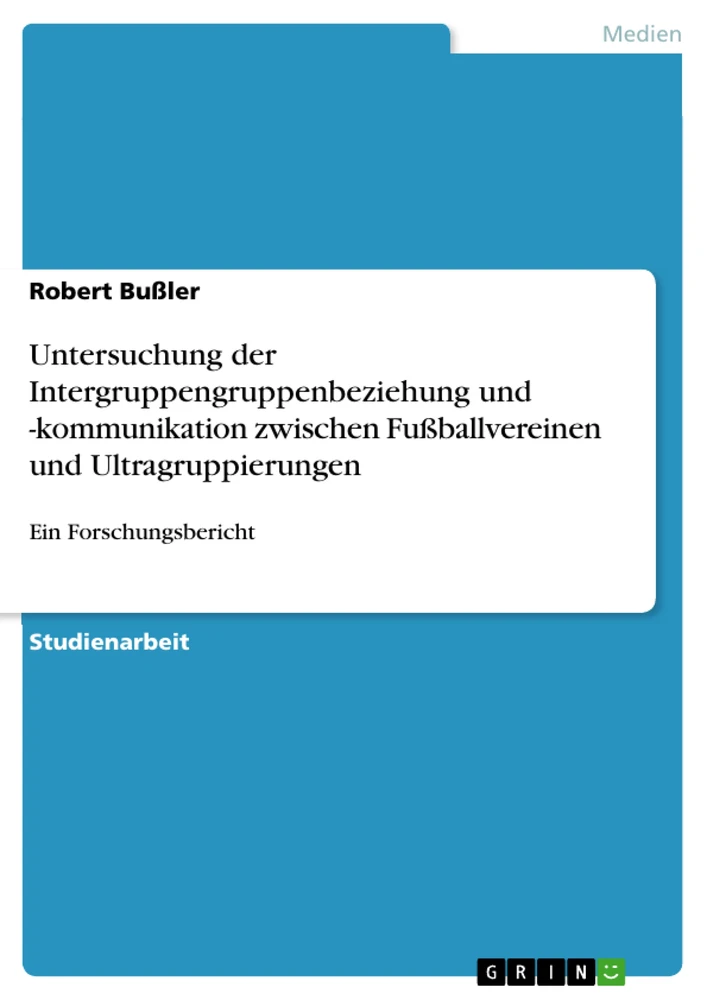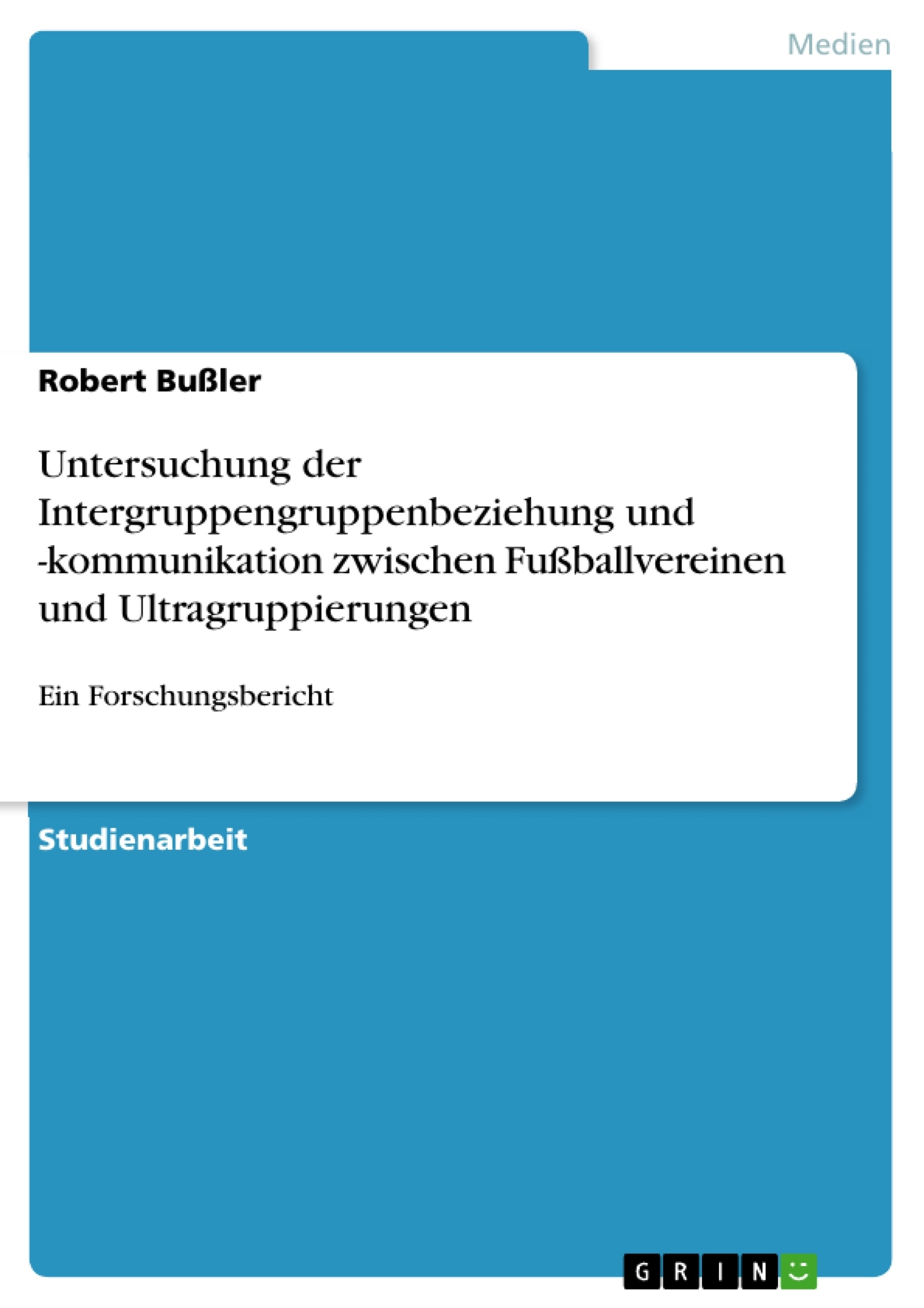Diese Projektarbeit ist innerhalb des Seminars „Intergruppenkommunikation“ an der Friedrich-Schiller-Universität Jena entstanden. Ausgehend von der Frage, welche Phänomene von Intergruppenbeziehungen in der Realität zu beobachten sind, kamen wir über faschistisch eingestellte Gruppierungen und deren Beziehung zu Fußballanhängern, zu der vermehrt medial genannten Gruppe der „Ultras“.
Gerade im Zusammenhang mit Gewaltausbrüchen rund um die Spieltage der deutschen Fußball-Bundesligen taucht immer öfter der Begriff „Ultra“ in den Schlagzeilen deutscher Medienangebote auf. Ganz beispielhaft als Schlagzeile und als Ausgang unserer sozialpsychologischer Überlegungen lautete ein Artikel auf Stern.de (Bellstedt, 2011): „Ultras in der Fußball-Bundesliga - Wenn Fans zu Feinden werden“. Noch interessanter für die weitere Betrachtung und die Analyse der Intergruppenbeziehung sind jedoch folgende Sätze der Unterschlagzeile (ebd.): „In Frankfurt hat ein Polizist zum Selbstschutz Gebrauch von seiner Schusswaffe gemacht. Eine Gruppe von Ultras hatte ihn massiv bedroht. Gewalt und Provokation sind Teil der Ultra-Fankultur. Was neu ist: Die ‚Fans' greifen immer öfter auch den eigenen Verein an.“ In dieser Aussage steckt der Ursprung unserer Überlegungen. Zuvorderst ist zu klären was eine ‚Gruppe von Ultras' ist und inwiefern sie sich von ‚normalen' Fans oder auch von Hooligans unterscheidet. Im folgenden Kapitel wird diese Ultrabewegung dargestellt. Es wird versucht deren Aktivitäten, Einstellungen und Zielsetzungen zu erörtern. Weiter werden in dem Kapitel die Probleme, bzw. Konflikte herausgestellt, die in der Kommunikation mit dem Verein, der eigentlich das zentrale Objekt einer unterstützenden Gruppierung wie der Ultras ist, auftreten. Das solche Probleme auftreten müssen, erschließt sich ebenfalls aus der oben genannten Unterschlagzeile, wenn Bellstedt schreibt, dass diese „Fans“ immer öfter auch den eigenen Verein angreifen. Im zweiten Kapitel wird es somit auch darum gehen, wie solche „Angriffe“ geäußert werden. Wie äußert diese Gruppierung überhaupt ihre Ansichten und Forderungen? Wie antwortet der Verein darauf? Es geht also um die kommunikationspsychologisch interessante Frage, wie die Kommunikation zwischen diesen beiden Parteien stattfindet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EinleitungRB
- 2. Problemstellung: Konflikte zwischen Ultragruppierungen und VereinenDR
- 2.1 Die Ultrabewegung
- 2.2 Aktivitäten, Einstellungen und Zielsetzungen der Ultras
- 2.3 Fußballbezogene Medienberichterstattung
- 2.4 Forschungsfragen
- 3. Theoretischer Hintergrund mit Anwendungsbeispielen zur Ultra-Verein-IntergruppenbeziehungCP
- 3.1 Soziale Identität
- 3.2 Stereotype, Vorurteile und Stereotypisierung
- 3.3 Emotionalisierung
- 4. Stand der empirischen ForschungRB
- 5. Induktion der HypothesenRB
- 6. Methodisches DesignNW
- 6.1 Befragung
- 6.2 Quantitative Inhaltsanalyse
- 6.3 Bezug zu den Hypothesen
- 6.4 Einschränkungen
- 7. Erwartete Ergebnisse und FazitRB
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit untersucht die Intergruppenbeziehung und -kommunikation zwischen Fußballvereinen und Ultragruppierungen. Sie analysiert die Konflikte, die zwischen diesen Gruppen entstehen, und untersucht die Rolle der Medien in der Gestaltung dieser Beziehung. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Kommunikationsprozesse zwischen diesen Gruppen zu entwickeln und mögliche Lösungsansätze zu erarbeiten.
- Soziale Identität und Gruppenzugehörigkeit von Ultras und Vereinsmitgliedern
- Stereotype und Vorurteile, die zwischen Ultras und Vereinen existieren
- Kommunikationsprozesse zwischen Ultras und Vereinen, sowohl direkt als auch indirekt
- Die Rolle der Medien in der Darstellung von Ultras und der Beeinflussung der Intergruppenbeziehung
- Mögliche Auswirkungen der medialen Berichterstattung auf die Kommunikation zwischen Ultras und Vereinen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Hintergrund der Projektarbeit vor und führt den Begriff „Ultra“ ein. Kapitel 2 beleuchtet die Ultrabewegung, ihre Aktivitäten, Einstellungen und Zielsetzungen sowie die Konflikte, die in der Kommunikation mit den Vereinen auftreten. In Kapitel 3 werden die relevanten Theorien zur sozialen Identität, Stereotypisierung und Emotionalisierung erläutert und auf die Intergruppenbeziehung zwischen Ultras und Vereinen angewendet. Kapitel 4 gibt einen Überblick über den Forschungsstand zu den behandelten Theorien. Kapitel 5 leitet aus den vorherigen Kapiteln die Hypothesen der Arbeit ab. Kapitel 6 erläutert das methodische Design, das eine Kombination aus Befragung und quantitativer Inhaltsanalyse umfasst. Kapitel 7 diskutiert die erwarteten Ergebnisse und zieht ein Fazit der Arbeit.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen dieser Arbeit sind: Ultrabewegung, Fußballvereine, Intergruppenkommunikation, soziale Identität, Stereotype, Vorurteile, Emotionalisierung, Medienberichterstattung, Konfliktpotenzial, Kontakthypothese.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet Ultras von "normalen" Fans?
Ultras zeichnen sich durch eine extrem intensive Unterstützung ihres Vereins, eine feste Organisationsstruktur und eine oft kritische Haltung gegenüber der Kommerzialisierung aus.
Warum kommt es zu Konflikten zwischen Ultras und Vereinen?
Konfliktpunkte sind oft Stadionverbote, Pyrotechnik, Anstoßzeiten und das Gefühl der Fans, vom Verein nur als Kunden wahrgenommen zu werden.
Welche Rolle spielen Medien bei der Wahrnehmung von Ultras?
Medien fokussieren oft einseitig auf Gewalt und Provokation, was Stereotype verstärkt und die Kommunikation zwischen den Gruppen erschwert.
Was besagt die Theorie der sozialen Identität hierzu?
Sie erklärt, wie die Zugehörigkeit zur Ultra-Gruppe das Selbstbild stärkt und zur Abgrenzung gegenüber "Outgroups" (Polizei, gegnerische Fans, Vereinsführung) führt.
Wie äußern Ultras ihre Kritik?
Kritik wird oft durch Banner (Spruchbänder), Choreografien, Gesänge oder in extremen Fällen durch Boykotte und Protestaktionen geäußert.
- Quote paper
- Robert Bußler (Author), 2011, Untersuchung der Intergruppengruppenbeziehung und -kommunikation zwischen Fußballvereinen und Ultragruppierungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201215