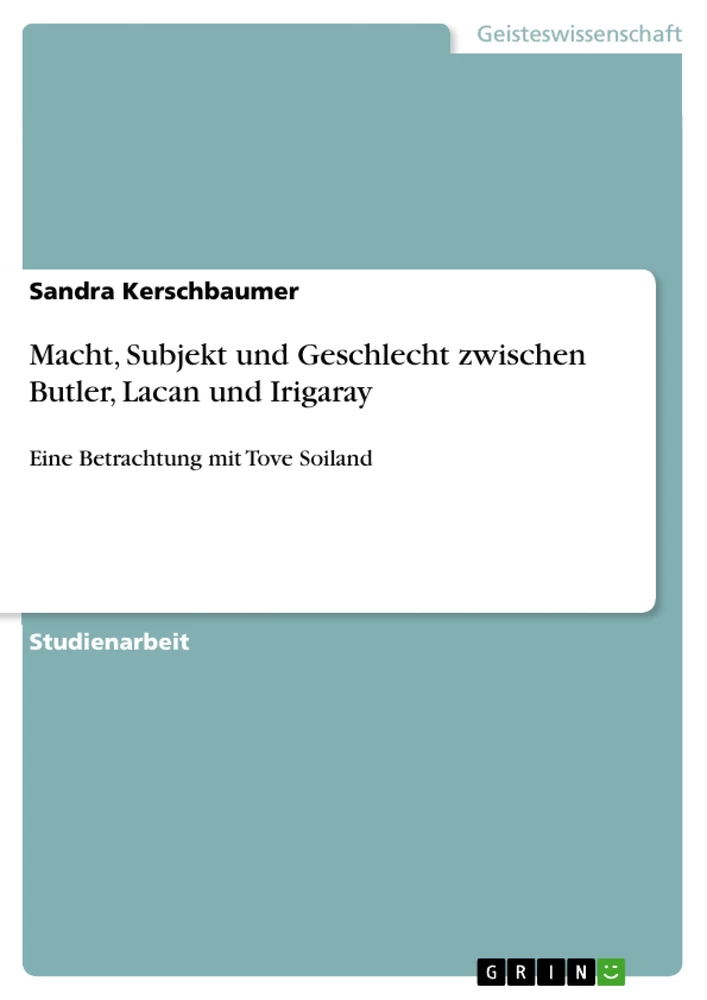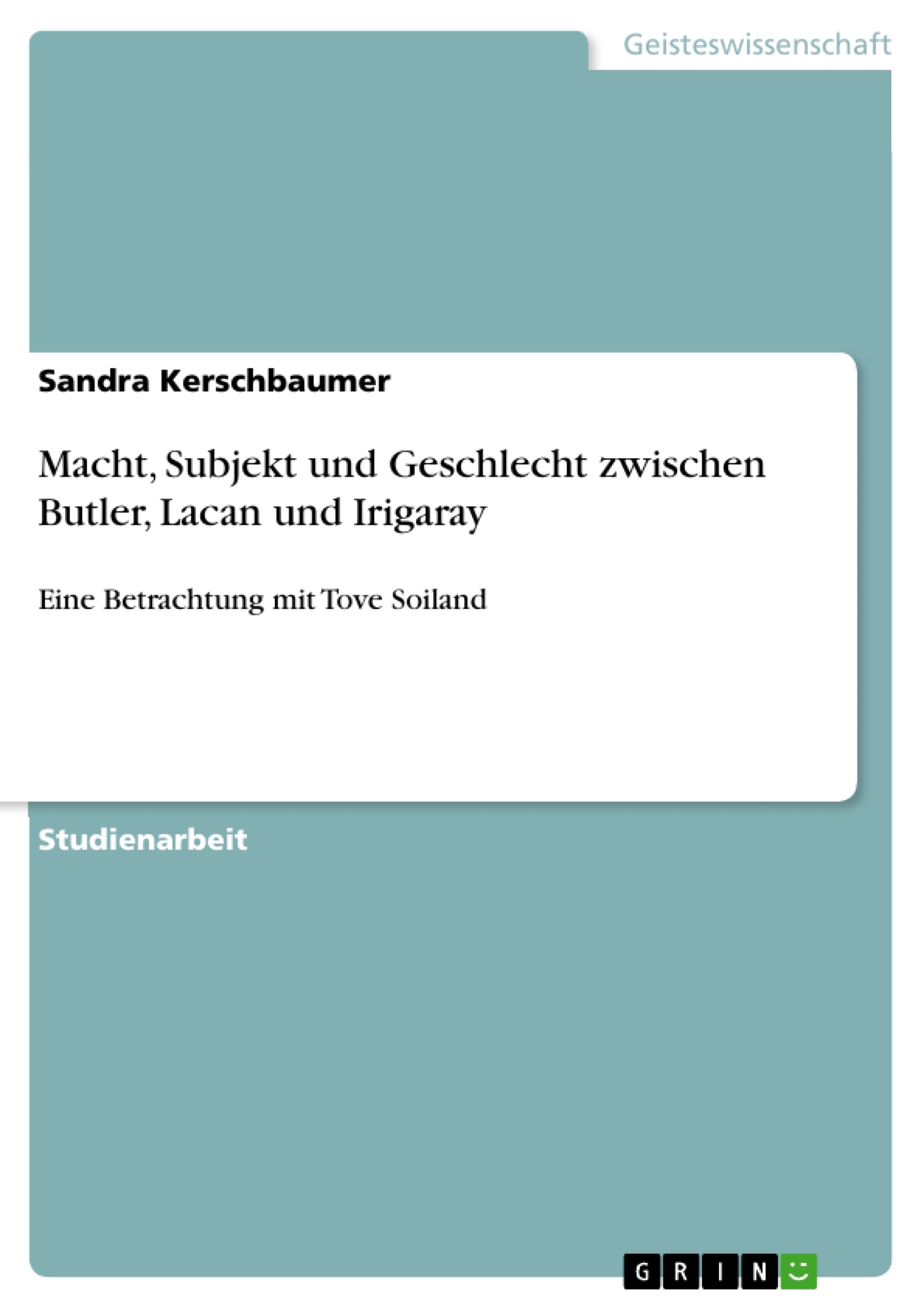Fasst man Geschlecht, wie es in der Konzeption von gender in den Sozialwissenschaften mittlerweile der Brauch ist, als soziale Kategorie, so stellt sich unweigerlich die Frage, wie denn Subjekte dazu gebracht werden, Geschlechterrollen so sehr zu verinnerlichen, dass sie als quasi-natürliche Eigenschaft erscheinen, als Teil der persönlichen Identität, als welche sie auch lange Zeit angesehen wurde. Nicht selten verweist diese Frage auf einen natürlichen, materiellen Rest, der sich der Dekonstruktion von gesellschaftlichen Normen widersetzt, und der in der Dichotomie von gender und sex persistiert. Sex stünde in dieser Konzeption als das biologische Geschlecht, während gender die den beiden existenten Geschlechtern zugeschriebenen Rollenerwartungen und kulturell vorgeschriebenen Über- und Ausformungen der biologischen Körper bezeichnet. Diese werden als historisch, als kontingent und somit veränderbar angesehen, und auf dieser Ebene tut sich ein breites Feld von Dekonstruktion, Subversion Neuaushandlung auf. Die engen Grenzen der tradierten Rollenbilder wurden längst gesprengt, und sind zwar immer noch reaktionäre Kräfte am Werk, die sich ihrer Rekonstruktion widmen, so gibt es wohl genauso viele, die sich in ihrer Überschreitung üben.
Das Spiel mit den Geschlechterrollen ist durchaus gesellschaftsfähig, nicht nur deren Austauschbarkeit, sondern auch ihre Pluralisierung hat in die Praxis der alltäglichen Selbstdarstellung Einzug gehalten und damit auch in jenen Gesellschaftsbereichen, die das Repertoire und die Requisiten dieser Inszenierungen der Geschlechterpluralität bereitstellen: die Mode, Literatur, Film und Lifestyle-Welten. Immer mehr wird auch der Körper selbst zum Ziel dieser Stilisierung, wird verändert und geformt, und auch das biologische Geschlecht, sex, bildet hier keine Grenze mehr. Die körperliche Basis ist keine feste, auch sie ist dekonstruierbar. Doch bleibt die Frage: Wie stehen diese Rollen, diese mannigfaltigen, kulturellen, historisch veränderbaren Verhaltensweisen, Körperlichkeiten und Accessoires der Geschlechtsrepräsentationen denn überhaupt in Beziehung zu dem, was wir als Subjekt bezeichnen? Gibt es einen unveränderbaren Kern des Ich, die Identität, oder gehen wir vollkommen in diesem Set aus Stilisierungen auf? Gibt es dieses Subjekt als solches überhaupt, und wenn ja, ist es überhaupt als solches fassbar?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Judith Butler: Gender, Performativität und die Heteronormativität der Psychoanalyse
- 2. Butler liest Lacan: der Vorwurf des Androzentrismus und Phallozentrismus
- 3. Tove Soiland liest Butler: Die Unvereinbarkeit von gender und Psychoanalyse
- 4. Tove Soiland liest Luce Irigaray liest Lacan: Frauenmarkt, Hom(m)osexualität und die Frage nach dem weiblichen Subjekt
- 5. Tove Soiland: Zentrale Gemeinsamkeiten und Divergenzen bei Butler und Irigaray
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Positionen Judith Butlers und Luce Irigarays im Hinblick auf das Verhältnis von Geschlecht und Subjekt, wie sie von Tove Soiland in ihrem Buch konturiert werden. Im Zentrum steht Butlers Kritik an Lacans Subjekttheorie und ihre These, dass Geschlecht durch Performativität konstituiert wird. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie sich Butlers und Irigarays Auseinandersetzungen mit Lacans Werk im Hinblick auf die Überwindung tradierter Geschlechterrollen und die Konstruktion des Subjekts unterscheiden.
- Judith Butlers Theorie der Performativität und ihre Kritik an der Psychoanalyse
- Die Bedeutung von Lacans Subjekttheorie für Butler und Irigaray
- Die unterschiedlichen Interpretationen Lacans durch Butler und Irigaray
- Die Frage nach dem Verhältnis von Subjekt und Geschlecht
- Die Bedeutung von Macht und Geschlechterrollen in der Subjektwerdung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in Butlers Theorie der Performativität ein und beleuchtet ihre Kritik an der Psychoanalyse als heteronormativ. Das zweite Kapitel analysiert Butlers Lektüre Lacans und ihren Vorwurf des Androzentrismus und Phallozentrismus. Das dritte Kapitel widmet sich Soilands Kritik an Butlers Dekonstruktion der Psychoanalyse. Das vierte Kapitel vergleicht Soilands Lektüre von Irigaray mit Butlers Position und analysiert deren unterschiedliche Ansätze zur Frage des weiblichen Subjekts.
Schlüsselwörter
Gender, Performativität, Psychoanalyse, Lacan, Subjekt, Geschlecht, Macht, Heteronormativität, Androzentrismus, Phallozentrismus, Irigaray, Soiland, Frauenmarkt, Hom(m)osexualität, sexuelle Differenz.
- Quote paper
- BA MA Sandra Kerschbaumer (Author), 2011, Macht, Subjekt und Geschlecht zwischen Butler, Lacan und Irigaray, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201280