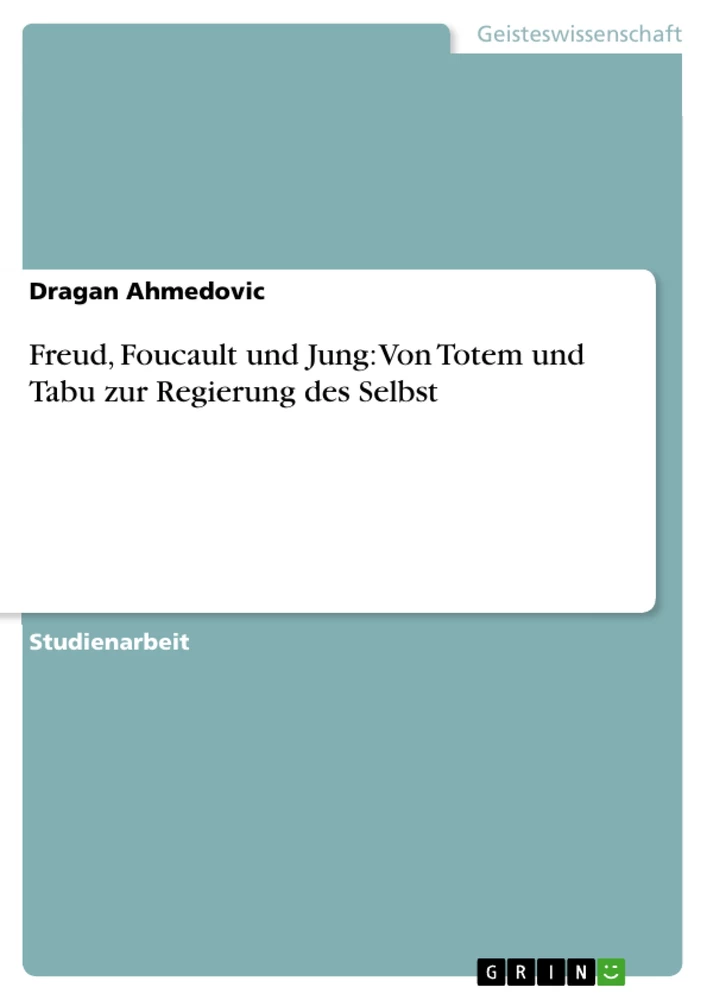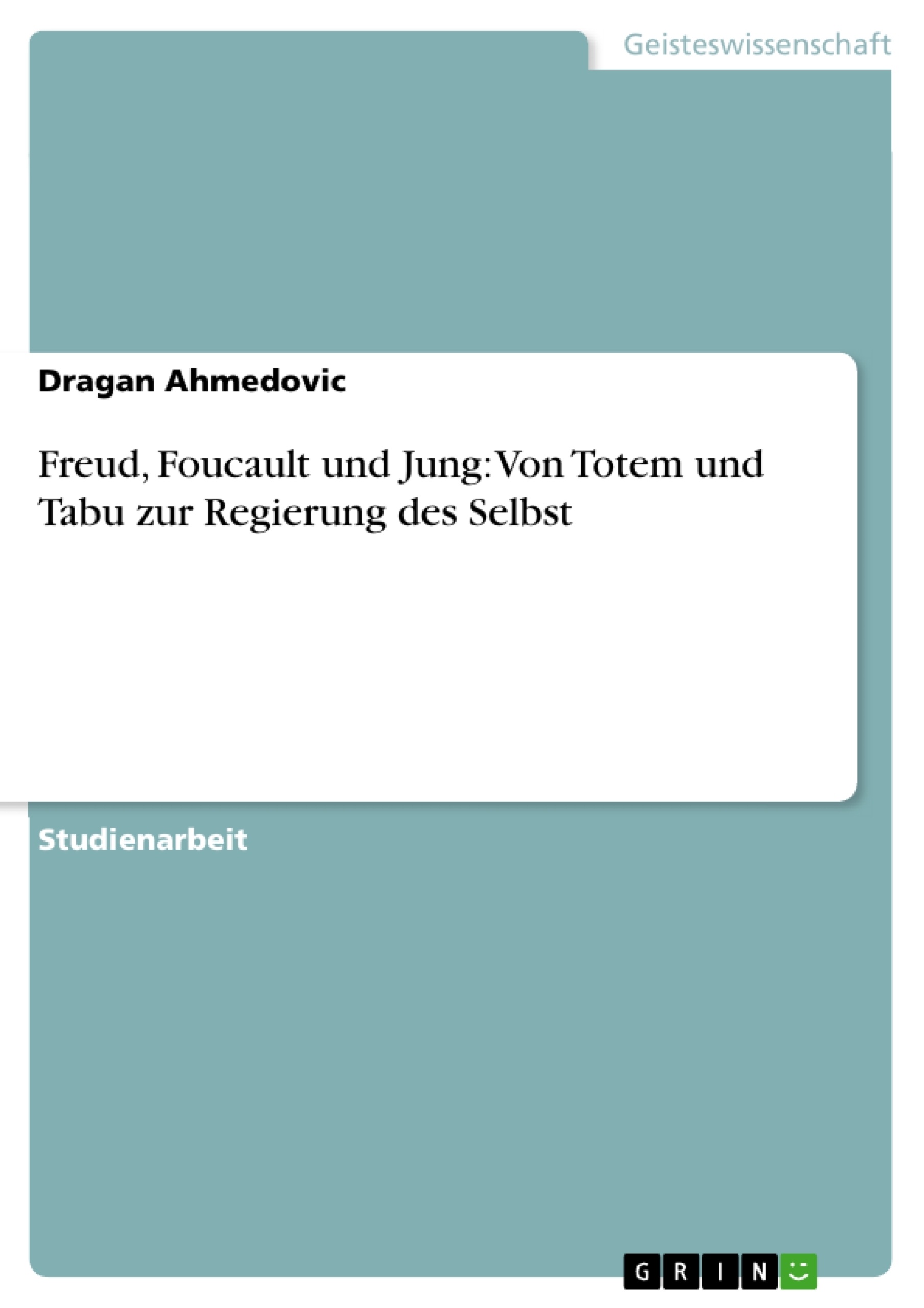EINLEITUNG
Der französische Philosoph, Psychologe und Historiker Michel Foucault gehört zu den meist diskutierten Denkern der Neuzeit. Seine Machttheorien fanden in seinen Werken viele Wendungen, die auch polarisieren: Die Ideale der Aufklärung wie Freiheit, Gleichheit oder Mündigkeit betrachtet Foucault als ein raffiniertes Täuschungsmanöver einer Macht, die sich als ein allumfassendes Netz aus Machtverhältnissen in jeder Form der Sozialität bildet. Dabei entsteht eine „Mikrophysik der Macht“, die dem physikalischen Kapillargesetz ähnlich nicht nur von oben nach unten, sondern auch umgekehrt wirkt. Diese Macht nun äußert sich nach Foucault nicht nur als Repression – sie wirkt auch produktiv. Ein Subjekt, das die Handlungsmacht hat, fehlt aber in diesen Theorien.
Ein zweiter Denker, der auch bis heute stark polarisiert und diskutiert wird, ist Sigmund Freud. Mit der Entdeckung, dass die Ursachen für ein unglückliches und unerfülltes Leben die Verdrängung von traumatischen Erlebnissen und die Unterdrückung von triebhaften Impulsen aus unserem Unbewussten sind, revolutionierte Freud den Blick auf den Mensch, seine Erkenntnis und die sozialen Strukturen. Oberflächlich gesehen scheint es so, dass sich Freud und Foucault mit ihren Erkenntnissen diametral entgegengesetzt befinden. Aber erst der spätere Foucault findet die Grundsätze Freudscher Lehre als ein Teil der Sorge um sich selbst in den philosophischen Schriften der Antike. Diese Abwandlung des Standpunktes Foucaults, von außen nach innen, von den Erkenntnissen, dass nur die äußere Form der Mächte ein Individuum formen, zu der Anerkennung, dass der Mensch auch innerlich zu den Änderungen bemächtigt ist, bedeutet sicherlich nicht die Absage an seine früheren Ideen. Beide Denker zusammen ergeben ein Gemenge, das ich in dieser Arbeit strukturiert skizzieren möchte.
Freud und Foucault folgend kommt man einem dritten Denker näher, der augenscheinlich keine Gemeinsamkeiten mit beiden haben sollte: C. G. Jung. So werde ich neben der Darstellung der Hermeneutik des späteren Foucaultschen Subjekts und des Freudschen Subjekts in dieser Arbeit auch folgende Hypothese analysieren: War Foucault, wenn doch nicht von Freud beeinflusst, am Ende dann ein „Jungianer“? Gibt es zwischen den genannten drei Denkern, trotz eindeutigen Fehlens der Beziehung Foucaults auf Jung und Freud, doch gewissen Parallelen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Totem und Tabu - das Freudsche Subjekt
- 1.1 Das Totem
- 1.2 Exogamie und Inzestverbot
- 1.3 Ödipus - Hypothese
- 1.4 Das Tabu
- 1.5 Das Freudsche Subjekt
- 1.5.1 Das Ich und die (Un)bewusstsein
- 1.5.2 Das Es
- 1.5.3 Das Über-Ich (Ichideal)
- Fazit zu 1
- 2. Das frühere Foucaultsche Subjekt
- 3. Konstituierung des Wahren Subjekts (oder: des Selbst) beim späteren Foucault
- 3.1 Entwicklung der Hermeneutik des Selbst
- 3.1.1 Hellenistische Form - Parrhesia, Physiologia und Paideia
- 3.1.1.1 Parrhesia als Ethik des Selbst
- 3.1.2 Das christliche (asketische) Modell
- 3.1.3 Das Platonische Modell
- Fazit zu 3
- 4. Das Jungsche Subjekt
- 4.1 Individuation als Prozess des Selbst
- 4.2 Das Selbst
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die Konzepte des Subjekts bei Freud, Foucault und Jung in vergleichender Perspektive zu beleuchten. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Ansätze, die diese Denker entwickelten, um die Entstehung und Entwicklung des Selbst zu erklären. Dabei werden insbesondere Freuds Theorie des Totemismus und die evolutionäre Entwicklung des Inzestverbots, Foucaults Hermeneutik des Selbst und Jungs Konzept der Individuation als zentrale Punkte analysiert.
- Das Freudsche Subjekt und die Entstehung des Totemismus
- Die Entwicklung der Hermeneutik des Selbst bei Foucault
- Das Jungsche Selbst und die Rolle der Individuation
- Vergleich der Subjektkonzepte bei Freud, Foucault und Jung
- Die Frage nach möglichen Parallelen zwischen Foucault und Jung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor. Das erste Kapitel befasst sich mit Freuds Theorie des Totemismus in "Totem und Tabu". Es analysiert die Rolle des Totems in der Entstehung gesellschaftlicher Normen und die Bedeutung des Inzestverbots. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Ödipus-Hypothese und ihrer Bedeutung für die Entstehung des Freudschen Subjekts. Das zweite Kapitel behandelt das frühere Foucaultsche Subjekt und dessen Verhältnis zu Macht und Selbst. Das dritte Kapitel befasst sich mit Foucaults späterer Hermeneutik des Selbst und analysiert die Entwicklung des Selbst in der Antike und im Christentum.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Konzepte des Subjekts und des Selbst bei Freud, Foucault und Jung, mit einem besonderen Fokus auf Totemismus, Inzestverbot, Ödipus-Hypothese, Hermeneutik des Selbst, Individuation, Macht, und Vergleichende Analyse.
- Arbeit zitieren
- Dragan Ahmedovic (Autor:in), 2012, Freud, Foucault und Jung: Von Totem und Tabu zur Regierung des Selbst, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201360