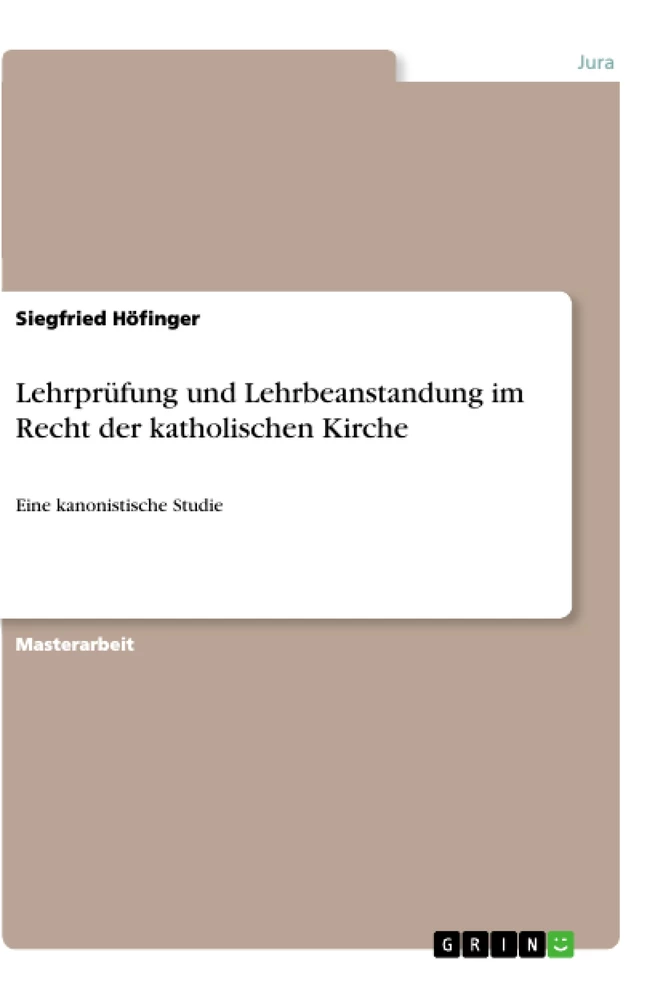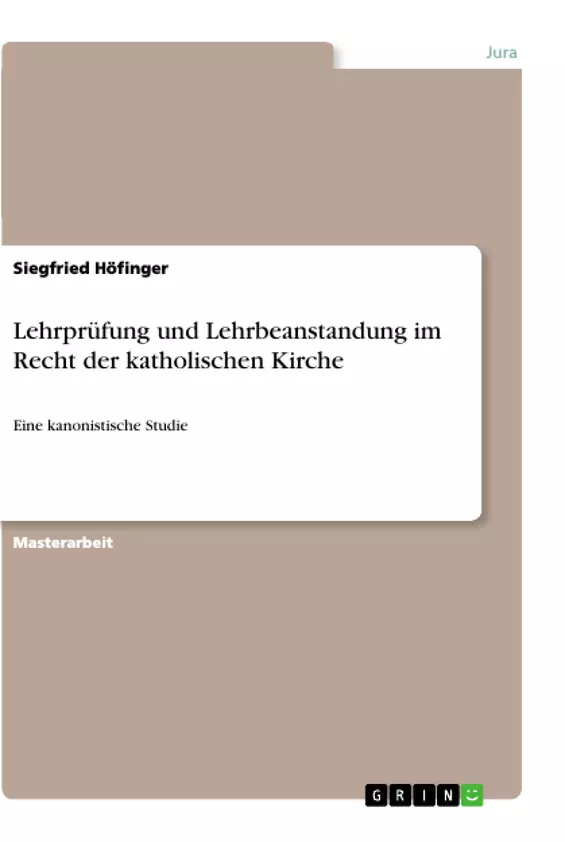Dargestellt wird in der vorliegenden Arbeit das Lehrbeanstandungsverfahren in der katholischen Kirche. Ausgehend von der Frage nach der Legitimität eines derartigen Verfahrens werden im ersten Teil die Forderungen untersucht, die während des Zweiten Vatikanischen Konzils von Konzilsvätern erhoben wurden, auch denen, die den Glauben verkünden und die Glaubenswahrheiten erforschen, größeren rechtlichen Schutz zukommen zu lassen.
Im Mittelteil folgt eine Besprechung der beiden römischen Verfahrensordnungen.
Im letzten Teil der Arbeit werden die in Rom bisher abgeschlossenen Verfahren daraufhin analysiert, ob die betroffenen Theologen den Konflikt aufgrund ihrer Aussagen zur Glaubens- oder zur Sittenlehre heraufbeschworen haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das gesamte Gottesvolk als Träger der Lehrverkündigung und die besondere Zuständigkeit des kirchlichen Lehramts
- Schutz der Glaubens- und Sittenlehre
- Sorge der Hirten der Kirche für die Bücher
- Das geltende Recht der katholischen Kirche hinsichtlich Lehrprüfung und Lehrbeanstandung
- Die beiden römischen Verfahrensordnungen
- Inhaltliche Klassifikation abgeschlossener Verfahren
- John McNeill SJ
- Jacques Pohier OP
- Anthony Kosnik
- Hans Küng
- Charles Curran
- Edward Schillebeeckx OP
- Leonardo Boff OFM
- André Guindon OMI
- Tissa Balasuriya OMI
- Jeannine Gramick SSND und Robert Nugent SDS
- Reinhard Meẞner
- Jacques Dupuis SJ
- Marciano Vidal CSsR
- Roger D. Haight SJ
- Jon Sobrino SJ
- Systematisierung, Analyse und Diskussion der Ergebnisse
- Ertrag der Untersuchung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Master-Thesis untersucht die Rechtsgrundlagen der Lehrbeanstandung in der katholischen Kirche, ausgehend von ihren historischen Voraussetzungen. Sie analysiert die bestehenden Verfahrensordnungen und zeigt mögliche Unzulänglichkeiten auf, um so zur Erhöhung der Rechtssicherheit auf diesem sensiblen Terrain beizutragen.
- Die Rolle des kirchlichen Lehramts und des gesamten Gottesvolks in der Verbreitung der Lehre
- Die Bedeutung des Schutzes der Glaubens- und Sittenlehre
- Die Geschichte und Entwicklung der Lehrbeanstandungsverfahren
- Die Rechtsgrundlagen und -pflichten für Theologen im Bereich der Lehrverkündigung
- Die Problematik der akademischen Freiheit im Kontext der kirchlichen Lehre
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel erläutert den besonderen Status der Theologie als an die Lehre und den Glauben der Kirche gebundene Wissenschaft und stellt die Bedeutung der Lehrbeanstandung für den Schutz der kirchlichen Lehre heraus.
- Das gesamte Gottesvolk als Träger der Lehrverkündigung und die besondere Zuständigkeit des kirchlichen Lehramts: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle des gesamten Gottesvolks und des kirchlichen Lehramts in der Vermittlung der Lehre.
- Schutz der Glaubens- und Sittenlehre: Dieses Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Instrumenten zum Schutz der Glaubens- und Sittenlehre.
- Sorge der Hirten der Kirche für die Bücher: Dieses Kapitel behandelt die Verantwortung der Kirche für die Kontrolle und Zulassung von Büchern.
- Das geltende Recht der katholischen Kirche hinsichtlich Lehrprüfung und Lehrbeanstandung: Dieses Kapitel erläutert die beiden römischen Verfahrensordnungen für die Lehrprüfung und Lehrbeanstandung und untersucht die Inhalte und Ergebnisse ausgewählter Verfahren.
Schlüsselwörter
Lehrprüfung, Lehrbeanstandung, Katholische Kirche, Kanonisches Recht, Kirchenrecht, Lehrverkündigung, Lehramt, Glaubenslehre, Sittenlehre, Theologie, Akademische Freiheit, Dissens, Dogma, Verfahren, Juristische Analyse, Rechtssicherheit
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Lehrbeanstandungsverfahren in der katholischen Kirche?
Es ist ein kirchenrechtliches Verfahren zur Prüfung und gegebenenfalls Verurteilung von theologischen Aussagen, die der offiziellen Glaubens- oder Sittenlehre widersprechen.
Welche Rolle spielte das Zweite Vatikanische Konzil für diese Verfahren?
Während des Konzils forderten Konzilsväter einen besseren rechtlichen Schutz für Theologen und Forscher, um deren akademische Freiheit innerhalb der Kirche zu stärken.
Welche bekannten Theologen waren von solchen Verfahren betroffen?
Die Arbeit analysiert Verfahren gegen Hans Küng, Leonardo Boff, Charles Curran, Edward Schillebeeckx und andere prominente Theologen.
Was ist der Unterschied zwischen Glaubenslehre und Sittenlehre?
Glaubenslehre bezieht sich auf dogmatische Wahrheiten, während Sittenlehre moralische und ethische Fragen des Handelns behandelt. Verfahren können aufgrund von Abweichungen in beiden Bereichen eingeleitet werden.
Wie ist die akademische Freiheit in der katholischen Theologie geregelt?
Theologie gilt als eine an die Kirche gebundene Wissenschaft. Die Arbeit untersucht das Spannungsverhältnis zwischen wissenschaftlicher Forschung und der Bindung an das kirchliche Lehramt.
Was sind die römischen Verfahrensordnungen?
Es handelt sich um die rechtlichen Regelwerke, nach denen die Glaubenskongregation in Rom Lehrprüfungen durchführt und abschließt.
- Arbeit zitieren
- Siegfried Höfinger (Autor:in), 2012, Lehrprüfung und Lehrbeanstandung im Recht der katholischen Kirche, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201364