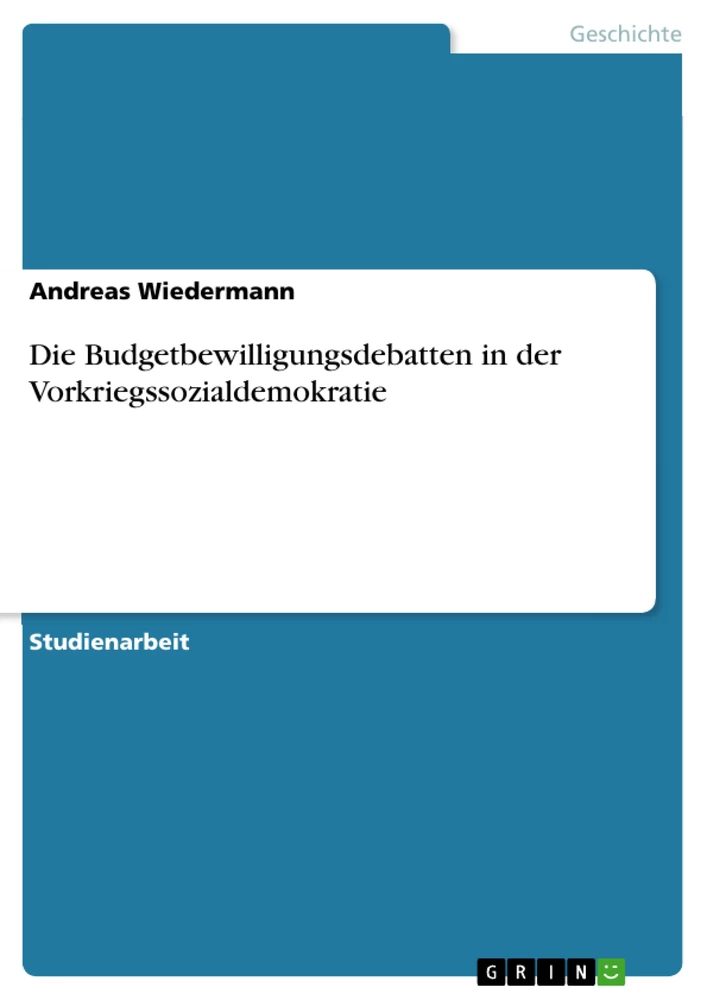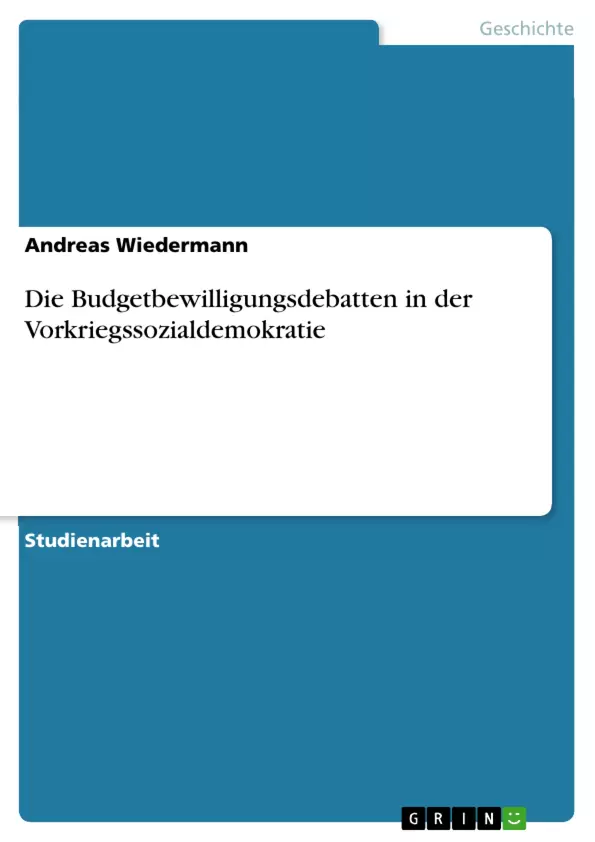Die deutsche Sozialdemokratie errang zwischen 1890 und 1914 Wahlerfolg auf Wahlerfolg und steigerte stetig ihre Mitgliederzahlen. Diese Zuwächse konnte sie allerdings nur selten direkt in politische Erfolge umsetzen, da die Eliten im Kaiserreich sie von der Teilhabe an der Macht fern hielten.
Doch gab es Unterschiede im Reich. Während es in Preußen mit seinem Dreiklassenwahlrecht kaum Möglichkeiten gab, ernsthaften Einfluss über den Landtag auszuüben, war das Potential in den süddeutschen Landtagen erheblich höher. Nach dem Auslaufen der Sozialistengesetze 1890 formierte sich daher vor allem in den süddeutschen Parteigliederungen eine Strömung, die den parlamentarischen Kampf um Reformen aufwerten wollte, um bereits im bestehenden System Verbesserungen durchzusetzen.
Bis zum Ersten Weltkrieg stießen diese Bestrebungen auf erheblichen Widerstand seitens der Mehrheit der Gesamtpartei. Diese Mehrheit lehnte es ab mit den gegnerischen Parteien oder den herrschenden Eliten Kompromisse auszuhandeln. Nicht kleine Reformschritte sollten Zweck der Partei sein, sondern die Vorbereitung der Massen auf den großen Zusammenbruch des Klassenstaates, auf den „großen Kladderadatsch“ wie August Bebel es formulierte.
Diese taktischen Gegensätze führten zu einer Reihe grundsätzlicher Auseinandersetzungen. Kaum ein Streit wurde allerdings so häufig auf Parteitagen geführt wie der um die Budgetabstimmungen in den süddeutschen Landtagen.
Im Folgenden werden die Parteitagsdebatten um die Budgetbewilligungen nachgezeichnet, um an ihnen exemplarisch darzulegen, dass das einende Selbstverständnis der deutschen Sozialdemokratie spätestens ab 1900 zunehmend in Frage gestellt wurde und sich die Partei in einer unlösbaren Krise befand. Dafür werde ich zunächst die Stellung der Sozialdemokratie im deutschen Kaiserreich theoretisch anhand der Krisenkonzeption von Rudolf Vierhaus reflektieren, die er für das 19. Jahrhundert, insbesondere für das deutsche Kaiserreich entwickelt hat. Anschließend werde ich die Debatten auf den Gesamtparteitagen der Sozial-demokratie nachzeichnen, die immer dann erfolgten, wenn in einem süddeutschen Landtag eine sozialdemokratische Fraktion dem Gesamtbudget zustimmte. In der Regel folgten diesen als Skandal empfundenen Budgetbewilligungen auch heftige Debatten in den Parteiorganen. Diese ebenfalls auszuwerten würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Wo das Verständnis es verlangt, wird auf sie Bezug genommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Krise des Kaiserreiches und das sozialdemokratische Selbstverständnis
- Von Frankfurt nach Lübeck – Die Parteitage 1894 und 1901
- Budgetbewilligungen in Baden, Bayern und Württemberg und der Nürnberger Parteitag von 1908
- Badische Budgetbewilligung von 1910 und der Magdeburger Parteitag
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auseinandersetzungen innerhalb der deutschen Sozialdemokratie im frühen 20. Jahrhundert, insbesondere in Bezug auf die Frage der Budgetbewilligungen in den süddeutschen Landtagen. Sie analysiert die innerparteilichen Konflikte und die unterschiedlichen Strömungen, die durch die Frage der Budgetbewilligungen aufgezeigt wurden, und beleuchtet die Bedeutung dieser Debatten für das Selbstverständnis der Sozialdemokratie im wilhelminischen Kaiserreich.
- Die Krise des Kaiserreiches und ihre Auswirkungen auf die Sozialdemokratie
- Die unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Sozialdemokratie: Reformismus vs. Revolution
- Die Bedeutung der Budgetbewilligungen in den süddeutschen Landtagen
- Die innerparteilichen Konflikte und ihre Folgen
- Das Selbstverständnis der Sozialdemokratie im wilhelminischen Kaiserreich
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Problemstellung der Arbeit vor und skizziert die historische Situation der deutschen Sozialdemokratie zwischen 1890 und 1914. Es beleuchtet das Spannungsverhältnis zwischen dem Erfolg der Partei und ihrer ohnmächtigen Position in der politischen Landschaft des Kaiserreiches und führt den zentralen Konflikt zwischen reformistischer und revolutionärer Ausrichtung innerhalb der Sozialdemokratie ein.
- Die Krise des Kaiserreiches und das sozialdemokratische Selbstverständnis: Dieses Kapitel analysiert die Krise des "preußisch-deutschen Regierungssystems" nach der Konzeption von Rudolf Vierhaus und zeigt, wie die Sozialdemokratie zur Organisation und zum Banner für diejenigen wurde, die in der Gesellschaft ausgegrenzt und in einer Identitätskrise gefangen waren. Es wird auch die Bedeutung des revolutionären Marxismus als Parteiideologie und die daraus resultierende systemoppositionelle Grundhaltung der Sozialdemokratie erörtert.
- Von Frankfurt nach Lübeck – Die Parteitage 1894 und 1901: Dieses Kapitel zeichnet die Debatten um die Budgetbewilligungen auf den Parteitagen in Frankfurt (1894) und Lübeck (1901) nach. Es beleuchtet die unterschiedlichen Standpunkte innerhalb der Partei und den Konflikt zwischen den Reformisten, die eine Zustimmung zum Budget befürworteten, und den Radikalen, die diese strikt ablehnten. Das Kapitel analysiert die Rolle von August Bebel als Parteiführer und die Positionen von Rosa Luxemburg.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Sozialdemokratie, Kaiserreich, Budgetbewilligungen, Reformismus, Revolution, Klassenkampf, innerparteiliche Konflikte, Selbstverständnis, Parteitage, politische Institutionen, Identitätskrise.
Häufig gestellte Fragen
Worum ging es in der Budgetbewilligungsdebatte der Vorkriegs-SPD?
Es ging um den Konflikt, ob sozialdemokratische Abgeordnete in den Landtagen den staatlichen Budgets zustimmen dürfen (Reformismus) oder dies aus Prinzip ablehnen müssen (Revolutionismus).
Warum war die Lage in Süddeutschland anders als in Preußen?
In Süddeutschland (Baden, Bayern, Württemberg) gab es liberalere Wahlrechte und mehr parlamentarischen Einfluss, was die süddeutschen Genossen zu Kompromissen motivierte.
Wer waren die Hauptakteure in diesen Debatten?
Die Arbeit nennt unter anderem August Bebel als Parteiführer sowie Rosa Luxemburg als Vertreterin des radikalen Flügels.
Was bedeutete der „große Kladderadatsch“ für August Bebel?
Es war Bebels Begriff für den erwarteten Zusammenbruch des kapitalistischen Systems, auf den die Partei die Massen vorbereiten sollte.
Welche Rolle spielten die Parteitage zwischen 1894 und 1910?
Sie dienten als Bühne für heftige Grundsatzstreits, bei denen die Mehrheit der Partei meist die Budgetbewilligungen als Skandal ablehnte.
- Quote paper
- Andreas Wiedermann (Author), 2012, Die Budgetbewilligungsdebatten in der Vorkriegssozialdemokratie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201486