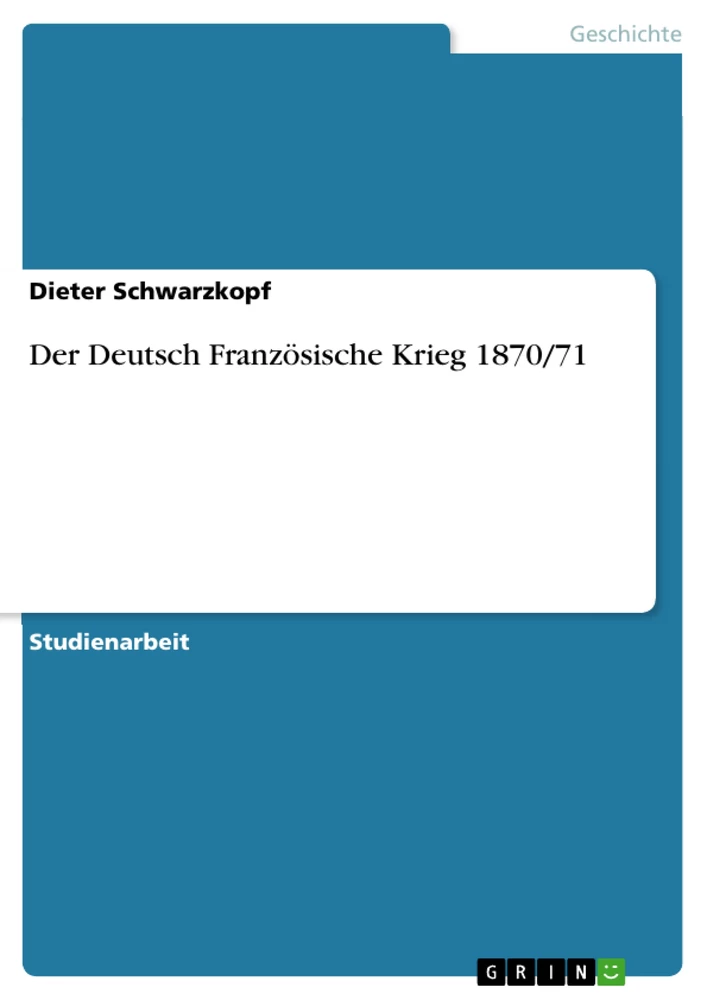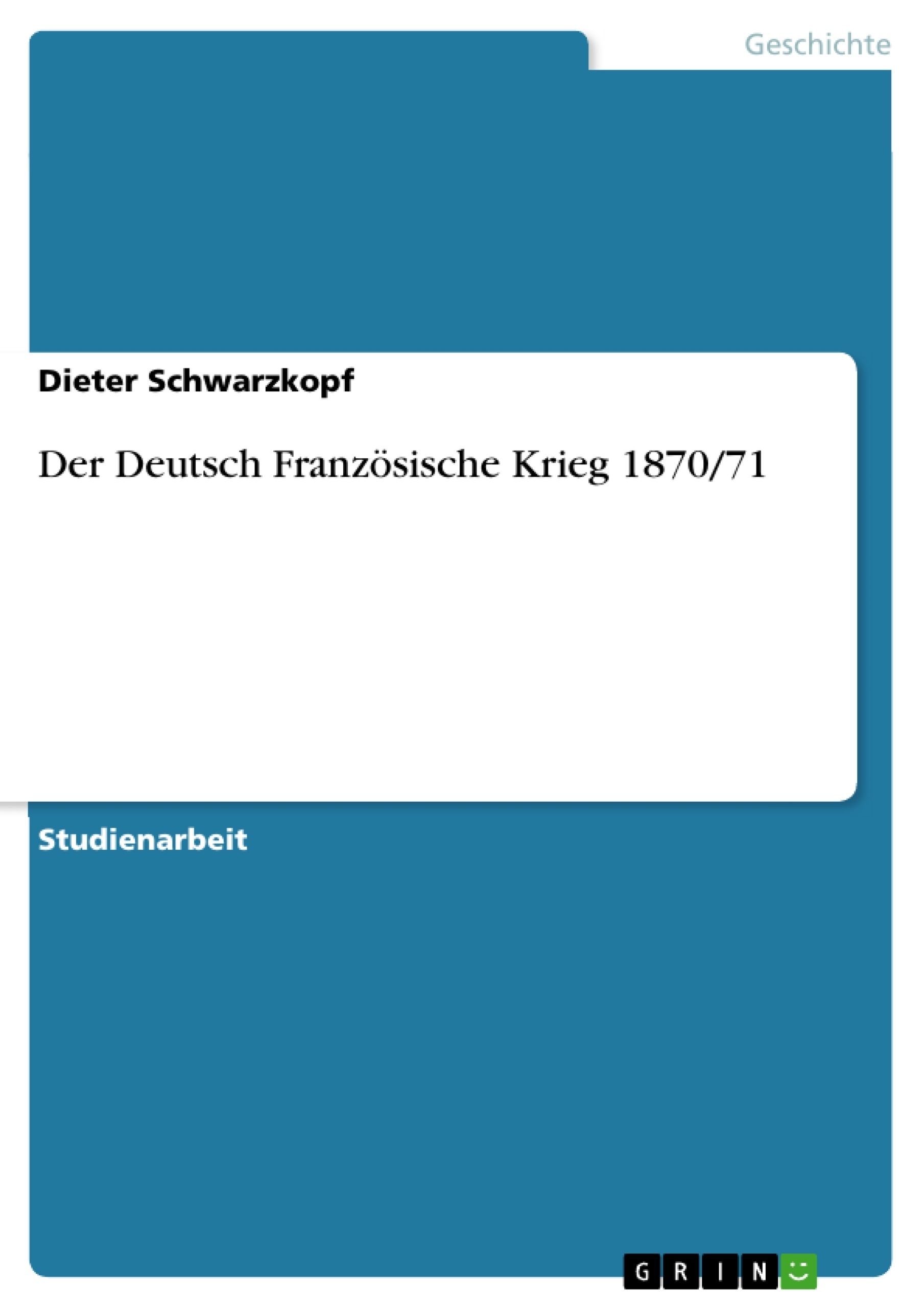Der deutsch-französische Krieg von 1870/71 stellt in der deutschen Historie ein einschneidendes Ereignis dar, das sowohl auf kurze wie auch auf lange Sicht weitreichende Folgen, für Deutschland und Europa, hatte. Denn durch den Krieg wurden die kontinentalen Verhältnisse neu geordnet. Der britische Staatsmann Benjamin Disraeli äußerte sich zu diesem Umstand, indem er am 9. Februar 1871 im Unterhaus erklärte:
„Dieser Krieg bedeutet die deutsche Revolution, ein größeres politisches Ereignis als die französische Revolution des vergangenen Jahrhunderts. Das Gleichgewicht der Macht ist völlig zerstört.“
Zu den neu eingetretenen Verhältnissen zählten vor allem, neben der Ablösung Frankreichs als führende Nation, die Gründung des Deutschen Reiches, das Ende des Kaisertums in Frankreich und die Ausrufung der dritten Republik. Es entstand aber auch ein tiefer Bruch zwischen Deutschland und Frankreich, der erst in den vergangenen Jahrzehnten aus den Erinnerungen der beiden Völker zunehmend verblasste. Geprägt wurde diese nationale Rivalität oftmals durch die Gebietszugehörigkeit Elsass-Lothringens, das nach dem Krieg an Deutschland überging und für lange Zeit ein Konfliktauslöser in Europa bleiben sollte. Die neu gewonnene Führungsrolle in Europa und das damit verbundene Machtgefühl Deutschlands, welches aus dem Sieg über Frankreich resultierte, hat auch einen wesentlichen Beitrag für den Auslöser der beiden folgenden Weltkriege beigetragen. Die Fehleinschätzung der eigenen Stärke veranlasste Deutschland, sowohl im 1. Weltkrieg als auch im 2. Weltkrieg einen Krieg gegen alle europäischen Großmächte zu führen. Die Ausbrüche der beiden Weltkriege und die Folgen wurden somit immer auch durch die Folgen des deutsch-französischen Krieges geprägt. Die durch den Sieg über Frankreich errungene Macht und Stärke des deutschen Kaiserreiches wurde in den folgenden Jahrzehnten stets überschätzt und kann im Nachhinein auch als Größenwahn Deutschlands bezeichnet werden. Obwohl die Folgen des deutsch-französischen Krieges weitreichender waren als die vieler anderer Kriege des 19. und 20. Jahrhunderts, ist die Erinnerung an diesen Krieg in den Hintergrund gerückt. Die beiden Weltkriege und die Auseinandersetzungen des Kalten Krieges ließen die Erinnerungen an den deutsch-französischen Krieg gänzlich verblassen. Im Vorfeld des 1. Weltkrieges nahm der und machtpolitischen Interesse Frankreichs und anderer Länder.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Die Ursachen des deutsch-französischen Krieges
- 1.1 Analyse der Ursachen aus französischer Sicht
- 1.2 Analyse der Ursachen aus deutscher Sicht
- 1.3 Die Thronkandidatur der Hohenzollern-Sigmaringen in Spanien und die Julikrise von 1870
- 1.4 Kriegsschuldfrage und die absehbaren Vorzeichen eines neuen Krieges
- 2. Betrachtung des Kriegsverlaufes unter besonderer Berücksichtigung von modernen Kriegserscheinungen
- 2.1 Der Kampf gegen das Kaiserreich (4. August 1870 - 4. September 1870)
- 2.2 Der Kampf gegen die Republik bis zur Kapitulation am 28. Januar 1871
- 3. Die Auswirkungen des Krieges auf die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft
- 3.1 Propagandistische Medieneinsätze im beginnenden Zeitalter des modernen Krieges (1870/71)
- 4. Die Folgen des Deutsch-Französischen Krieges
- 1. Die Ursachen des deutsch-französischen Krieges
- III. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 und dessen weitreichenden Folgen für Deutschland, Frankreich und Europa. Sie untersucht die Ursachen des Krieges, analysiert den Kriegsverlauf unter besonderer Berücksichtigung der modernen Kriegserscheinungen, betrachtet die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Propaganda des Krieges und analysiert schließlich die Folgen des Krieges, insbesondere die Reichsgründung und die Annexion Elsass-Lothringens.
- Ursachen und Auslöser des Deutsch-Französischen Krieges
- Der Krieg als Ausdruck der modernen Kriegsführung
- Die Auswirkungen des Krieges auf die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft
- Die Bedeutung der Propaganda im Krieg
- Die Folgen des Krieges für Deutschland, Frankreich und Europa
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einordnung des Deutsch-Französischen Krieges in den historischen Kontext und analysiert die Ursachen des Krieges. Sie untersucht dabei die jeweiligen Perspektiven Frankreichs und Deutschlands, insbesondere die Rolle der spanischen Thronkandidatur der Hohenzollern-Sigmaringen und die Julikrise von 1870. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Kriegsverlauf unter besonderer Berücksichtigung moderner Kriegserscheinungen und beleuchtet die Veränderungen in der Waffentechnik, der Kriegsführung und der Kriegslogistik. Es untersucht auch die Auswirkungen des Krieges auf die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft, insbesondere den Einfluss der Industrialisierung und der Propaganda. Im letzten Kapitel werden die Folgen des Krieges für Deutschland, Frankreich und Europa betrachtet, mit besonderem Augenmerk auf die Reichsgründung und die Annexion Elsass-Lothringens.
Schlüsselwörter
Deutsch-Französischer Krieg 1870/71, Reichsgründung, Elsass-Lothringen, Moderne Kriegsführung, Industrialisierung, Propaganda, Kriegsschuldfrage, Thronkandidatur, Julikrise, Waffentechnik, Taktik, Wirtschaft, Gesellschaft, Nationalismus, Europa, Frankreich, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zum Deutsch-Französischen Krieg 1870/71
Was war die Ursache für den Deutsch-Französischen Krieg?
Ein wesentlicher Auslöser war der Streit um die Thronkandidatur der Hohenzollern in Spanien und die daraus resultierende Julikrise von 1870.
Welche Folgen hatte der Sieg für Deutschland?
Der Sieg führte zur Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871 und zur Annexion von Elsass-Lothringen.
Warum wird der Krieg als "modern" bezeichnet?
Aufgrund des Einsatzes moderner Waffentechnik, der Eisenbahnlogistik, der industriellen Mobilisierung und der massiven Nutzung von Propaganda.
Wie veränderte der Krieg das Machtgleichgewicht in Europa?
Frankreich verlor seine Vormachtstellung auf dem Kontinent, während das neu gegründete Deutsche Reich zur führenden Militär- und Wirtschaftsmacht aufstieg.
Welche Rolle spielte die Propaganda in diesem Krieg?
Medieneinsätze wurden gezielt genutzt, um nationale Begeisterung zu wecken und das Bild des Gegners in der Öffentlichkeit zu manipulieren.
- Arbeit zitieren
- Dieter Schwarzkopf (Autor:in), 2011, Der Deutsch Französische Krieg 1870/71, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201494