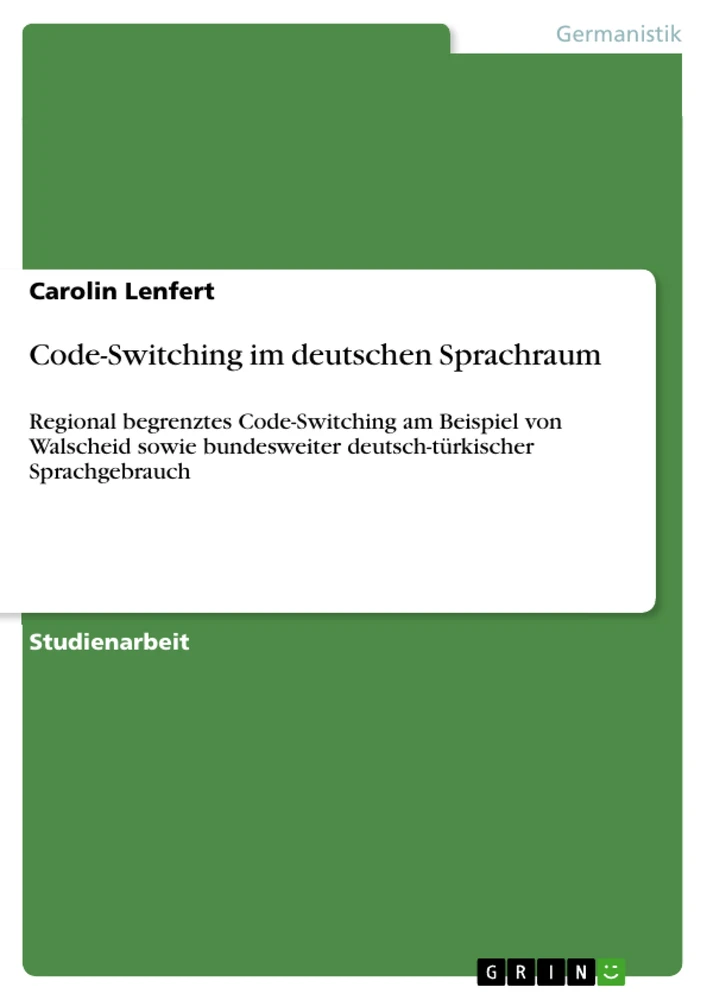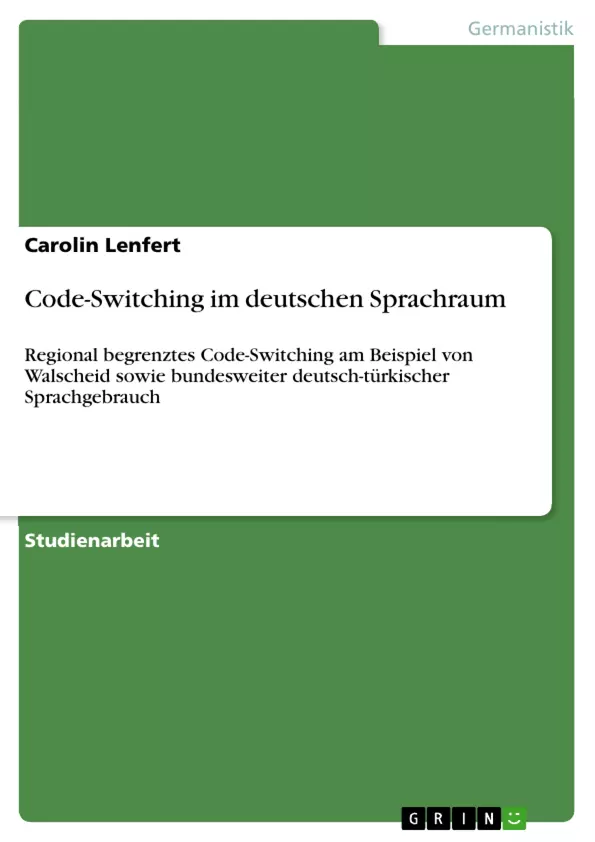Sprachkontakt ist keine neue Besonderheit unserer Zeit, wohl aber ein Aspekt der deutschen “multi-kulti“ Gesellschaft, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Schätzungsweise wächst die Hälfte aller Menschen auf der Welt zweisprachig auf. Spätestens seit der Migration von Gastarbeitern sollte sich auch Deutschland mit der Erscheinung der Bilingualität beschäftigen. Code-Switching stellt dabei ein besonderes Sprachkontaktphänomen dar. In der vorliegenden Arbeit soll die Verwendung des Code-Switching im deutschen Sprachraum untersucht werden. Neben der Analyse der Syntax und der Struktur des Sprachwechsels, stehen auch Art, Motive und Funktion im Vordergrund. Dabei ist eine Definition und Abgrenzung des Begriffs Code-Switching vorweg unabdingbar, da leider kein Konsens in der Forschung besteht. Ich habe mich hier auf die Ausführungen von Banaz und Biegel beschränkt, da sich die Argumentation beider überwiegend deckt und in sich schlüssig wirkt. Desweiteren wurden bestehende Definitionen und Aspekte der Forschung bereits einbezogen. Um auch die soziolinguistische Perspektive nicht außer Acht zu lassen, gehe ich im dritten Kapitel auf situationsabhängiges, sowie situationsunabhängiges Code-Switching ein. Im vierten und wichtigsten Kapitel dieser Arbeit soll die konkrete Verwendung von Sprachwechsel im deutschen Sprachraum thematisiert werden. Auch hier habe ich die Untersuchung auf die zwei Fallstudien von Banaz und Biegel begrenzt, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, aber einen guten Einblick in die Thematik geben. An Beispielen, die primär auf grammatischer Ebene untersucht werden sollen, kann der Sprachgebrauch verdeutlicht werden. Ich habe mich ganz bewusst für die Formulierung „Das Sprachkontaktphänomen Code-Switching im deutschen Sprachraum“ entschieden, da die Fallstudie Biegels die Region Lothringen (heute Frankreich) behandelt, jedoch primär auf den dortigen Dialekt eingeht, der dem Deutschen sehr ähnelt.
Am Schluss meiner Betrachtung fasse ich die gemachten Beobachtungen zusammen.
Letztlich möchte ich in diesem Zusammenhang noch auf die Verwendung der Begriffe Code-Switching und Sprachwechsel hinweisen. In der vorliegenden Arbeit werden beide Begriffe synonym verwendet. Code-Mixing ist dagegen ein anderes Sprachkontaktphänomen und wird in 2.3 ausführlich definiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition Code-Switching
- 2.1. Die Problematik der klaren Definition des Begriffes
- 2.2. Code-Switching im Blickpunkt der linguistischen Forschung
- 2.3. Abgrenzung zu anderen Sprachkontaktphänomenen
- 2.3.1. Pidgin
- 2.3.2. Entlehnung
- 2.3.3. Code-Mixing
- 2.3.4. Interferenz
- 3. Soziolinguistische Betrachtung
- 3.1. Situationsabhängiges Code-Switching
- 3.2. Situationsunabhängiges Code-Switching
- 4. Code-Switching im deutschen Sprachgebrauch
- 4.1. Mehrsprachigkeit der Bevölkerung
- 4.1.1. Geschichtlicher Exkurs und die heutige Situation
- 4.1.2. Vorstellen der Fallstudien
- 4.2. Beispiele
- 4.2.1. Regional begrenztes Code-Switching: Walscheid
- 4.2.2. Bundesweiter deutsch-türkischer Sprachgebrauch
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Code-Switching im deutschen Sprachraum. Sie untersucht die Verwendung des Code-Switching in der Syntax und Struktur des Sprachwechsels, analysiert die Art, Motive und Funktion des Sprachwechsels und grenzt den Begriff Code-Switching von anderen Sprachkontaktphänomenen ab.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Code-Switching
- Code-Switching in der linguistischen Forschung
- Soziolinguistische Betrachtung von Code-Switching
- Code-Switching im deutschen Sprachgebrauch: Fallstudien
- Analyse von Code-Switching auf grammatischer Ebene
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik des Code-Switching ein und beleuchtet die Bedeutung des Sprachkontaktphänomens im Kontext der deutschen "multi-kulti" Gesellschaft. Kapitel 2 definiert den Begriff Code-Switching und geht auf die Problematik einer eindeutigen Definition ein. Es stellt verschiedene Ansätze zur Unterscheidung von Code-Switching-Typen vor und grenzt den Begriff von anderen Sprachkontaktphänomenen ab. Kapitel 3 behandelt die soziolinguistische Betrachtung von Code-Switching, wobei zwischen situationsabhängigem und situationsunabhängigem Code-Switching unterschieden wird. Kapitel 4 untersucht konkrete Beispiele für Code-Switching im deutschen Sprachraum. Die Fallstudien von Banaz und Biegel zeigen die regionalen und bundesweiten Verwendungsmuster des Code-Switching auf.
Schlüsselwörter
Code-Switching, Sprachkontakt, Sprachwechsel, Bilingualität, Mehrsprachigkeit, Soziolinguistik, Syntax, Struktur, Motive, Funktion, Sprachgemeinschaft, Fallstudien, Deutsch-Türkisch, Sprachgebrauch, Regional, Bundesweit, grammatischer Ebene.
- Arbeit zitieren
- Carolin Lenfert (Autor:in), 2011, Code-Switching im deutschen Sprachraum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201505