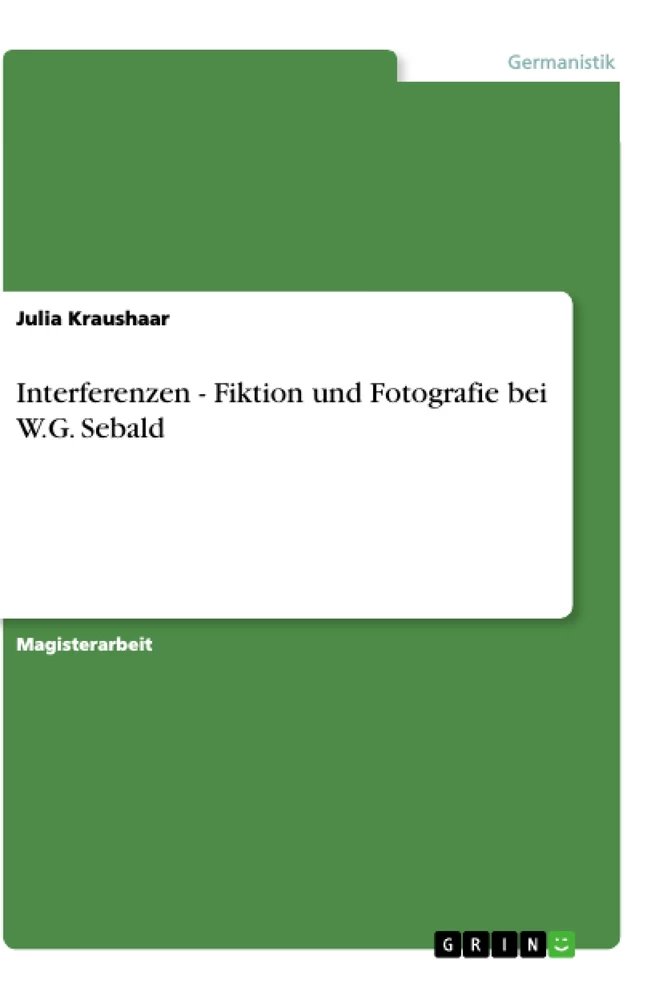Sebalds Prosa changiert zwischen Fakt und Fiktion ebenso wie zwischen fotografischem Erzählen und akribischer Geschichtsschreibung. Der Autor schafft es in seiner Rekonstruktion von Vergangenheit, der im 20. Jahrhundert mehr und mehr in Zweifel gezogenen Fotografie eine neue Relevanz als Medium der Erinnerung im literarischen Text zuzuweisen. Die Fiktion als Gedächtnisort erweist sich bei diesem Projekt als die der Zerbrechlichkeit des Individuums Raum gebende Form eines Erzählens, das sich auch als eine Kontemplation der Menschheitsgeschichte der Zerstörung und als ein Festhalten an der Hoffnung auf Einsicht und Umkehr versteht.
Diese Arbeit untersucht die fotografischen Abbildungen in ihrem Verhältnis zum Erzähltext in den drei Prosawerken Schwindel. Gefühle., Die Ausgewanderten und Austerlitz. Der Idee liegt die Tatsache zu Grunde, dass von ihnen eine Verweiskraft und Konstituierung im Gesamtwerk ausgeht, die in den Betrachtungen von Einzelwerken in der Forschung oft nur marginal zur Sprache kommt. Die vielfältigen Verbindungswege zwischen dem Erzähltext der drei Prosawerke, der zwischen dokumentarisch und fiktional schwankt, und der Fotografie zwischen banaler Tautologie und intertextuellem Verwirrspiel gaben den Anstoß zu dieser werkübergreifenden Untersuchung.
Sebalds Prosawerke werden dem neuen Genre „Foto-Text“ bzw. „Ikonotext“ zugeordnet, demnach tragen zwei unterschiedliche Medien zur Fiktionalität des Gesamtwerks bei.
Im ersten Abschnitt werden fiktionale und fiktive Erzählstrategien auf der textlichen Ebene untersucht. Nach einem kurzen Abriss über den Gegenstand Foto-Text und bisherige Forschungstexte zum Foto bei Sebald werden verschiedene Aspekte beleuchtet, die sowohl die Fotografie als Medium als auch das Foto in Sebalds Text betreffen.
Die Fotografie scheint dem Streben des Sebaldschen Textes nach Authentizität zunächst Nachdruck zu verleihen. In ihrer neuen, zusätzlichen Eigenschaft als Textbegleiter aber erhalten und verlieren die Fotos neue Dimensionen der Unschuld bzw. des Beteiligtseins.
In Bezug auf die Fiktionalisierung des Ikonotextes erlangt das eingebettete Foto aufgrund der Eigenschaft, einen unwiederbringlichen Augenblick im historischen Zeitgefüge festzuhalten, eine besondere Stellung, die sich im Text niederschlägt und an vielen Stellen ihre textliche Entsprechung findet. Einen weiteren Schwerpunkt in der Betrachtung von Sebalds Fotografien bildet die Seite der Rezeption.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aspekte des Erzählens bei W.G. Sebald
- Fiktionale Strategien des Erzählens
- Erzähler und Autor: Die Erfindung des Ich
- Biografien weiterschreiben. Das Dokument und das reflexive Hineinversetzen
- Der zweite Erzähler: Zeugenschaft als erzählerisches Mittel in Die Ausgewanderten
- Fotografisches Erzählen
- Fiktive Strategien des Erzählens
- Reise und Exil bei Sebald
- Sebalds Reisen – Ortswechsel als Grundvoraussetzung der Fiktion
- Ambros Adelwarth: Die Ausreise des Onkel Kasimir
- Fühlen, Denken, Verzweifeln: Erinnern und Erinnerungslosigkeit in All'estero
- Austerlitz' Schreibkrise und die Gedächtnislosigkeit der Fotografie
- Die Fotografien in Sebalds Werk
- Verweise zur Theorie von Text und Bild sowie Ikonotexten
- Theoretische Vorbetrachtungen zur Fotografie
- Der besondere Realitätsbezug der Fotografie
- Fotos als Vergangenheitsbilder
- Sebalds Fotos: Die vermittelte Verwendung eines (scheinbar) distanzlosen Mediums
- Formelle Aspekte zu Sebalds Bildern
- Der Autor und die Fotos
- Der Erzähler und die Fotos
- Zur Verbindung von Foto und Text bei W.G. Sebald
- Rezeption der Ikonotexte
- Funktionen von Foto-Text-Relationen
- Fotos vom Erzähler
- Erzählerfoto in Die Ringe des Saturn: Die absolute Vergangenheit
- Erzählerfoto in Die Ausgewanderten: Der Fotograf im Text
- Erzählerfoto in Schwindel. Gefühle.: Ein Zuzwinkern
- Betrachtungen einzelner Fotografien
- Fotografien in Austerlitz
- Kuppel des Bahnhofs von Antwerpen / brennender Bahnhof von Luzern: Das Wichtige liegt im Abseits
- Zwei Fotos auf dem Weg zur Vergangenheit: Das Mosaik und das Treppenhaus
- Die Fotos von Věra
- Das Bühnenbild mit zwei Schauspielern
- Der Page der Rosenkönigin
- Der vergessene Fundort der Fotografien
- Balzacs Erzählung Le Colonel Chabert als Prätext
- Fotografien in Henry Selwyn
- Der Tennisplatz
- Der Küchengarten
- Gemeinsamkeiten der Fotos
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der Rolle von Fotografien in den Prosawerken von W.G. Sebald, insbesondere in "Schwindel. Gefühle.", "Die Ausgewanderten" und "Austerlitz". Die Arbeit untersucht, wie die Fotografien mit den Erzähltexten interagieren und welche Bedeutung ihnen im Gesamtwerk zukommt. Sie analysiert die Verbindungswege zwischen dem dokumentarischen und fiktionalen Charakter der Texte sowie die Bedeutung der Fotografien als Mittel der Erinnerungskultur.
- Die Interaktion von Fotografie und Erzähltext in den Werken von W.G. Sebald
- Die Bedeutung der Fotografie als Medium der Erinnerungskultur
- Die Analyse der fiktionalen und dokumentarischen Elemente in den Texten
- Die Rolle der Fotografien als Vermittler von Vergangenheit und Gegenwart
- Die Auswirkungen der Fotografie auf die Rezeption der Texte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Untersuchung und die Relevanz von Sebalds Werk für die Erinnerungskultur beleuchtet. Im ersten Kapitel werden die fiktionalen Strategien des Erzählens in Sebalds Werken untersucht, wobei der Fokus auf dem Erzähler und seiner Beziehung zum Autor liegt. Das zweite Kapitel befasst sich mit den fiktiven Strategien des Erzählens und den Themen Reise, Exil und Erinnerung in Sebalds Werken. Im dritten Kapitel werden die Fotografien in Sebalds Werk näher betrachtet, wobei theoretische Ansätze zur Fotografie und ihre besondere Bedeutung für die Vermittlung von Vergangenheit beleuchtet werden. Das vierte Kapitel analysiert die Funktionen von Foto-Text-Relationen in den Werken und untersucht die Rolle des Erzählers und der Fotos in der Vermittlung der Geschichte. Abschließend werden einige ausgewählte Fotografien aus "Austerlitz" und "Henry Selwyn" in ihrer Bedeutung für den Gesamtzusammenhang der Werke analysiert.
Schlüsselwörter
W.G. Sebald, Fotografie, Erinnerungskultur, Ikonotext, Foto-Text, Fiktion, Dokument, Erzählstrategie, Vergangenheit, Gegenwart, Erinnerung, Zeugenschaft, Ausgewanderten, Austerlitz, Schwindel. Gefühle., Henry Selwyn, Die Ringe des Saturn.
- Citar trabajo
- Julia Kraushaar (Autor), 2011, Interferenzen - Fiktion und Fotografie bei W.G. Sebald, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201594