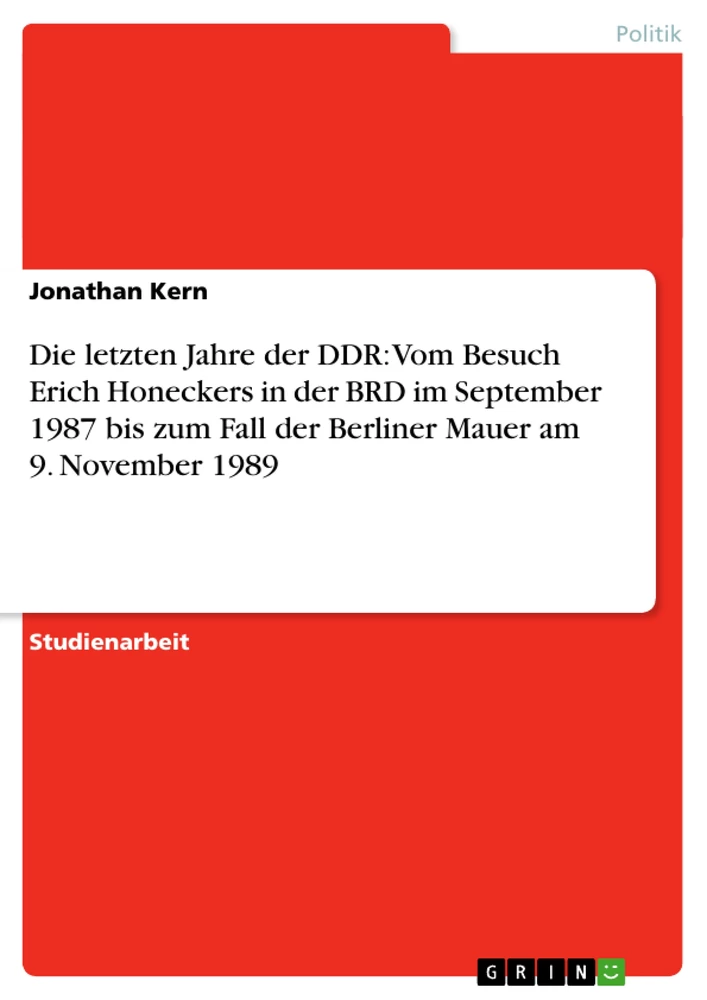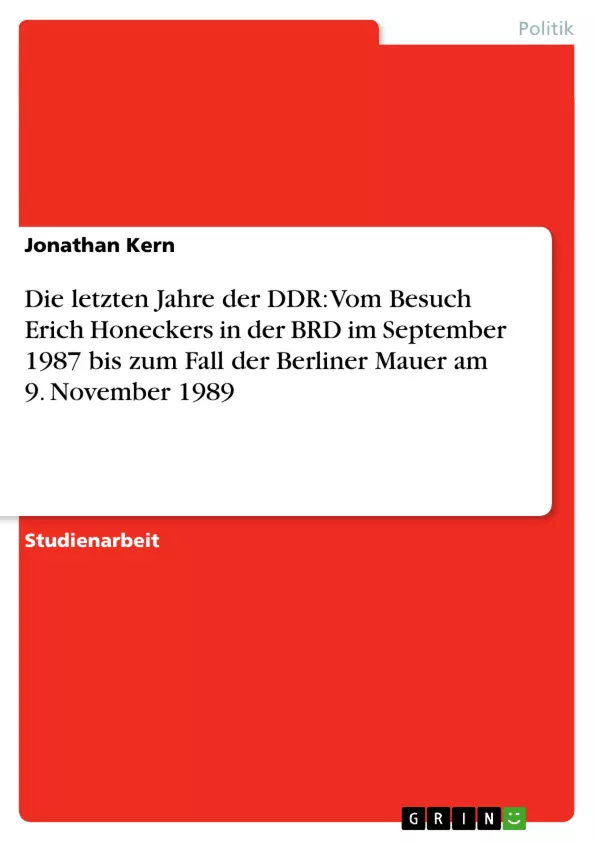In meiner Hausarbeit zum Thema Die letzten Jahre der DDR – 1985 - 1990 möchte ich im Besonderen auf die letzten 2 Jahre der Deutschen Demokratischen Republik, von 1987 - 1989 eingehen. Beginnend beim Besuch des vorletzten Generalsekretärs der SED, Erich Honecker, in der BRD, werde ich versuchen die Ereignisse in der DDR bis zum Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989, nachzuzeichnen.
Als wichtigen Aspekt für die Entwicklung der DDR, werde ich auf die deutsch-deutschen Beziehungen in dieser Zeit, und im Besonderen auf den Besuch Honeckers in Bonn, eingehen.
Ebenso werde ich die Reaktion und Haltung der SED–Führung auf den Reformkurs des damaligen sowjetischen KPdSU-Generalsekretärs Michail Gorbatschows zu beleuchten versuchen. Die politische und ideologische Abspaltung von der sowjetischen Linie stellt einen besonders bedeutungsvollen Faktor in der Entwicklung der DDR dar.
Im weiteren Verlauf möchte ich auf die als Antwort auf die ständige Unterdrückung sich immer stärker entwickelnde Opposition und den Widerstand in der DDR, der sich in Massendemonstrationen äußerte, eingehen. Hierbei werde ich, vor allem auf die größte Protestaktion in der Geschichte der DDR am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz in Ost-Berlin, die Reaktionen darauf und deren Auswirkungen bis zum Fall des „Antifaschistischen Schutzwalls“ am 9. November 1989 eingehen.
Als letzten Teil dieser Arbeit, möchte ich näher beschreiben, wie ein durch Soldaten, das Wachregiment Dziersynski und nicht zuletzt durch das Terrorsystem der Staatssicherheit so stark gesichertes System implodieren konnte.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die deutsch - deutschen Beziehungen
- Der Besuch Honeckers in Bonn
- Beratungen zwischen SPD und SED
- Die Haltung der SED zum Reformkurs Gorbatschows
- Unterdrückung und Widerstand
- Politische Opposition organisiert sich
- Anfänge des Zusammenbruchs der SED-Herrschaft
- Die friedliche Revolution
- Das Ende der „Ära Honecker”
- Die Massendemonstration auf dem Alexanderplatz
- Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die letzten beiden Jahre der DDR (1987 - 1989) und konzentriert sich auf die Ereignisse, die zur Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 führten. Die Arbeit beleuchtet wichtige Aspekte der DDR-Geschichte, wie die deutsch-deutschen Beziehungen, die Reaktion der SED-Führung auf den Reformkurs von Gorbatschow und die Entwicklung von Opposition und Widerstand in der DDR.
- Die deutsch-deutschen Beziehungen im Vorfeld des Mauerfalls
- Die Reaktion der SED auf die Reformen in der Sowjetunion
- Opposition und Widerstand in der DDR
- Die Proteste auf dem Alexanderplatz im November 1989
- Der Fall der Berliner Mauer als Höhepunkt der friedlichen Revolution
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort bietet einen Überblick über die Thematik und die Struktur der Hausarbeit. Kapitel 2 befasst sich mit den deutsch-deutschen Beziehungen, wobei der Fokus auf dem Besuch von Erich Honecker in Bonn liegt. Die Reaktion der SED auf den Reformkurs von Gorbatschow wird in Kapitel 3 beleuchtet. In Kapitel 4 und 5 wird auf die Unterdrückung und den Widerstand in der DDR eingegangen, sowie auf die Organisation der politischen Opposition. Die Kapitel 6-10 beschreiben den Zusammenbruch der SED-Herrschaft, die friedliche Revolution, das Ende der „Ära Honecker“, die Massendemonstration auf dem Alexanderplatz und schließlich den Fall der Berliner Mauer.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit der DDR-Geschichte, dem Mauerfall, den deutsch-deutschen Beziehungen, der SED, Erich Honecker, dem Reformkurs Gorbatschows, Unterdrückung und Widerstand, der politischen Opposition und der friedlichen Revolution.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hatte Honeckers Besuch in der BRD 1987?
Es war der erste offizielle Staatsbesuch eines DDR-Staatschefs in Bonn und markierte einen Höhepunkt der deutsch-deutschen Beziehungen, täuschte aber über die inneren Krisen der DDR hinweg.
Wie reagierte die SED-Führung auf Gorbatschows Reformen?
Die SED-Führung lehnte den Kurs von Glasnost und Perestroika ab und versuchte, sich politisch und ideologisch von der sowjetischen Linie abzuspalten.
Was war die größte Protestaktion in der Geschichte der DDR?
Die Massendemonstration auf dem Berliner Alexanderplatz am 4. November 1989 mit Hunderttausenden Teilnehmern gilt als zentrales Ereignis der friedlichen Revolution.
Warum brach das System der Staatssicherheit am Ende zusammen?
Trotz massiver Überwachung konnte das System dem Druck der Massendemonstrationen, der wirtschaftlichen Instabilität und dem Wegfall der sowjetischen Rückendeckung nicht mehr standhalten.
Wann genau fiel die Berliner Mauer?
Die Berliner Mauer fiel am Abend des 9. November 1989 infolge einer missverständlichen Pressekonferenz und dem darauffolgenden Ansturm der Bürger auf die Grenzübergänge.
- Citation du texte
- Jonathan Kern (Auteur), 2001, Die letzten Jahre der DDR: Vom Besuch Erich Honeckers in der BRD im September 1987 bis zum Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20164