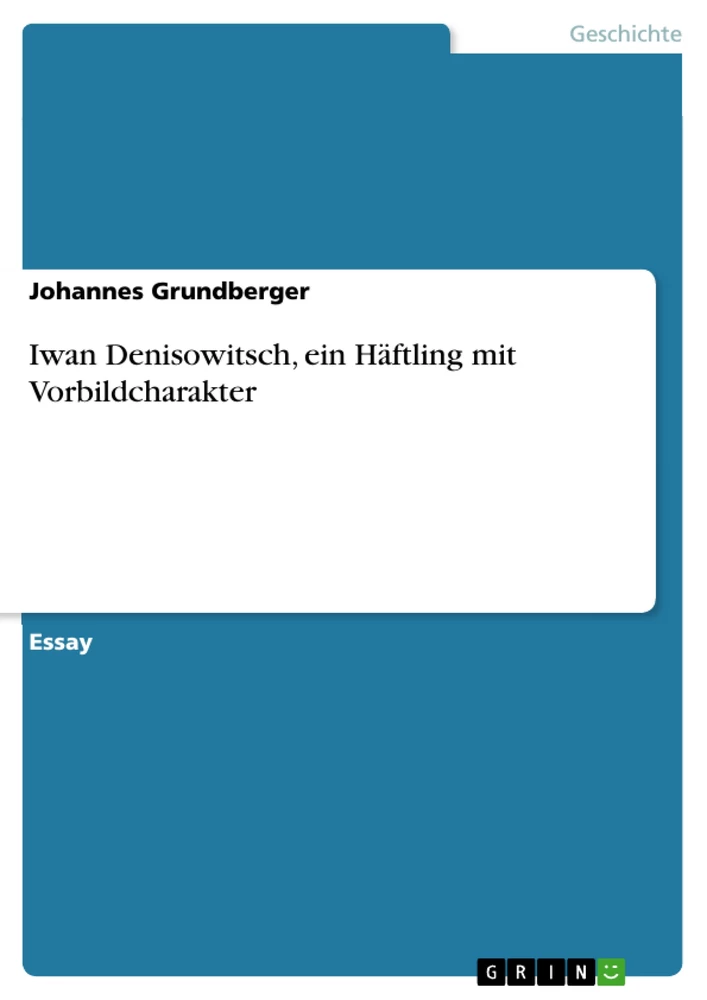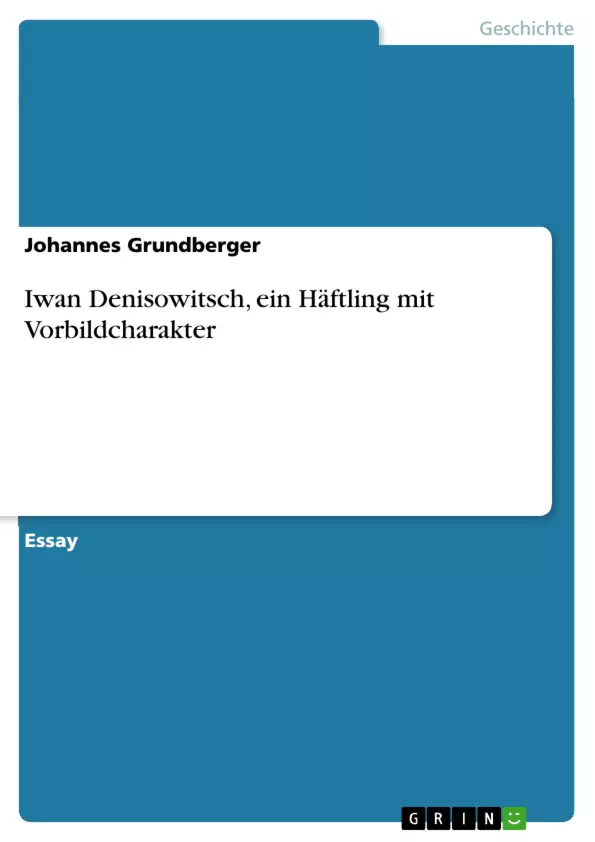„Da die Rolle der Religion auf der ganzen Welt abnimmt, ruht auf dem Schriftsteller eine ganz besondere Verpflichtung. Er hat einen verwaisten Platz einzunehmen“. Sein künstlerisches Talent ermögliche dem Autor einen besonderen Blick auf die Welt. So sei er im Stande, gewisse soziale Erscheinungen früher und von einer unerwarteten Seite aus zu erkennen. Daraus erwachse die Verpflichtung des Literaten für die Gesellschaft und das Individuum. Diese Ausführungen Alexander Solschenizyns bestätigen sein Verständnis vom Schriftsteller als moralischer Instanz. Nicht zuletzt dadurch stellt er sich in die Tradition des russischen Realismus. Dessen Vertreter, wie etwa Tolstoi oder Dostojewski, sahen ihren Auftrag in der zielgerichteten literarischen Erfassung der sozialen und politischen Situation ihrer Zeitgenossen und der daraus resultierenden Leiden. Zur dominierenden Gattung jener Epoche entwickelte sich der Roman, dessen frei wählbare Figurenkonstellation flexible Erzählperspektiven und einen konkreten Bezug zur Realität zuließ. Ideologische Kontroversen und gesellschaftliche Probleme konnten überzeugender dargestellt werden. Zudem ermöglichte der „neue Erzählstil“ eine wirkungsvolle Einflussnahme in moralischer Hinsicht.
Iwan Denissowitsch, ein Häftling mit Vorbildcharakter
„Da die Rolle der Religion auf der ganzen Welt abnimmt, ruht auf dem Schriftsteller eine ganz besondere Verpflichtung. Er hat einen verwaisten Platz einzunehmen“.[1] Sein künstlerisches Talent ermögliche dem Autor einen besonderen Blick auf die Welt. So sei er im Stande, gewisse soziale Erscheinungen früher und von einer unerwarteten Seite aus zu erkennen. Daraus erwachse die Verpflichtung des Literaten für die Gesellschaft und das Individuum.[2] Diese Ausführungen Alexander Solschenizyns bestätigen sein Verständnis vom Schriftsteller als moralischer Instanz. Nicht zuletzt dadurch stellt er sich in die Tradition des russischen Realismus. Dessen Vertreter, wie etwa Tolstoi oder Dostojewski, sahen ihren Auftrag in der zielgerichteten literarischen Erfassung der sozialen und politischen Situation ihrer Zeitgenossen und der daraus resultierenden Leiden. Zur dominierenden Gattung jener Epoche entwickelte sich der Roman, dessen frei wählbare Figurenkonstellation flexible Erzählperspektiven und einen konkreten Bezug zur Realität zuließ.[3] Ideologische Kontroversen und gesellschaftliche Probleme konnten überzeugender dargestellt werden. Zudem ermöglichte der „neue Erzählstil“ eine wirkungsvolle Einflussnahme in moralischer Hinsicht.
Für Alexander Solschenizyn stellt ein tiefes Erleben gesellschaftlicher Prozesse die Voraussetzung für Literatur dar.[4] Er selbst erfuhr Zeiten des Umbruchs und großen Leidens. In den Wirren der russischen Revolution wurde er am 11. Dezember 1918 geboren. Vor seiner Einberufung zum Kriegsdienst studierte er Mathematik und Philosophie. Aufgrund kritischer Äußerungen über Stalin in Briefen an einen Schulfreund erfolgte gegen Ende des Zweiten Weltkrieges seine Verhaftung. Ein Gericht verurteilte den überzeugten Leninisten zu acht Jahren Sonderlager und lebenslanger Verbannung in Kasachstan. Die persönlichen Lagererfahrungen und das Lagerthema insgesamt sollten Solschenizyn Zeit seines Lebens literarisch beschäftigen. Auf dem Hintergrund des Ost-West-Konfliktes wurde er als Kritiker des Sowjetregimes zum prominentesten Dissidenten seiner Zeit. Im Jahr 1970 sprach man ihm den Literaturnobelpreis zu. Weltweite Berühmtheit hatte er durch sein Debüt „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“ (1962) erlangt. Im Anschluss an Tolstoi, dem zufolge ein Tag aus dem Leben irgendeines Bauern als Hintergrund einer Erzählung dienen könne[5] , schildert Alexander Solschenizyn in der Novelle minutiös einen Durchschnittstag aus dem Leben eines durchschnittlichen Strafgefangenen im russischen GULag. Dabei möchte der Autor durch das Schicksal des Häftlings mit der Nummer S-854 die Erfahrungen einer ganzen Generation komprimieren. Sicher ist die Erzählung erheblich von den persönlichen Lagererfahrungen Solschenizyns geprägt und bekommt dadurch einen autobiographischen Aspekt. Wie in den „realistischen Romanen“ des 19. Jahrhunderts verzichtet er auf den persönlichen Erzählstil und eine distanzierte Stellungnahme. Das Geschehen wird aus der durch das Lager beschränkten Perspektive der Hauptfigur wahrgenommen und bewertet. Der Protagonist kämpft einerseits ums Überleben und ist darüberhinaus bemüht, die persönliche Würde und den Respekt vor sich selbst zu bewahren.
[...]
[1] Solschenizyn, Alexander: Von der Verantwortung des Schriftstellers I, Zürich 1969, S. 15.
[2] Vgl. Ebd., S. 15-16.
[3] Vgl. Städtke, Klaus: Russische Literaturgeschichte, Stuttgart 2002, S. 184-185.
[4] Vgl. Solschenizyn: Verantwortung, 1969, S. 15.
[5] Vgl. Ebd., S. 13; Holthusen, Johannes: Russische Literatur im 20. Jahrhundert, München 1992², S. 254.
Häufig gestellte Fragen
Welches Verständnis hat Solschenizyn von der Rolle des Schriftstellers?
Alexander Solschenizyn sieht den Schriftsteller als moralische Instanz, die in einer säkularisierten Welt die Aufgabe hat, soziale Leiden und politische Missstände aufzuzeigen.
Worum geht es in "Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch"?
Die Novelle schildert minutiös einen einzigen Durchschnittstag eines Häftlings in einem sowjetischen Arbeitslager (GULag) und zeigt dessen Kampf um Überleben und Würde.
In welcher literarischen Tradition steht Solschenizyn?
Er steht in der Tradition des russischen Realismus, ähnlich wie Tolstoi und Dostojewski, die Literatur als Mittel zur Erfassung der gesellschaftlichen Realität nutzten.
Warum ist die Erzählperspektive in der Novelle so wichtig?
Die Geschichte wird aus der beschränkten Sicht des einfachen Häftlings erzählt. Dies vermeidet Pathos und macht die Grausamkeit des Systems durch die Alltäglichkeit der Entbehrungen spürbar.
Welchen autobiographischen Hintergrund hat das Werk?
Solschenizyn verarbeitete in der Novelle seine eigenen achtjährigen Erfahrungen in sowjetischen Sonderlagern, zu denen er wegen Kritik an Stalin verurteilt worden war.
- Quote paper
- Johannes Grundberger (Author), 2009, Iwan Denisowitsch, ein Häftling mit Vorbildcharakter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201675