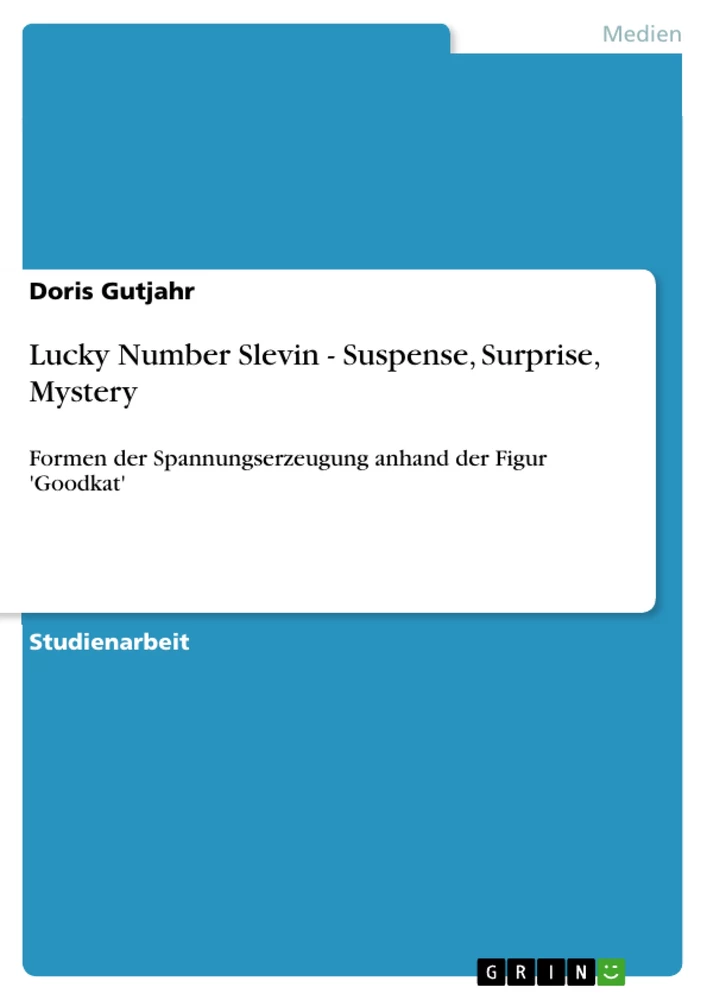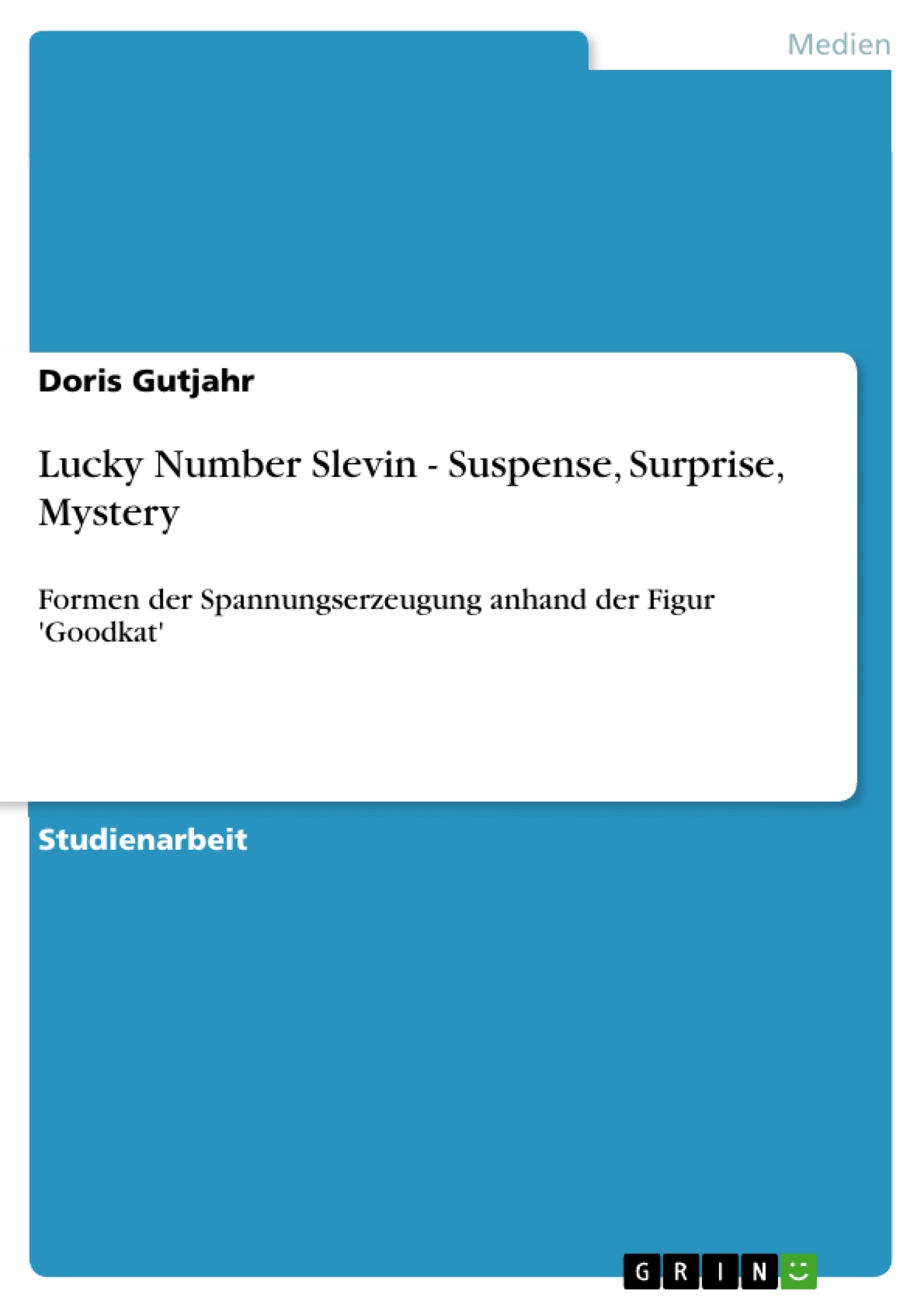Auf Spannung im Film kann, gerade in der heutigen Zeit, nicht mehr verzichtet werden – sie ist sozusagen „das Salz in der filmischen Suppe“. Nicht nur Horrorfilme oder Thriller, deren Rezeption eng mit dem Spannungserleben verbunden wird, sind ein Garant für Spannung. Eher ist es so, „dass Spannung ein universelles Prinzip ist, welches in den verschiedensten Filmgenres zur Anwendung kommen kann“. Auch Liebesdramen oder Fantasy–Filme sparen nicht an spannenden Momenten und ziehen den Zuschauer in ihren Bann. Doch wovon genau hängt nun Spannung ab? Wie wird sie erzeugt und was macht sie so unverzichtbar für die Filmwelt?
Die Beantwortung dieser Fragen soll einen großen Teil meiner Arbeit ausmachen, da sie zum einen die Grundlage für die folgende Analyse am Beispiel der Figur Goodkat darstellt und zum anderen zum besseren Verständnis dieser beiträgt.[...]
Inhaltsverzeichnis
0 Einleitung
1 Formen der Spannungserzeugung
1.1 Gestaltungsmittel der Spannungserzeugung
1.2 Mystery
1.3 Surprise
1.4 Suspense
2 Lucky Number Slevin
2.1 Allgemeines zum Film
2.2 Handlung des Films
2.3 Die Figur Goodkat
3 Analyse
3.1 Kurze Beschreibung des Verlaufsprotokolls
3.2 Spannungsanalyse anhand der Figur Goodkat
4 Zusammenfassung
5 Literaturangaben
- Quote paper
- Doris Gutjahr (Author), 2012, Lucky Number Slevin - Suspense, Surprise, Mystery, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201702