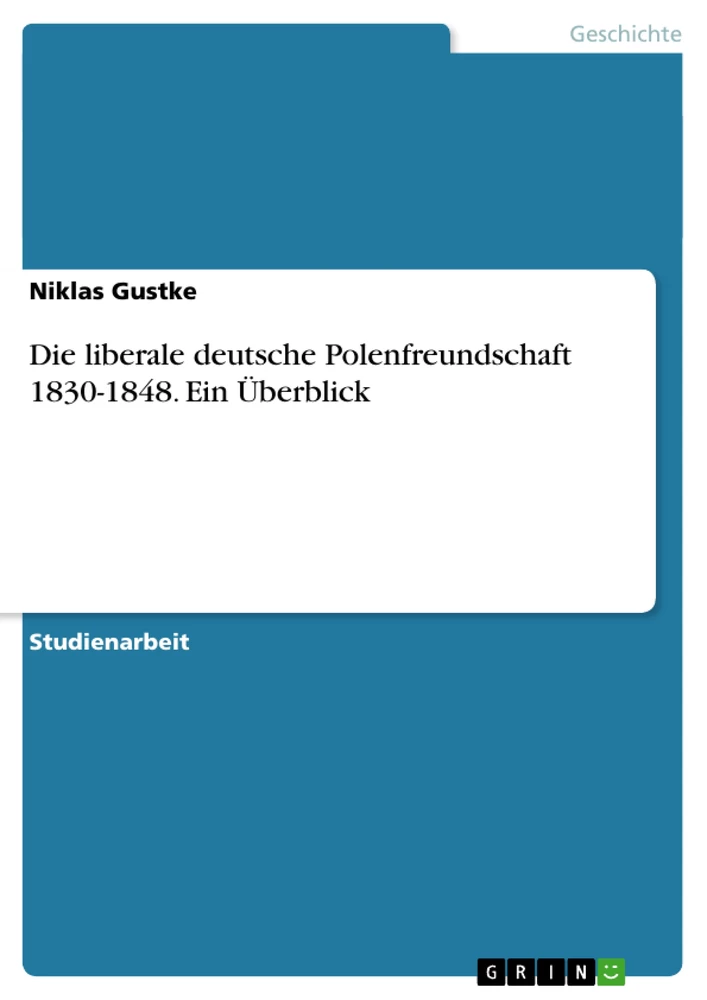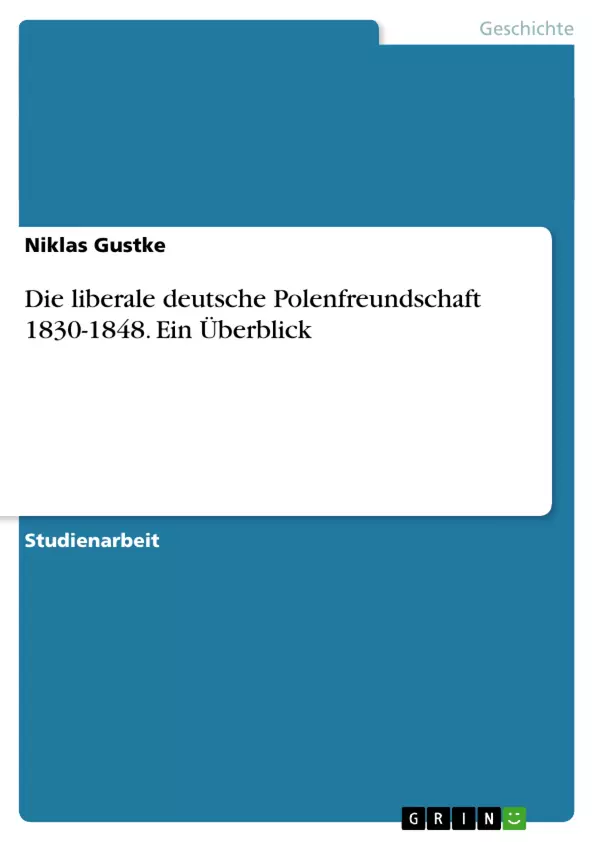Die liberale deutsche Polenfreundschaft 1830-1848
- Ein Überblick -
Niklas Gustke
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Novemberaufstand und deutsche Polenbegeisterung: Die erste Phase
3. Durchzug der polnischen Exilanten und deutsche Polenfreundschaft: Die zweite Phase
4. Die Zwischenphase 1833 bis zur Posen-Debatte in der Frankfurter Nationalversammlung 1848
5. Die Polen-Debatte in der Frankfurter Nationalversammlung vom 24. bis 27. Juli 1848
6. Die verschiedenen Nationalismus-Konzepte der deutschen Oppositionellen: Gründe für das Ende der deutsch-polnischen Freundschaft
7. Zusammenfassung
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Es mag auf den ersten Blick falsch sein, von einer deutschen Polenfreundschaft von 1830 bis 1848 zu sprechen. Denn 1848 scheint in Anbetracht der Posen-Debatte der Frankfurter Nationalversammlung, in der die Teilung des Großßherzogtums Posen und damit die Ignorierung sämtlicher Interessen der polnischen Nationalbewegung mit großer Mehrheit beschlossen wurde, von einer deutschen Polenfreundschaft nichts mehr übrig zu sein.
Abgesehen von der Existenz der sich weiterhin solidarisch gebenden Paulskirchen-Minderheit spricht noch ein anderes Argument dafür, weder den Höhepunkt der Polenfreundchaft der Jahre 1830-33 mit seinen große Bevölkerungsteile erfassenden enthusiastischen Zügen, noch die Posen-Debatte vom 24. bis 27. Juli 1848 isoliert zu betrachten. Zu groß wäre dann aufgrund der scheinbaren Unvermitteltheit des Endes der Polenbegeisterung die Gefahr, die deutsche Polenfreundschaft der frühen dreißiger Jahre als romantische Verirrung, als politisch unreife Schwärmerei abzutun.
Die vorliegende Arbeit will dagegen zeigen, daß die Spaltung der dem Liberalismus zuneigenden Paulskirchen-Abgeordenten in der Posen-Debatte ihre Ursache in zwei sich gegenseitig ausschließenden Nationalismus-Konzepten hat. Während die radiklademokratische Minderheit das Konzept eines (kosmo)politischen Nationalismus mit dem Ziel einer gleichberechtigten Lösung der deutschen und der polnischen Frage vertrat, scharte sich die Mehrheit der Parlamentarier hinter einen integrativen, auf die realpolitischen Interessen eines zukünftigen deutschen Staates allein bezogenen Nationalismus. Inwieweit diese beiden Nationalismus-Konzepte bereits 1830-33 ausgereift waren und welche politische Funktion die Polenfreundschaft für die deutschen Frühliberalen hatte, soll im Abschlußkapitel untersucht werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Novemberaufstand und deutsche Polenbegeisterung: Die erste Phase
- Durchzug der polnischen Exilanten und deutsche Polenfreundschaft: Die zweite Phase
- Die Zwischenphase 1833 bis zur Posen-Debatte in der Frankfurter Nationalversammlung 1848
- Die Polen-Debatte in der Frankfurter Nationalversammlung vom 24. bis 27. Juli 1848
- Die verschiedenen Nationalismus-Konzepte der deutschen Oppositionellen: Gründe für das Ende der deutsch-polnischen Freundschaft
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die deutsche Polenfreundschaft zwischen 1830 und 1848, insbesondere die Entwicklung und den Wandel dieser Haltung bis zur Posen-Debatte in der Frankfurter Nationalversammlung. Sie analysiert die Ursachen für das Ende dieser Freundschaft und beleuchtet die Rolle unterschiedlicher nationalistischer Konzepte im liberalen Lager.
- Der Einfluss des Novemberaufstands auf die deutsche öffentliche Meinung.
- Die Entwicklung und die Organisation der deutschen Polenhilfe.
- Die Rolle der deutschen Liberalen und ihre unterschiedlichen Nationalismuskonzepte.
- Die Posen-Debatte als Wendepunkt in den deutsch-polnischen Beziehungen.
- Die Ursachen für das Scheitern der deutsch-polnischen Freundschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die deutsche Polenfreundschaft von 1830 bis 1848, deren scheinbares Ende mit der Posen-Debatte von 1848 als romantische Verirrung oder politisch unreife Schwärmerei interpretiert werden könnte. Sie argumentiert jedoch, dass die Spaltung der liberalen Abgeordneten auf zwei gegensätzlichen Nationalismuskonzepten beruht: einem kosmopolitischen und einem integrativen, realpolitischen Ansatz. Die Arbeit verfolgt die Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen in verschiedenen Phasen, um die Hintergründe dieser Entwicklung besser zu verstehen.
Novemberaufstand und deutsche Polenbegeisterung: Die erste Phase: Diese Phase, von November 1830 bis September 1831, zeigt die anfängliche deutsche Unterstützung für den polnischen Novemberaufstand. Es entstanden "Polenkomitees", die humanitäre und materielle Hilfe leisteten. Diese Hilfsbereitschaft wurde durch die gleichzeitigen Unruhen in deutschen Staaten und die damit verbundene Liberalisierung des öffentlichen Lebens begünstigt. Die Unterstützung war vor allem auf humanitärer Ebene angesiedelt und noch nicht stark politisiert.
Durchzug der polnischen Exilanten und deutsche Polenfreundschaft: Die zweite Phase: Nach dem Scheitern des Aufstands flohen polnische Exilanten durch Deutschland. Dieser Durchzug verstärkte die bereits bestehende Sympathie und Solidarität in Teilen der deutschen Bevölkerung. Die zweite Phase ist geprägt durch eine intensivere, wenn auch weiterhin uneinheitliche, deutsche Unterstützung der polnischen Sache. Die Unterstützung war weiterhin von humanitärer Hilfe geprägt aber politische Forderungen wurden klarer formuliert.
Die Zwischenphase 1833 bis zur Posen-Debatte in der Frankfurter Nationalversammlung 1848: Diese Phase zeichnet sich durch eine allmähliche Abkühlung der deutsch-polnischen Beziehungen aus. Obwohl die Polenfreundschaft nicht völlig verschwand, nahm die politische Unterstützung ab und die Differenzen in Bezug auf nationale Interessen wurden deutlicher.
Schlüsselwörter
Deutsche Polenfreundschaft, Novemberaufstand, Frankfurter Nationalversammlung, Posen-Debatte, Liberalismus, Nationalismus, Kosmopolitischer Nationalismus, Integrativer Nationalismus, deutsch-polnische Beziehungen, 1830-1848.
Häufig gestellte Fragen zur deutsch-polnischen Freundschaft 1830-1848
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die deutsch-polnische Freundschaft zwischen 1830 und 1848, insbesondere ihren Wandel bis zur Posen-Debatte in der Frankfurter Nationalversammlung. Sie analysiert die Ursachen für das Ende dieser Freundschaft und die Rolle unterschiedlicher nationalistischer Konzepte im liberalen Lager.
Welche Phasen der deutsch-polnischen Beziehungen werden untersucht?
Die Arbeit gliedert die deutsch-polnischen Beziehungen in drei Hauptphasen: 1) Novemberaufstand und anfängliche deutsche Polenbegeisterung (Nov. 1830 - Sept. 1831); 2) Durchzug polnischer Exilanten und verstärkte Solidarität; 3) Eine Zwischenphase von 1833 bis zur Posen-Debatte 1848, geprägt von Abkühlung der Beziehungen.
Wie erklärt die Arbeit das Ende der deutsch-polnischen Freundschaft?
Das Ende der deutsch-polnischen Freundschaft wird durch die unterschiedlichen Nationalismuskonzepte im liberalen Lager erklärt: ein kosmopolitischer und ein integrativer, realpolitischer Ansatz. Die Posen-Debatte in der Frankfurter Nationalversammlung markierte einen entscheidenden Wendepunkt.
Welche Rolle spielte der Novemberaufstand?
Der Novemberaufstand 1830 löste in Deutschland anfängliche Sympathien und Unterstützung für Polen aus. Es entstanden "Polenkomitees", die humanitäre und materielle Hilfe leisteten. Diese Hilfsbereitschaft wurde durch gleichzeitige Unruhen und Liberalisierung in deutschen Staaten begünstigt.
Welche Rolle spielten die polnischen Exilanten?
Der Durchzug polnischer Exilanten durch Deutschland nach dem Scheitern des Novemberaufstands verstärkte die bestehenden Sympathien und führte zu einer intensiveren, wenn auch uneinheitlichen, deutschen Unterstützung der polnischen Sache.
Was war die Bedeutung der Posen-Debatte in der Frankfurter Nationalversammlung?
Die Posen-Debatte (24.-27. Juli 1848) wird als Wendepunkt in den deutsch-polnischen Beziehungen dargestellt, die die Spaltung der liberalen Abgeordneten in Bezug auf ihre Nationalismuskonzepte aufdeckte und das scheinbare Ende der deutsch-polnischen Freundschaft markierte.
Welche Nationalismuskonzepte werden in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit unterscheidet zwischen einem kosmopolitischen und einem integrativen, realpolitischen Nationalismuskonzept innerhalb des liberalen Lagers, die die unterschiedlichen Positionen in Bezug auf die polnische Frage erklären.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Polenfreundschaft, Novemberaufstand, Frankfurter Nationalversammlung, Posen-Debatte, Liberalismus, Nationalismus, Kosmopolitischer Nationalismus, Integrativer Nationalismus, deutsch-polnische Beziehungen, 1830-1848.
- Quote paper
- Niklas Gustke (Author), 2002, Die liberale deutsche Polenfreundschaft 1830-1848. Ein Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20171