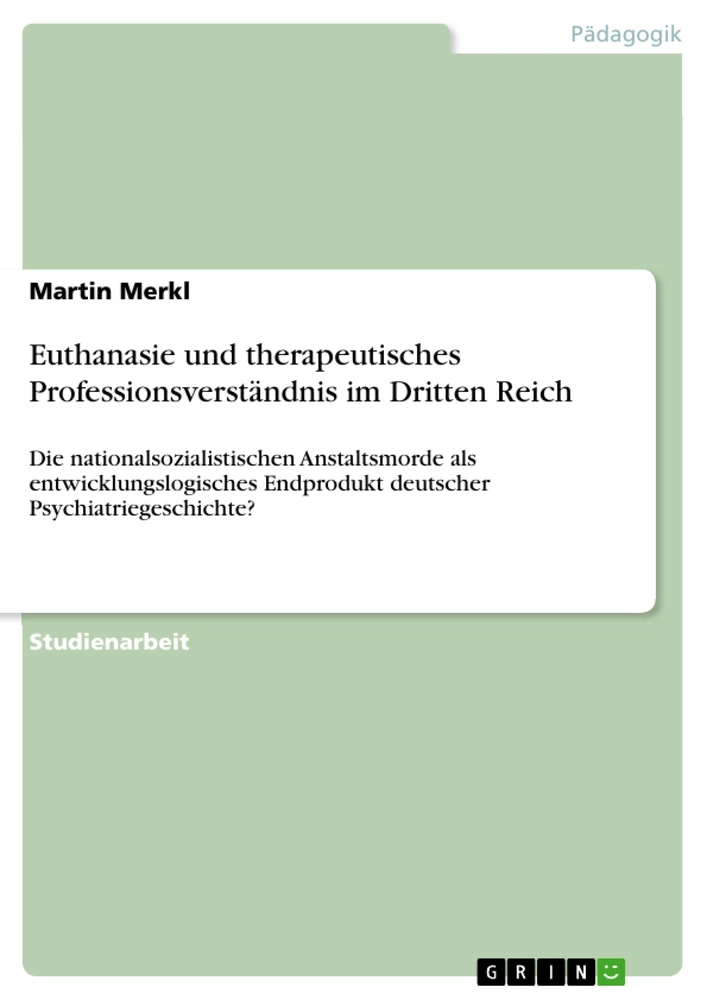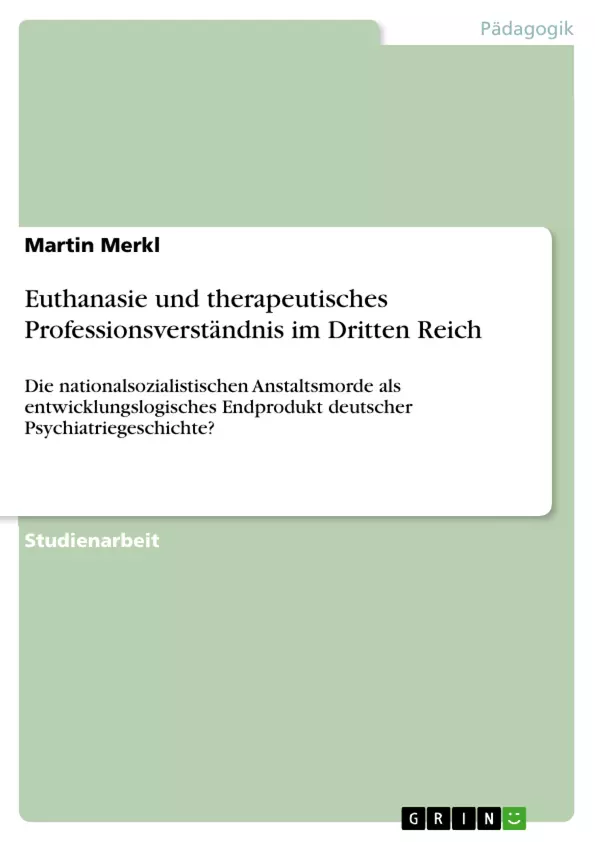Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des Oberseminars „Geschichte der Sonderpädagogik“, unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Evelyn Heinemann, an der Universität Mainz, im Sommersemester 2011. Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung und Euthanasie im Nationalsozialismus bin ich dabei auf ein interessantes Paradoxon in der deutschen Psychiatriegeschichte gestoßen: so wird im elften Kapitel des Werkes „Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie“ von Hans-Walter Schmuhl auf einen engen Zusammenhang zwischen Euthanasieaktion und vermeintlicher Modernisierung des psychiatrischen Wesens verwiesen (vgl. SCHMUHL 1987, S. 261f). Auf den folgenden Seiten versucht der Autor seine These zu erläutern, dass der verbrecherische Prozess der massenhaften Anstaltstötungen in der NS-Zeit nicht zuletzt durch einen „therapeutischen Idealismus“ (ebd., S. 261) der beteiligten Psychiater ermöglicht wurde. Bei dieser Lektüre stellte ich mir die Frage, in wie weit das systematische Töten von sog. „lebensunwerten Lebens“ (BRÜCKNER 2010, S. 126) nach Binding und Hoche (vgl. ebd.) mit dem wissenschaftlichen Fortschrittsgedanken und insbesondere einem tatsächlichen therapeutischen Professionsverständnis vereinbar sein kann.
Die vorliegende Arbeit gibt dementsprechend das Produkt meiner Recherchen wieder, und weist einige Aspekte zur Beantwortung meiner Fragestellung auf. Sie begreift sich dabei als historische Analyse jener geschichtlichen Vorbedingungen, die zur Erklärung für den erwähnten Widerspruch im therapeutischen Selbstverständnis der NS-Psychiatrie dienen können. Unverzichtbar für mich ist hierbei der Verweis, dass die Erhellung dieser Umstände und Erklärungen im Wesentlichen darauf zielen, eine Wiederholung jener ungeheuerlichen Mordvorgänge auszuschließen, „Euthanasie“ als einmalige Katastrophe der Geschichte zu betrachten, und ihr das Attribut endgültiger Historizität zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Euthanasie und Psychiatrie in der NS-Zeit
- 1.1. „Rassenhygiene“ und Euthanasie
- 1.2. Die Rolle der Psychiatrie
- 2. Psychiatrie im 19. Jahrhundert
- 2.1. Die Etablierung des psychiatrischen Wesens
- 2.2. Sozialdarwinismus und Degenerationstheorie
- 2.3. Psychiatrische Anstaltspraktiken
- 3. Euthanasie als Endprodukt psychiatrischer Entwicklungsdynamik?
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Paradoxon des therapeutischen Professionsverständnisses in der deutschen Psychiatrie während des Dritten Reichs im Kontext der nationalsozialistischen Anstaltsmorde. Sie analysiert die historischen Vorbedingungen, die zu diesem Widerspruch zwischen dem vermeintlichen therapeutischen Idealismus und der massenhaften Tötung von Menschen mit Behinderungen führten. Die Arbeit zielt darauf ab, die geschichtlichen Zusammenhänge zu beleuchten und Wiederholungen solcher Verbrechen auszuschließen.
- Die Rolle der Psychiatrie im nationalsozialistischen Euthanasieprogramm
- Der Einfluss von Rassenhygiene und Sozialdarwinismus auf die Psychiatrie
- Die Entwicklung der psychiatrischen Anstaltspraktiken im 19. Jahrhundert
- Der Widerspruch zwischen therapeutischem Idealismus und Anstaltsmorden
- Die historischen Vorbedingungen der Euthanasie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Euthanasie und Psychiatrie in der NS-Zeit: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die nationalsozialistischen Massentötungen in psychiatrischen Anstalten. Es beleuchtet den historischen Ablauf, die damalige Rechtslage und die entscheidende Rolle der Psychiatrie. Besonders hervorgehoben wird die enge Verknüpfung zwischen Psychiatrie und dem Euthanasieprogramm. Die Zusammenfassung der Ereignisse zeigt, wie die Psychiatrie, anstatt Hilfe zu leisten, aktiv an der systematischen Vernichtung von Menschen beteiligt war, indem sie die Tötungspraxis durch überdosierte Medikamente, Pflegeentzug und Mangelernährung unterstützte oder zumindest duldete. Die Gleichschaltung des Gesundheitswesens durch das NS-Regime wird als entscheidender Faktor für die Beteiligung der Psychiatrie hervorgehoben.
2. Psychiatrie im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der deutschen Psychiatrie im 19. Jahrhundert. Es analysiert die Etablierung des psychiatrischen Systems, den Einfluss von Sozialdarwinismus und Degenerationstheorie auf die Konzepte und Praktiken der Psychiatrie sowie die konkreten Anstaltspraktiken. Der Fokus liegt auf der Darstellung jener gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Strömungen, welche die Grundlage für die späteren menschenverachtenden Maßnahmen im Nationalsozialismus bildeten. Das Kapitel legt dar, wie die Ideologien des 19. Jahrhunderts, wie der Sozialdarwinismus und die Degenerationstheorie, bereits den Nährboden für die spätere Rassenhygiene und die Euthanasie legten, indem sie bestimmte Gruppen als „minderwertig“ und „lebensunwert“ stigmatisierten.
3. Euthanasie als Endprodukt psychiatrischer Entwicklungsdynamik?: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen der historischen Entwicklung der Psychiatrie und der nationalsozialistischen Euthanasie. Es analysiert, inwieweit die im vorherigen Kapitel dargestellten Entwicklungen der Psychiatrie des 19. Jahrhunderts die Euthanasie des Dritten Reiches ermöglichten oder sogar begünstigten. Die Kapitel verbindet die vorherigen Kapitel und argumentiert, dass die Euthanasie nicht als isolierte Handlung, sondern als Ergebnis eines langfristigen Prozesses verstanden werden muss, der auf gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts aufbaut. Es wird die These untersucht, ob die Euthanasie ein logisches Endergebnis der Entwicklungen innerhalb der Psychiatrie ist.
Schlüsselwörter
Euthanasie, Psychiatrie, Nationalsozialismus, Rassenhygiene, Sozialdarwinismus, Degenerationstheorie, Anstaltsmorde, therapeutisches Professionsverständnis, „lebensunwertes Leben“, historische Analyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Euthanasie und Psychiatrie im Nationalsozialismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Paradoxon des therapeutischen Professionsverständnisses in der deutschen Psychiatrie während des Dritten Reichs im Kontext der nationalsozialistischen Anstaltsmorde. Sie analysiert die historischen Vorbedingungen, die zu diesem Widerspruch zwischen dem vermeintlichen therapeutischen Idealismus und der massenhaften Tötung von Menschen mit Behinderungen führten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Psychiatrie im nationalsozialistischen Euthanasieprogramm, den Einfluss von Rassenhygiene und Sozialdarwinismus auf die Psychiatrie, die Entwicklung psychiatrischer Anstaltspraktiken im 19. Jahrhundert, den Widerspruch zwischen therapeutischem Idealismus und Anstaltsmorden sowie die historischen Vorbedingungen der Euthanasie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Euthanasie und Psychiatrie in der NS-Zeit; 2. Psychiatrie im 19. Jahrhundert; 3. Euthanasie als Endprodukt psychiatrischer Entwicklungsdynamik?; und 4. Fazit.
Was wird im Kapitel "Euthanasie und Psychiatrie in der NS-Zeit" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die nationalsozialistischen Massentötungen in psychiatrischen Anstalten. Es beleuchtet den historischen Ablauf, die damalige Rechtslage und die entscheidende Rolle der Psychiatrie, insbesondere die enge Verknüpfung zwischen Psychiatrie und dem Euthanasieprogramm. Es zeigt, wie die Psychiatrie aktiv an der systematischen Vernichtung von Menschen beteiligt war.
Was wird im Kapitel "Psychiatrie im 19. Jahrhundert" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der deutschen Psychiatrie im 19. Jahrhundert, analysiert die Etablierung des psychiatrischen Systems, den Einfluss von Sozialdarwinismus und Degenerationstheorie auf die Konzepte und Praktiken der Psychiatrie sowie die konkreten Anstaltspraktiken. Es zeigt, wie Ideologien des 19. Jahrhunderts den Nährboden für spätere menschenverachtende Maßnahmen legten.
Was wird im Kapitel "Euthanasie als Endprodukt psychiatrischer Entwicklungsdynamik?" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen der historischen Entwicklung der Psychiatrie und der nationalsozialistischen Euthanasie. Es analysiert, inwieweit die Entwicklungen der Psychiatrie des 19. Jahrhunderts die Euthanasie des Dritten Reiches ermöglichten oder begünstigten. Es untersucht die These, ob die Euthanasie ein logisches Endergebnis der Entwicklungen innerhalb der Psychiatrie ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Euthanasie, Psychiatrie, Nationalsozialismus, Rassenhygiene, Sozialdarwinismus, Degenerationstheorie, Anstaltsmorde, therapeutisches Professionsverständnis, „lebensunwertes Leben“, historische Analyse.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Entwicklung der Psychiatrie und der nationalsozialistischen Euthanasie zu beleuchten und Wiederholungen solcher Verbrechen auszuschließen.
- Quote paper
- Martin Merkl (Author), 2011, Euthanasie und therapeutisches Professionsverständnis im Dritten Reich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201711