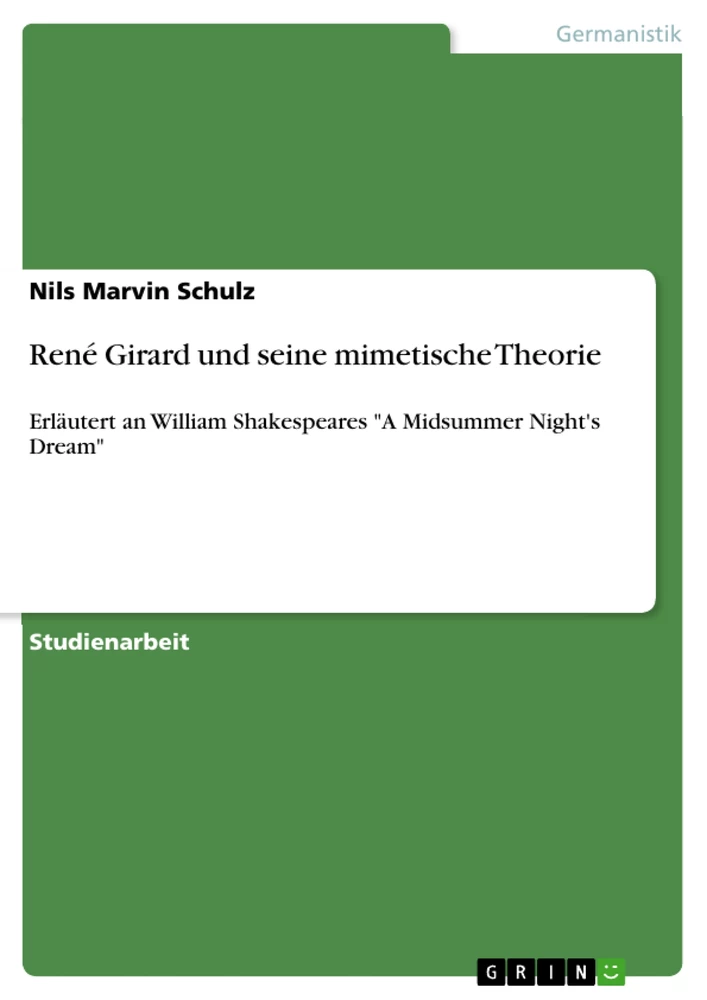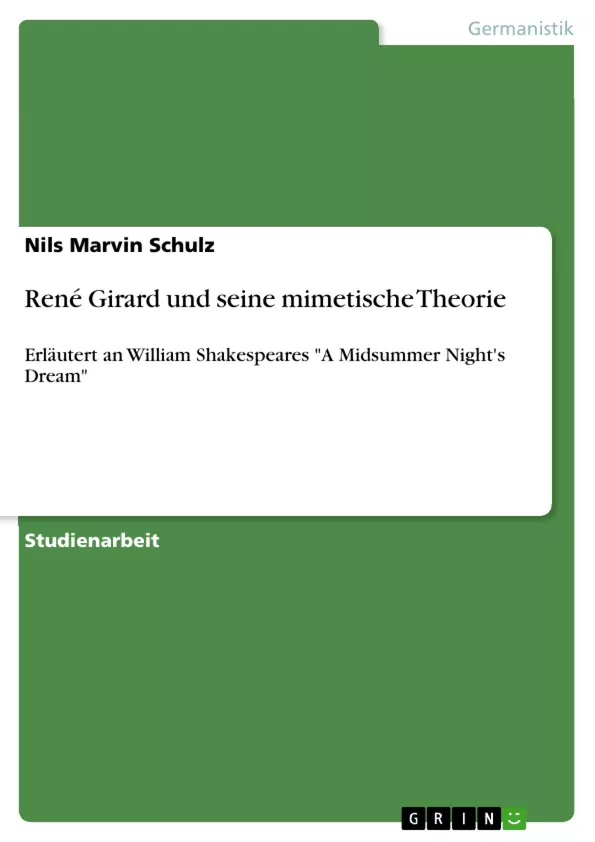Zunächst erscheint es als äußerst sinnvoll, das Zentrum von René Girards Theorie, nämlich die Mimesis, genauer zu definieren. In dieser Arbeit wird Mimesis bzw. Nachahmung ohne einen damit direkt verknüpften Denkvorgang im Sinne Émile Durkheimers definiert:
„Es liegt Nachahmung vor, wenn einer Handlung unmittelbar die Vorstellung einer ähnlichen, von einem anderen vorher vollzogenen vorausgeht, ohne daß [sic!] sich zwischen Vorstellung und Ausführung explizit oder implizit irgendein Denkvorgang einschaltet, der diese Handlung ihrem Wesen nach durchdringt.“1
Platon lässt sich in seinem „Staat“2 im Zuge einer Abstufung anhand des Stuhlbeispiels sowie den folgenden Passagen eher abfällig über Mimesis bzw. Nachahmung aus. Es gebe drei Stühle, wobei nur der von Gott geschaffene erste Stuhl tatsächlich der wahrhaft Seiende sei und sowohl der vom Handwerker geschaffene als auch der vom Maler porträtierte bloße Abbilder darstellen.
Nichtsdestotrotz geht Platon in seinem Dialog sogar so weit, den Maler, der stellvertretend für die Kunst steht, als Nachahmer des vom Handwerker angefertigten Scheinbildes zu bezeichnen3. Damit wertet der die Mimesis mit Sorge betrachtende Platon die Mimesis ab und charakterisiert diese als negativ. Doch im Unterschied zu Platon wertet dessen Schüller, Aristoteles, die Mimesis weniger negativ. Die Nachahmung sei dem Menschen angeboren und unterscheide jenen von den Tieren. Des Weiteren lerne der Mensch durch Mimesis und habe Freude daran.4 Doch ebenso wie Platon beschränkte Aristoteles das Ausmaß der Mimesis auf reine Repräsentationen und Äußerlichkeiten wie Gestik und Mimik, sodass der Bereich der Aneignungsmimesis in der geistigen Tradition Europas bis in die Gegenwart ausgeklammert wurde.
[...]
1 Émile Durkheimer: Der Selbstmord. Übersetzt aus dem Französischen von Sebastian und Hanne Herkommer. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, Bd. 431), 1983, S.132.
2 Platon: Der Staat. Übersetzt und herausgegeben von Karl Vretska. Stuttgart: Reclam Verlag (ND der bibliographisch ergänzten Ausgabe von 2000), 2008 (im Folgenden zitiert als „Platon, Staat“).
3 Vgl. ebd., S.434ff bzw. 10. Buch, 597b-598b.
4 Vgl. Aristoteles: Poetik. Griechisch / Deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Manfred Fuhrmann. Stuttgart: Reclam Verlag (ND der bibliographisch ergänzten Ausgabe von 1994), 2005, S.11 bzw. Poet. 4, 1448b5-15.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die vier Ebenen des „Sommernachtstraumes“
- Zwischenmenschliche Beziehungen und Girards trianguläres Beziehungsmodell
- Grundlegendes zur mimetischen Theorie bzw. zur mimetischen Krise
- Girards trianguläres Beziehungsmodell in der Phase der Aneignungsmimesis (I)
- Die Eskalation der mimetischen Krise und der Sündenbockmechanismus
- Die aufkommende mimetische Krise in der Phase der Gegenspielermimesis (II)
- Der Weber Bottom als Personifikation der mimetischen Krise
- Die Eskalation der mimetischen Krise und der Sündenbockmechanismus
- Ritus und Mythos im „Sommernachtstraum“
- Die Sommersonnenwende als Ritual
- Mythische und magische Figuren in „A Midsummer Night's Dream”
- Der Mythos im Allgemeinen und jener von Pyramus und Thisbe
- Die Funktion des Mythos im Shakespeareschen Werk und die Wiedervereinigungsmimesis (III)
- Zusammenfassung und eigene Anmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht William Shakespeares „A Midsummer Night's Dream“ durch die Linse von René Girards mimetischer Theorie. Das Hauptziel ist es, die im Stück dargestellten zwischenmenschlichen Beziehungen und Konflikte im Kontext von Girards Konzepten der Mimesis, der mimetischen Krise und des Sündenbockmechanismus zu analysieren.
- Die Anwendung der mimetischen Theorie auf ein literarisches Werk
- Analyse der verschiedenen Ebenen der Handlung in „A Midsummer Night's Dream“
- Die Rolle der Mimesis im Entstehungsprozess von Konflikten und deren Eskalation
- Die Bedeutung von Ritual und Mythos im Kontext der mimetischen Krise
- Die Auflösung der Krise durch den Sündenbockmechanismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung definiert den Begriff der Mimesis und stellt René Girards mimetische Theorie vor, die im Gegensatz zu Platon und Aristoteles die Nachahmung als zentrales Element des menschlichen Begehrens und der Entstehung von Konflikten versteht. Sie skizziert den Forschungsansatz, der Girards Theorie auf Shakespeares „A Midsummer Night's Dream“ anwendet, um die These zu überprüfen, dass Shakespeare die Mechanismen des Begehrens besser verstand als viele andere Denker.
Die vier Ebenen des „Sommernachtstraumes“: Dieses Kapitel beschreibt die vier Handlungsebenen des Stücks: die Hochzeit von Theseus und Hippolyta, die Liebeswirren der vier Athener, die Aufführung der Handwerker und die Welt der Feen. Die Darstellung dieser verschiedenen Ebenen legt den Grundstein für die anschließende Analyse der mimetischen Beziehungen zwischen den Figuren.
Zwischenmenschliche Beziehungen und Girards trianguläres Beziehungsmodell: Dieses Kapitel erklärt Girards trianguläres Beziehungsmodell, welches die Entstehung mimetischen Begehrens und die daraus resultierenden Konflikte beschreibt. Es analysiert die Beziehungen zwischen den vier Liebenden, insbesondere das Dreieck Helena-Hermia-Demetrius, und demonstriert, wie mimetisches Begehren zu Rivalität und Eskalation führt. Der Fokus liegt auf der Phase der Aneignungsmimesis.
Die Eskalation der mimetischen Krise und der Sündenbockmechanismus: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Eskalation der mimetischen Krise in der Phase der Gegenspielermimesis. Es analysiert die Rolle von Bottom als Personifikation der Krise und untersucht, wie der Sündenbockmechanismus zur Auflösung des Konflikts beiträgt. Die Analyse umfasst die verschiedenen Handlungsebenen und beleuchtet, wie der Konflikt sich auf jeder Ebene manifestiert.
Ritus und Mythos im „Sommernachtstraum“: Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Ritual und Mythos im Stück, insbesondere das Ritual der Sommersonnenwende und den Mythos von Pyramus und Thisbe. Es analysiert die Bedeutung dieser Elemente im Kontext der mimetischen Theorie und untersucht, wie sie zur Lösung der Krise beitragen. Der Fokus liegt auf der Wiedervereinigungsmimesis.
Häufig gestellte Fragen zu: A Midsummer Night's Dream - Eine mimetische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert William Shakespeares „A Midsummer Night's Dream“ unter Anwendung von René Girards mimetischer Theorie. Der Fokus liegt auf der Untersuchung zwischenmenschlicher Beziehungen und Konflikte im Stück, insbesondere im Kontext von Mimesis, mimetischer Krise und dem Sündenbockmechanismus.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Anwendung der mimetischen Theorie auf ein literarisches Werk, die Analyse der verschiedenen Handlungsebenen in „A Midsummer Night's Dream“, die Rolle der Mimesis bei der Entstehung und Eskalation von Konflikten, die Bedeutung von Ritual und Mythos im Kontext der mimetischen Krise, und schließlich die Auflösung der Krise durch den Sündenbockmechanismus.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung (Einführung in die mimetische Theorie und den Forschungsansatz), Analyse der vier Handlungsebenen des Stücks, Untersuchung der zwischenmenschlichen Beziehungen anhand von Girards triangulärem Beziehungsmodell (mit Fokus auf Aneignungsmimesis), Eskalation der mimetischen Krise und der Sündenbockmechanismus (mit Fokus auf Gegenspielermimesis), die Rolle von Ritual und Mythos (mit Fokus auf Wiedervereinigungsmimesis) und abschließend eine Zusammenfassung und eigene Anmerkungen.
Welche Konzepte von René Girard werden verwendet?
Die zentrale Grundlage bildet Girards mimetische Theorie, die die Nachahmung als zentrales Element des menschlichen Begehrens und der Konfliktentstehung versteht. Konkret werden Girards trianguläres Beziehungsmodell, die Konzepte der Aneignungs-, Gegenspieler- und Wiedervereinigungsmimesis sowie der Sündenbockmechanismus angewendet.
Wie werden die verschiedenen Handlungsebenen des Stücks analysiert?
Die Arbeit analysiert die vier Handlungsebenen des Stücks (Hochzeit von Theseus und Hippolyta, Liebeswirren der Athener, Aufführung der Handwerker, Welt der Feen) separat und im Kontext zueinander, um die Auswirkungen der mimetischen Beziehungen auf jeder Ebene zu untersuchen.
Welche Rolle spielt der Sündenbockmechanismus?
Der Sündenbockmechanismus wird als Lösungsmechanismus der mimetischen Krise untersucht. Die Arbeit analysiert, wie dieser Mechanismus die Konflikte auflöst und welche Rolle er in der Auflösung der Konflikte auf den verschiedenen Handlungsebenen spielt.
Welche Rolle spielen Ritus und Mythos?
Die Arbeit analysiert die Rolle von Ritualen (z.B. Sommersonnenwende) und Mythen (z.B. Pyramus und Thisbe) im Stück und wie diese Elemente im Kontext der mimetischen Theorie zur Lösung der Krise beitragen. Der Fokus liegt dabei auf der Wiedervereinigungsmimesis.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel besteht darin, die im Stück dargestellten zwischenmenschlichen Beziehungen und Konflikte mithilfe von Girards mimetischer Theorie zu analysieren und zu zeigen, wie Shakespeare die Mechanismen des Begehrens in seinem Werk darstellt.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für William Shakespeare, René Girards mimetische Theorie und die Anwendung literaturwissenschaftlicher Theorien auf literarische Werke interessieren.
- Quote paper
- Nils Marvin Schulz (Author), 2011, René Girard und seine mimetische Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201800