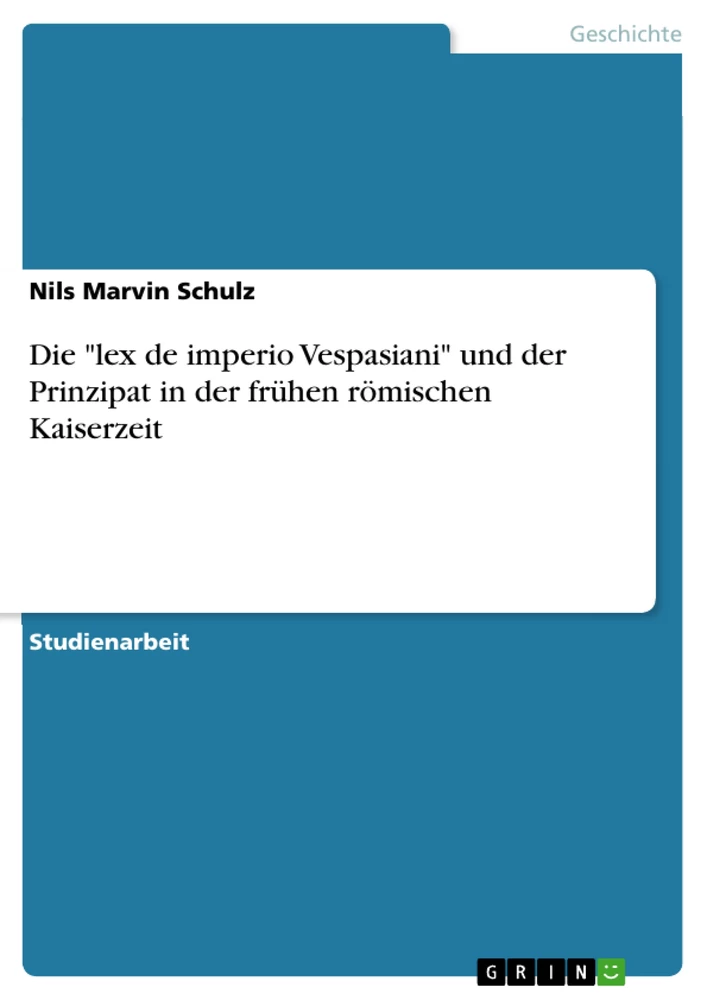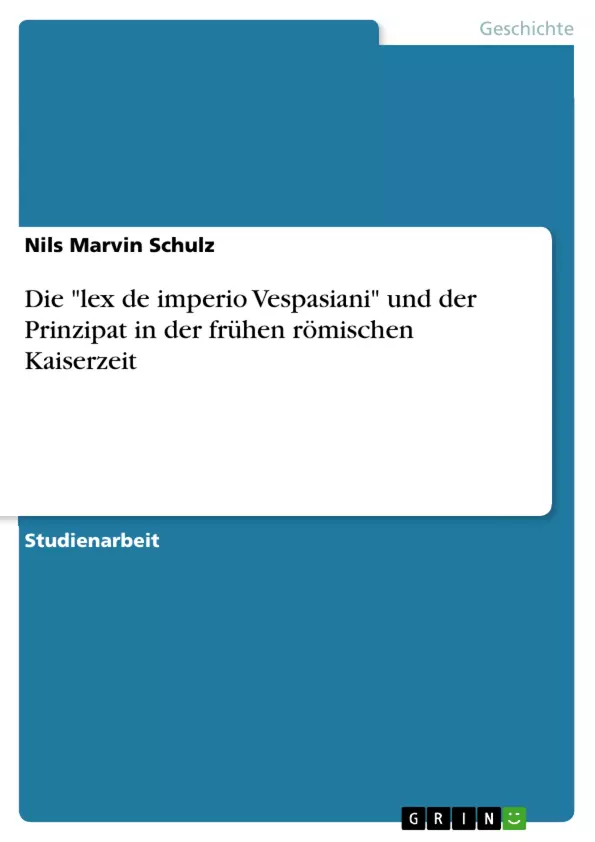Ungefähr einhundert Jahre nachdem Octavian-Augustus Marcus Antonius bei Actium (31 n. Chr.) besiegt und 30 n. Chr. Alexandria eingenommen hatte , erschütterte erneut ein Bürgerkrieg das Römische Imperium. In den Wirren des Vierkaiserjahres 68 und 69 n. Chr. kamen nacheinander die vier Usurpatoren bzw. die späteren Principes Galba, Otho, Vitellius und Vespasian an die Macht. Mit der Erstürmung Roms und der Ermordung Vittelius’ am 20. Dezember 69 n. Chr. ging letztendlich der Flavier Vespasian zusammen mit seinen Verbündeten als Sieger aus diesen Bürgerkriegswirren hervor . Glücklicherweise ist eine Inschrift aus dem Jahr 69 n. Chr. erhalten, die Aufschluss darüber gibt, welche Kompetenzen, Befugnisse und Privilegien dem neuen Princeps zugestanden wurden - die „lex de imperio Vespasiani“ . Da es sich bei dem System des Prinzipats um eine faktische Monarchie handelte, scheint von Interesse zu sein, wie weit die Befugnisse reichten und ob dem ersten Mann im Staat überhaupt Grenzen gesetzt wurden oder ob die Principes gar im rechtsfreien Raum herrschen konnten.
Um jedoch nachvollziehen zu können, wie es zu dieser Aufstellung kaiserlicher Rechte gekommen ist und wie sich der Prinzipat bis zum Jahre 69 n. Chr. entwickelt hat, scheint es notwendig, sich zunächst mit dem Erschaffer dieses neuen Systems auseinanderzusetzen.
Auch über fünfzig Jahre nach dem Tod des Octavian-Augustus prägte noch immer das von ihm entworfene System den politischen Alltag des Imperiums.
Inhaltsverzeichnis
1.) Einleitung
2.) Die Basis des augusteischen Prinzipats
2.1 Die „tribunicia potestas“
2.2 Das „imperium proconsulare“
2.3 Der Princeps als Privatmann
2.4 Die „auctoritas“ als Ausdruck der Vorrangstellung im Staat
2.5 Verwebung alter und neuer Herrschaftsstrukturen
3.) Die „lex de imperio Vespasiani“
3.1 Der verlorene erste Teil der „lex de imperio Vespasiani“ und
die literarische Überlieferung
3.2 Der hybride Charakter der „lex de imperio Vespasiani“
und die Principes
4.) Die Paragraphen der „lex de imperio Vespasiani“
4.1 Paragraph I
4.2 Paragraph II
4.3 Paragraph III
4.4 Paragraph IV
4.5 Paragraph V
4.6 Paragraph VI
4.7 Paragraph VII
4.8 Paragraph VIII
4.9 Die „sanctio“
5.) Die Institutionalisierung des Prinzipats
6.) Zusammenfassung
7.) Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „lex de imperio Vespasiani“?
Es handelt sich um eine Inschrift aus dem Jahr 69 n. Chr., die die Kompetenzen, Befugnisse und Privilegien des Kaisers Vespasian festlegte.
In welchem historischen Kontext entstand das Gesetz?
Es entstand nach den Wirren des Vierkaiserjahres (68/69 n. Chr.), aus denen Vespasian als Sieger hervorging.
Was war die Basis des augusteischen Prinzipats?
Die Basis bildeten die „tribunicia potestas“ (völkertribunizische Gewalt) und das „imperium proconsulare“.
Hatten die römischen Principes unbegrenzte Macht?
Die Arbeit untersucht, ob dem Kaiser Grenzen gesetzt waren oder ob er in einem rechtsfreien Raum regieren konnte.
Was bedeutet „auctoritas“ im Zusammenhang mit dem Princeps?
Die „auctoritas“ war der Ausdruck der moralischen und politischen Vorrangstellung des Kaisers im Staat.
- Citar trabajo
- Nils Marvin Schulz (Autor), 2010, Die "lex de imperio Vespasiani" und der Prinzipat in der frühen römischen Kaiserzeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201804