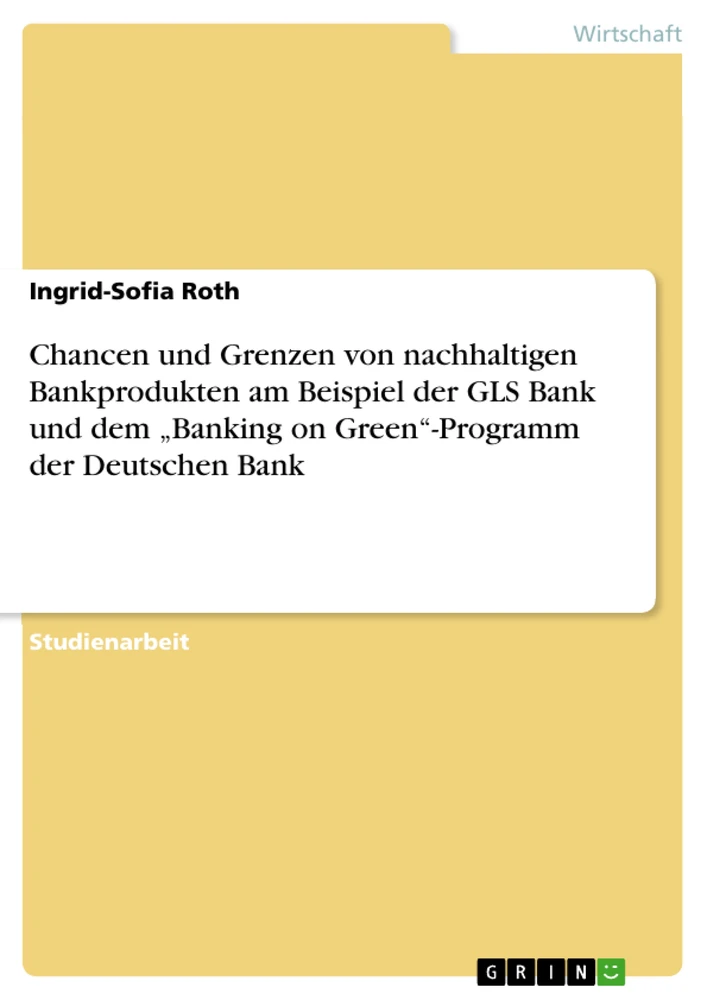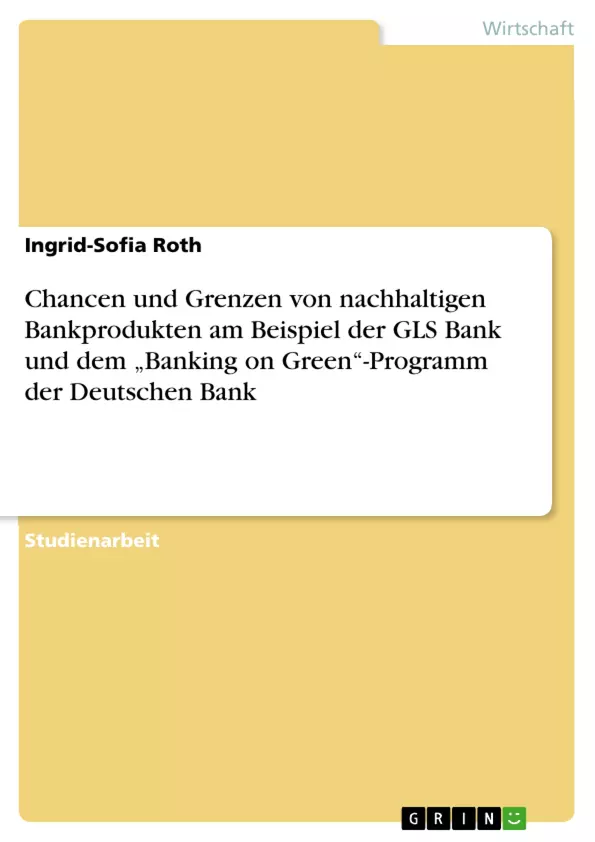Der Markt für nachhaltigkeitsorientierte Investmentfonds und Finanzprodukte ist im deutschsprachigen Raum im Jahr 2010 um 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen und erreichte damit ein Volumen von 51,9 Milliarden Euro. Ebenso sind auch die Geschäftsvolumina der sogenannten „Social Banks“ in den Jahren 2006 bis 2008 um durchschnittlich etwa 20 bis 25 Prozent gestiegen; auf dem damaligen Höhepunkt der Finanzkrise im Jahr 2009 sogar um 30 Prozent. Eine aktuelle Studie bestätigt diese Wachstumsraten auch weiterhin. Damit gehören sie zu den am stärksten wachsenden Segmenten im Bankensektor.
Ein wesentlicher Hintergrund dieser Entwicklung ist, dass durch die verstärkte mediale Berichterstattung seit dem Beginn der Finanzkrise im Jahr 2007 eine öffentliche Diskussion darüber entstanden ist, in welcher Art und Weise Bankgeschäfte abgewickelt werden und welche Differenzen zwischen den Interessen der Kunden und denen der (konventionellen) Banken bestehen. Als Konsequenz daraus wechselten viele Kunden das Institut. Hinzu kommt jedoch auch ein grundsätzlicher Wertewandel in der Gesellschaft. Innerhalb der letzten drei Jahrzehnte kann eine generelle Einstellungsänderung in der Bevölkerung in Richtung eines stärker nachhaltigkeitsorientierten Lebensstils festgestellt werden. Dieser Wertewandel ist auf die Zunahme des Wohlstandes und des Wissens in der Gesellschaft zurückzuführen, die zu einer „Moralisierung der Märkte“ führen, indem beispielsweise die Art und Weise von Herstellungsbedingungen, Fertigungsprozessen oder des Marktauftrittes für Kunden transparent und damit zu einem wesentlichen Bewertungskriterium werden. Die erhöhte Transparenz wiederum ist insbesondere auf heutige digitale Kommunikationsmöglichkeiten zurückzuführen, die es Kunden und weiteren Bezugsgruppen erlauben, mit geringem Aufwand Informationen zu sammeln und zu verbreiten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Relevanz der Arbeit
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1 Social Banking
- 2.2 Ethik und Moral
- 2.2.1 Funktionalistische Bankenethik
- 2.2.2 Separative Bankenethik
- 2.2.3 Integrative Bankenethik
- 2.3 Nachhaltigkeit
- 2.4 LOHAS
- 3. GLS Bank
- 3.1 Entwicklung
- 3.2 Arbeitsweise und Produkte
- 4. Banking on Green - Programm der Deutschen Bank
- 4.1 Entwicklung
- 4.2 Arbeitsweise und Produkte
- 5. Chancen und Grenzen
- 5.1 Verstärktes öffentliches Interesse
- 5.2 Neue Kundensegmente
- 5.3 Kreditgeschäft
- 5.4 Finanzierung nachhaltiger Großprojekte
- 5.5 Personal
- 5.6 Marketing
- 5.7 Social Media
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Chancen und Grenzen nachhaltiger Bankprodukte anhand der GLS Bank und des „Banking on Green“-Programms der Deutschen Bank. Sie analysiert die Entwicklung des Marktes für nachhaltige Finanzprodukte und den Einfluss gesellschaftlicher Wertewandel auf das Bankgeschäft. Die Arbeit beleuchtet die Geschäftsmodelle beider Banken und bewertet deren Erfolg im Kontext der wachsenden Nachfrage nach ethisch und ökologisch verantwortungsvollen Finanzdienstleistungen.
- Entwicklung und Charakteristika nachhaltiger Bankprodukte
- Analyse der Geschäftsmodelle der GLS Bank und des „Banking on Green“-Programms
- Chancen und Herausforderungen für nachhaltiges Banking
- Einfluss gesellschaftlicher Wertewandel auf den Finanzmarkt
- Potenzial und Grenzen der Marktdurchdringung nachhaltiger Finanzdienstleistungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung dar, indem sie das starke Wachstum des Marktes für nachhaltige Finanzprodukte im deutschsprachigen Raum hervorhebt und den Wertewandel in der Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit betont. Die zunehmende mediale Berichterstattung über die Finanzkrise und die daraus resultierende Diskussion um Bankgeschäfte und die Interessenkonflikte zwischen Kunden und Banken werden als wesentliche Triebkräfte dieser Entwicklung identifiziert. Die Arbeit begründet die Relevanz des Themas und skizziert den Aufbau der folgenden Kapitel.
2. Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen zentraler Begriffe wie Social Banking, Ethik und Moral (inklusive funktionalistischer, separativer und integrativer Bankenethik) und Nachhaltigkeit. Es klärt den Kontext und die unterschiedlichen Perspektiven auf diese Konzepte, die für das Verständnis der darauffolgenden Analysen der GLS Bank und des „Banking on Green“-Programms unerlässlich sind. Der Begriff LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) wird ebenfalls definiert und in den Zusammenhang gebracht.
3. GLS Bank: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung und die Arbeitsweise der GLS Bank als Beispiel für eine erfolgreiche Social Bank. Es analysiert die Produkte und Strategien der Bank, die auf ethischen und ökologischen Prinzipien basieren. Die Darstellung fokussiert auf die Umsetzung nachhaltiger Geschäftspraktiken und die Ausrichtung auf eine spezifische Kundengruppe. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Geschäftsmodells und dessen Erfolgsfaktoren.
4. Banking on Green - Programm der Deutschen Bank: Dieses Kapitel analysiert das „Banking on Green“-Programm der Deutschen Bank als Beispiel für das Engagement einer Großbank im Bereich nachhaltiger Finanzen. Es beleuchtet die Entwicklung des Programms, seine Arbeitsweise und die angebotenen Produkte. Im Gegensatz zur GLS Bank, steht hier der Ansatz einer großen, konventionellen Bank im Fokus, die Nachhaltigkeit in ihr bestehendes Geschäftsmodell integriert.
5. Chancen und Grenzen: Dieses Kapitel untersucht die Chancen und Grenzen nachhaltiger Bankprodukte, indem es verschiedene Aspekte wie das verstärkte öffentliche Interesse, die Erschließung neuer Kundensegmente, das Kreditgeschäft, die Finanzierung nachhaltiger Großprojekte, Personalmanagement, Marketing und den Einsatz von Social Media beleuchtet. Es identifiziert die Herausforderungen, denen sich nachhaltig orientierte Banken gegenübersehen, und diskutiert deren strategische Implikationen.
Schlüsselwörter
Nachhaltigkeit, Social Banking, GLS Bank, Banking on Green, Deutsche Bank, Ethik, Moral, Wertewandel, Finanzmarkt, nachhaltige Finanzprodukte, Kundensegmente, Kreditgeschäft, Marketing, Social Media.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Chancen und Grenzen nachhaltiger Bankprodukte"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Chancen und Grenzen nachhaltiger Bankprodukte anhand von zwei Fallbeispielen: der GLS Bank und dem „Banking on Green“-Programm der Deutschen Bank. Sie untersucht die Entwicklung des Marktes für nachhaltige Finanzprodukte, den Einfluss gesellschaftlicher Wertewandel auf das Bankgeschäft und bewertet die Geschäftsmodelle beider Banken im Kontext der wachsenden Nachfrage nach ethisch und ökologisch verantwortungsvollen Finanzdienstleistungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Entwicklung und Charakteristika nachhaltiger Bankprodukte, Analyse der Geschäftsmodelle der GLS Bank und des „Banking on Green“-Programms, Chancen und Herausforderungen für nachhaltiges Banking, Einfluss gesellschaftlicher Wertewandel auf den Finanzmarkt und das Potenzial und die Grenzen der Marktdurchdringung nachhaltiger Finanzdienstleistungen. Es werden Begriffe wie Social Banking, Ethik, Moral (inklusive verschiedener ethischer Ansätze im Bankwesen), Nachhaltigkeit und LOHAS definiert und erläutert.
Welche Banken werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die GLS Bank als Beispiel für eine Social Bank und das „Banking on Green“-Programm der Deutschen Bank als Beispiel für das Engagement einer Großbank im Bereich nachhaltiger Finanzen. Der Vergleich beider Ansätze soll die unterschiedlichen Strategien und Herausforderungen verdeutlichen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Begriffsdefinitionen, Kapitel zur GLS Bank und zum „Banking on Green“-Programm, ein Kapitel zu Chancen und Grenzen nachhaltiger Bankprodukte und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird zusammengefasst und die wichtigsten Punkte werden hervorgehoben.
Welche Chancen und Grenzen nachhaltiger Bankprodukte werden diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet Chancen wie verstärktes öffentliches Interesse, Erschließung neuer Kundensegmente und die Finanzierung nachhaltiger Großprojekte. Zu den Grenzen gehören Herausforderungen im Kreditgeschäft, Personalmanagement, Marketing und der Nutzung von Social Media.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Nachhaltigkeit, Social Banking, GLS Bank, Banking on Green, Deutsche Bank, Ethik, Moral, Wertewandel, Finanzmarkt, nachhaltige Finanzprodukte, Kundensegmente, Kreditgeschäft, Marketing und Social Media.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Chancen und Grenzen nachhaltiger Bankprodukte und analysiert den Einfluss gesellschaftlicher Wertewandel auf das Bankgeschäft. Sie bewertet den Erfolg der untersuchten Geschäftsmodelle im Kontext der wachsenden Nachfrage nach ethisch und ökologisch verantwortungsvollen Finanzdienstleistungen.
- Quote paper
- Ingrid-Sofia Roth (Author), 2012, Chancen und Grenzen von nachhaltigen Bankprodukten am Beispiel der GLS Bank und dem „Banking on Green“-Programm der Deutschen Bank, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201819