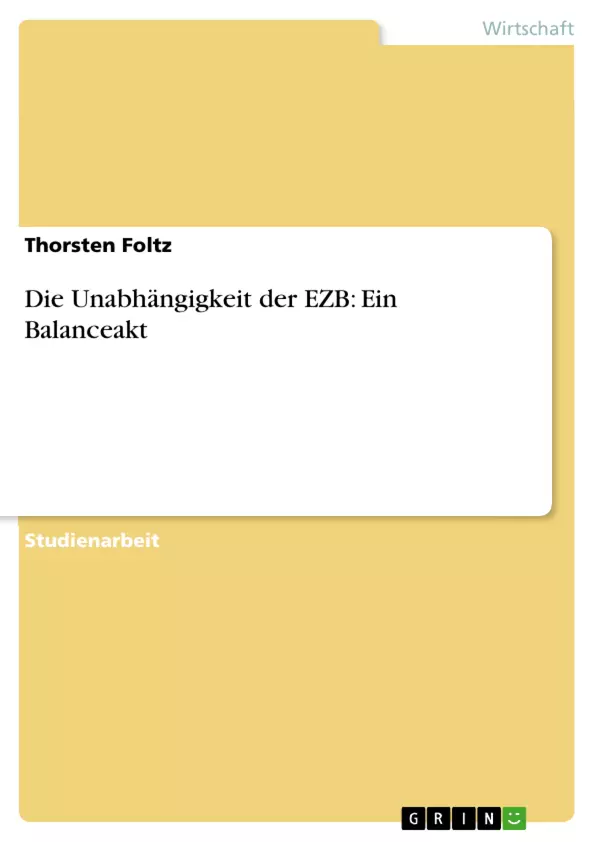Am 15. September 2008 gab die US-Investmentbank Lehman Brothers ihre Insolvenz bekannt. Nachdem die Regierung der USA verkündete, dass sie der Bank kein Geld bereitstelle um diese zu stützen, kam es zu einer gegenseitigen Vertrauenskrise der Finanzmarktteilnehmer.
Als Folge dessen stockte der Interbankenverkehr, da die Banken nicht wussten welche Risiken in den Büchern der jeweils anderen standen und folglich befürchteten ihr verliehenes Geld nicht wieder zu bekommen. Wegen der (fast) weltweiten Vernetzung der Volkswirtschaften blieben die Auswirkungen nicht auf den US-Amerikanischen oder angelsächsischen Markt beschränkt, sondern trafen auch viele asiatische Staaten und insbesondere die Märkte in Europa. Die Regierungen sahen sich gezwungen Gelder und Garantien in Höhe von hunderten Milliarden Dollar, Euro und Pfund bereitzustellen, um die Finanzmärkte (besonders den Interbankenhandel) zu reanimieren. Befürchtet wurden u.a. eine geringe Kreditvergabe an die Realwirtschaft und ein Bank Run.
Die Garantien und Gelder der Staaten wurden über Schuldverschreibungen bereitgestellt, welche als Folge zu großen Defiziten in den Haushalten und zu weiteren, teils enormen Staatsverschuldungen führte.
Aus der anfänglichen Krise der Banken- und Finanzindustrie wurde eine Krise der Staaten. Während im angelsächsischen Raum die Zentralbanken Anleihen ihrer jeweiligen Regierung kauften und damit die Liquidität jener, auch unter der Gefahr der Inflation, sicherstellten, ist die Problematik in Kontinentaleuropa komplexer. Zum einen besteht eine einheitliche Währung für 17 Mitglieder und mit der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Institution, welche eine gemeinsame Geldpolitik für die Währungsunion festlegt. Zum anderen weißt die Euro-Zone aber keine gemeinsame Fiskal- und Wirtschaftspolitik auf.
So zeigten und zeigen sich im weiteren Verlauf der Krise Abstimmungsprobleme zwischen den Regierungen, Streitigkeiten bei der Zuständigkeit und den Kompetenzen der Institution der Europäischen Union. Einzig die EZB scheint handlungsfähig zu sein, wobei sie vermehrt gegen ihren gegebenen Auftrag und ihre Rechte und Pflichten verstieß und verstößt.
In der vorliegenden Arbeit werden die Rolle und das Handeln der Europäischen Zentralbank im Verlauf der Krise und die daraus resultierenden Folgen untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 EZB, ESZB und der Euro
- 2.1 Historischer Überblick
- 2.2 Aufgaben der EZB und des ESZB
- 2.3 Ziele der EZB und des ESZB
- 2.4 Unabhängigkeit der EZB und des ESZB
- 2.4.1 Institutionelle Unabhängigkeit
- 2.4.2 Rechtliche Unabhängigkeit
- 2.4.3 Personelle Unabhängigkeit
- 2.4.4 Funktionelle Unabhängigkeit
- 2.4.5 Finanzielle und organisatorische Unabhängigkeit
- 2.5 Vergleich ausgewählter Zentralbanken
- 2.5.1 Das Federal Reserve System
- 2.5.2 Die Bank of England
- 2.5.3 Die Bank of Canada
- 2.5.4 Die Bank of Japan
- 2.5.5 Die Deutsche Bundesbank
- 2.5.6 Die Banque de France
- 2.5.7 Die Banca d'Italia
- 2.5.8 Zusammenfassung des Vergleiches der Zentralbanken
- 3 Problematik einer Währungsunion im Allgemeinen und der Eurozone im Speziellen
- 3.1 Vorteile einer Währungsunion
- 3.2 Nachteile einer Währungsunion
- 3.3 Kriterien für eine optimale Währungsunion
- 3.4 Bewertung der Eurozone an den Kriterien nach R. Mundell
- 3.5 Kriterien zum Beitritt der Währungsunion
- 4 Einflussnahme der Politik auf die EZB
- 4.1 Verstoß der EZB gegen den EGV
- 4.2 Folgen des Verstoßes gegen Art. 101 EGV
- 4.2.1 Die Glaubwürdigkeit der EZB
- 4.2.2 Die Gefahr der Inflation
- 4.2.3 Weitere versuchte Einflussnahme der Politik
- 4.3 Die Risiken im TARGET-System
- 4.4 Zusammenfassung
- 5 Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB) im Kontext der Europäischen Währungsunion (WWU). Ziel ist es, die institutionellen, rechtlichen, personellen und finanziellen Aspekte der EZB-Unabhängigkeit zu analysieren und deren Bedeutung für die Stabilität des Euros zu beleuchten. Der Vergleich mit ausgewählten Zentralbanken anderer Länder soll die Besonderheiten des EZB-Modells hervorheben.
- Die institutionelle und rechtliche Unabhängigkeit der EZB
- Die Ziele und Aufgaben der EZB im Rahmen des ESZB
- Der Vergleich der EZB mit anderen Zentralbanken
- Die Herausforderungen einer Währungsunion und ihre Auswirkungen auf die EZB
- Die Problematik politischer Einflussnahme auf die EZB
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der EZB-Unabhängigkeit ein und beschreibt die Relevanz der Thematik für die Stabilität des Euros und die Funktionsfähigkeit der WWU. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die Forschungsfragen.
2 EZB, ESZB und der Euro: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Europäische Zentralbank (EZB), das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) und den Euro. Es behandelt die historische Entwicklung, die Aufgaben und Ziele der EZB und des ESZB, sowie die verschiedenen Dimensionen der EZB-Unabhängigkeit (institutionell, rechtlich, personell, funktionell, finanziell und organisatorisch). Ein detaillierter Vergleich mit ausgewählten Zentralbanken weltweit (u.a. Federal Reserve System, Bank of England, Bank of Japan) veranschaulicht die Besonderheiten des europäischen Modells und dessen Stärken und Schwächen im Kontext internationaler Best Practices. Die Zusammenfassung des Vergleichs analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der untersuchten Zentralbanken im Hinblick auf ihre Unabhängigkeit und ihre Rolle in der jeweiligen Wirtschaftsordnung.
3 Problematik einer Währungsunion im Allgemeinen und der Eurozone im Speziellen: Dieses Kapitel analysiert die Vor- und Nachteile einer Währungsunion im Allgemeinen und bewertet die Eurozone anhand der Kriterien nach Robert Mundell. Es untersucht, inwieweit die Eurozone die notwendigen Voraussetzungen für eine optimale Währungsunion erfüllt und diskutiert die Kriterien für einen erfolgreichen Beitritt zu einer Währungsunion. Die Diskussion umfasst sowohl ökonomische als auch politische Aspekte, unter Berücksichtigung der Herausforderungen der asymmetrischen Schockabsorption und der Notwendigkeit fiskalischer Koordinierung.
4 Einflussnahme der Politik auf die EZB: Dieses Kapitel befasst sich mit der potenziellen Einflussnahme der Politik auf die EZB, insbesondere mit Verstößen gegen den EGV und deren Folgen. Es analysiert die Auswirkungen einer solchen Einflussnahme auf die Glaubwürdigkeit der EZB und die Gefahr von Inflation. Es betrachtet auch die Risiken im TARGET-System und fasst die Erkenntnisse zum Thema politische Einflussnahme zusammen. Der Fokus liegt auf der Spannung zwischen der notwendigen Unabhängigkeit der Zentralbank und den legitimen Interessen der politischen Entscheidungsträger.
Schlüsselwörter
Europäische Zentralbank (EZB), Europäisches System der Zentralbanken (ESZB), Euro, Währungsunion, Unabhängigkeit der Zentralbank, Inflation, Preisstabilität, Monetärpolitik, Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), politische Einflussnahme, TARGET-System, Vergleich internationaler Zentralbanken, Europäischer Gerichtshof (EuGH).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB) im Kontext der Europäischen Währungsunion (WWU). Sie analysiert die institutionellen, rechtlichen, personellen und finanziellen Aspekte der EZB-Unabhängigkeit und deren Bedeutung für die Stabilität des Euros. Ein Vergleich mit anderen Zentralbanken weltweit soll die Besonderheiten des EZB-Modells hervorheben.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die institutionelle und rechtliche Unabhängigkeit der EZB, die Ziele und Aufgaben der EZB im Rahmen des ESZB, einen Vergleich der EZB mit anderen Zentralbanken (z.B. Federal Reserve System, Bank of England, Bank of Japan), die Herausforderungen einer Währungsunion und deren Auswirkungen auf die EZB, sowie die Problematik politischer Einflussnahme auf die EZB.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, EZB, ESZB und der Euro (inkl. historischer Überblick und Vergleich mit anderen Zentralbanken), Problematik einer Währungsunion (inkl. Vor- und Nachteile und Kriterien für eine optimale Währungsunion), Einflussnahme der Politik auf die EZB (inkl. Verstöße gegen den EGV und Risiken im TARGET-System), und Ergebnis.
Wie ist die Unabhängigkeit der EZB definiert und untersucht?
Die Unabhängigkeit der EZB wird anhand verschiedener Dimensionen untersucht: institutionelle, rechtliche, personelle, funktionelle und finanzielle Unabhängigkeit. Der Vergleich mit anderen Zentralbanken soll zeigen, inwieweit das EZB-Modell in Bezug auf Unabhängigkeit einzigartig ist und welche Stärken und Schwächen es aufweist.
Welche Rolle spielt der Vergleich mit anderen Zentralbanken?
Der Vergleich mit ausgewählten Zentralbanken (Federal Reserve System, Bank of England, Bank of Canada, Bank of Japan, Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia) dient dazu, die Besonderheiten des EZB-Modells im internationalen Kontext zu beleuchten und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in Bezug auf Unabhängigkeit und Rolle innerhalb der jeweiligen Wirtschaftsordnung herauszuarbeiten.
Welche Herausforderungen einer Währungsunion werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Vor- und Nachteile einer Währungsunion im Allgemeinen und bewertet die Eurozone anhand der Kriterien nach Robert Mundell. Sie untersucht die Voraussetzungen für eine optimale Währungsunion und diskutiert die Kriterien für einen erfolgreichen Beitritt, wobei sowohl ökonomische als auch politische Aspekte berücksichtigt werden.
Wie wird die Problematik der politischen Einflussnahme auf die EZB behandelt?
Die Arbeit untersucht potenzielle politische Einflussnahme auf die EZB, insbesondere Verstöße gegen den EGV und deren Folgen für die Glaubwürdigkeit der EZB und das Inflationsrisiko. Die Risiken im TARGET-System werden ebenfalls analysiert. Der Fokus liegt auf der Spannung zwischen der notwendigen Unabhängigkeit der Zentralbank und den legitimen Interessen der Politik.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäische Zentralbank (EZB), Europäisches System der Zentralbanken (ESZB), Euro, Währungsunion, Unabhängigkeit der Zentralbank, Inflation, Preisstabilität, Monetärpolitik, Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), politische Einflussnahme, TARGET-System, Vergleich internationaler Zentralbanken, Europäischer Gerichtshof (EuGH).
- Quote paper
- Thorsten Foltz (Author), 2011, Die Unabhängigkeit der EZB: Ein Balanceakt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201920